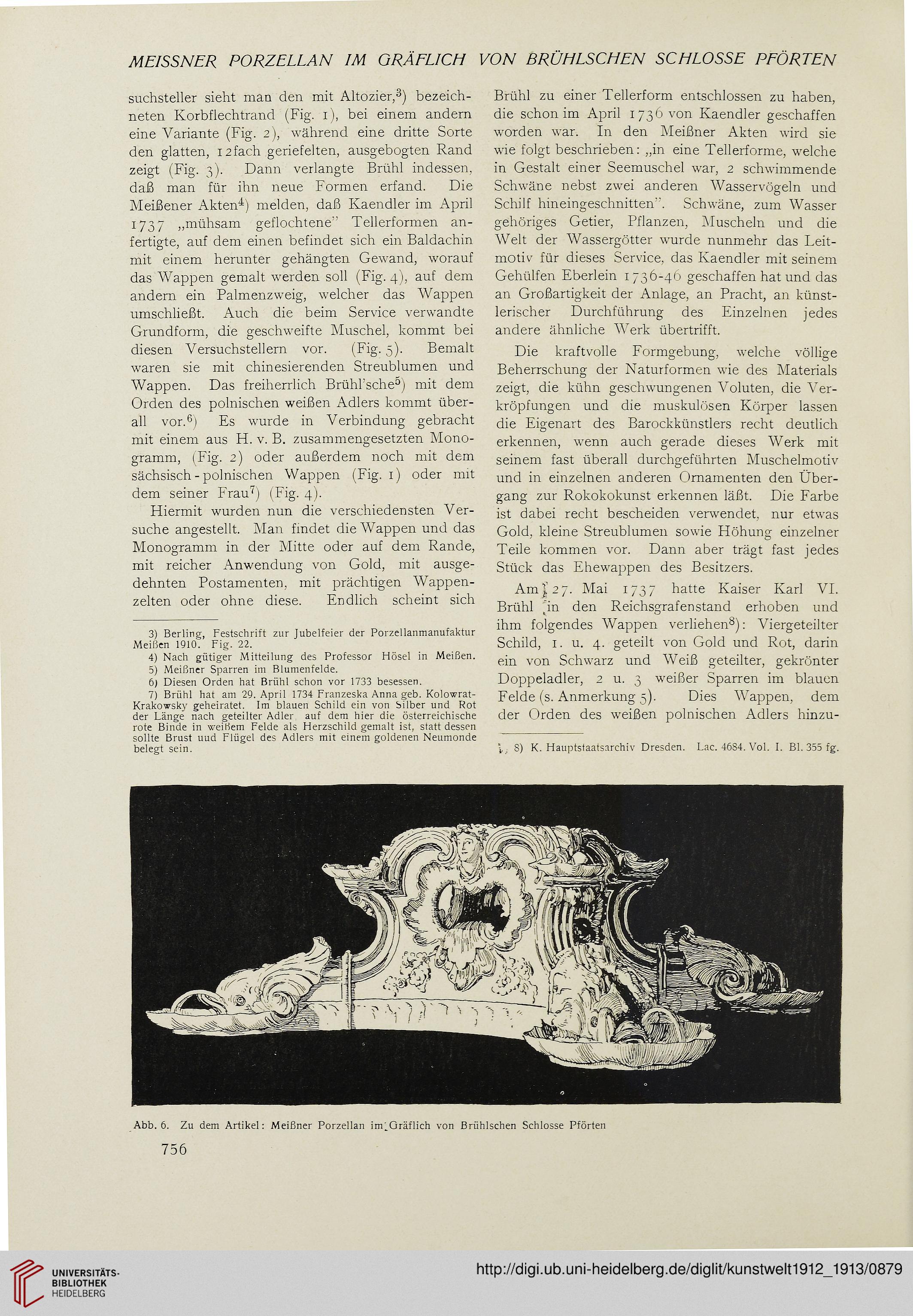MEISSNER PORZELLAN IM GRÄFLICH VON BRÜHLSCHEN SCHLOSSE PFORTEN
suchsteiler sieht man den mit Altozier,3) bezeich-
neten Korbflechtrand (Fig. i), bei einem andern
eine Variante (Fig. 2), während eine dritte Sorte
den glatten, 12 fach geriefelten, ausgebogten Rand
zeigt (Fig. 3). Dann verlangte Brühl indessen,
daß man für ihn neue Formen erfand. Die
Meißener Akten4) melden, daß Kaendler im April
1737 „mühsam geflochtene" Tellerformen an-
fertigte, auf dem einen befindet sich ein Baldachin
mit einem herunter gehängten Gewand, worauf
das Wappen gemalt werden soll (Fig. 4), auf dem
andern ein Palmenzweig, welcher das Wappen
umschließt. Auch die beim Service verwandte
Grundform, die geschweifte Muschel, kommt bei
diesen Versuchstellern vor. (Fig. 5). Bemalt
waren sie mit chinesierenden Streublumen und
Wappen. Das freiherrlich Brühl!sche5) mit dem
Orden des polnischen weißen Adlers kommt über-
all vor.6) Es wurde in Verbindung gebracht
mit einem aus H. v. B. zusammengesetzten Mono-
gramm, (Fig. 2) oder außerdem noch mit dem
sächsisch - polnischen Wappen (Fig. 1) oder mit
dem seiner Frau7) (Fig. 4).
Hiermit wurden nun die verschiedensten Ver-
suche angestellt. Man findet die Wappen und das
Monogramm in der Mitte oder auf dem Rande,
mit reicher Anwendung von Gold, mit ausge-
dehnten Postamenten, mit prächtigen Wappen-
zelten oder ohne diese. Endlich scheint sich
3) Beding, Festschrift zur Jubelfeier der Porzellanmanufaktur
Meißen 1910. Fig. 22.
4) Nach gütiger Mitteilung des Professor Hösel in Meißen.
5) Meißner Sparren im Blumenfelde.
6) Diesen Orden hat Brühl schon vor 1733 besessen.
7) Brühl hat am 29. April 1734 Franzeska Anna geb. Kolowrat-
Krakowsky geheiratet. Im blauen Schild ein von Silber und Rot
der Länge nach geteilter Adler auf dem hier die österreichische
rote Binde in weißem Felde als Herzschild gemalt ist, stattdessen
sollte Brust uud Flügel des Adlers mit einem goldenen Neumonde
belegt sein.
Brühl zu einer Tellerform entschlossen zu haben,
die schon im April 1730 von Kaendler geschaffen
worden war. In den Meißner Akten wird sie
wie folgt beschrieben: „in eine Tellerforme, welche
in Gestalt einer Seemuschel war, 2 schwimmende
Schwäne nebst zwei anderen Wasservögeln und
Schilf hineingeschnitten"'. Schwäne, zum Wasser
gehöriges Getier, Pflanzen, Muscheln und die
Welt der Wassergötter wurde nunmehr das Leit-
motiv für dieses Service, das Kaendler mit seinem
Gehülfen Eberlein 1 736-40 geschaffen hat und das
an Großartigkeit der Anlage, an Pracht, an künst-
lerischer Durchführung des Einzelnen jedes
andere ähnliche Werk übertrifft.
Die kraftvolle Formgebung, welche völlige
Beherrschung der Naturformen wie des Materials
zeigt, die kühn geschwungenen Voluten, die Ver-
kröpf ungen und die muskulösen Körper lassen
die Eigenart des Barockkünstlers recht deutlich
erkennen, wenn auch gerade dieses Werk mit
seinem fast überall durchgeführten Muschelmotiv
und in einzelnen anderen Ornamenten den Über-
gang zur Rokokokunst erkennen läßt. Die Farbe
ist dabei recht bescheiden verwendet, nur etwas
Gold, kleine Streublumen sowie Höhung einzelner
Teile kommen vor. Dann aber trägt fast jedes
Stück das Ehewappen des Besitzers.
Am].'27. Mai 1737 hatte Kaiser Karl VI.
Brühl ('in den Reichsgrafenstand erhoben und
ihm folgendes Wappen verliehen8): Viergeteilter
Schild, 1. u. 4. geteilt von Gold und Rot, darin
ein von Schwarz und Weiß geteilter, gekrönter
Doppeladler, 2 u. 3 weißer Sparren im blauen
Felde (s. Anmerkung 5). Dies Wappen, dem
der Orden des weißen polnischen Adlers hinzu-
V, 8) K. Hauptsfaatsarchiv Dresden. Lac. 46S4. Vol. I. Bl. 355 fg.
Abb. 6. Zu dem Artikel: Meißner Porzellan inV Gräflich von Brühischen Schlosse Pforten
756
suchsteiler sieht man den mit Altozier,3) bezeich-
neten Korbflechtrand (Fig. i), bei einem andern
eine Variante (Fig. 2), während eine dritte Sorte
den glatten, 12 fach geriefelten, ausgebogten Rand
zeigt (Fig. 3). Dann verlangte Brühl indessen,
daß man für ihn neue Formen erfand. Die
Meißener Akten4) melden, daß Kaendler im April
1737 „mühsam geflochtene" Tellerformen an-
fertigte, auf dem einen befindet sich ein Baldachin
mit einem herunter gehängten Gewand, worauf
das Wappen gemalt werden soll (Fig. 4), auf dem
andern ein Palmenzweig, welcher das Wappen
umschließt. Auch die beim Service verwandte
Grundform, die geschweifte Muschel, kommt bei
diesen Versuchstellern vor. (Fig. 5). Bemalt
waren sie mit chinesierenden Streublumen und
Wappen. Das freiherrlich Brühl!sche5) mit dem
Orden des polnischen weißen Adlers kommt über-
all vor.6) Es wurde in Verbindung gebracht
mit einem aus H. v. B. zusammengesetzten Mono-
gramm, (Fig. 2) oder außerdem noch mit dem
sächsisch - polnischen Wappen (Fig. 1) oder mit
dem seiner Frau7) (Fig. 4).
Hiermit wurden nun die verschiedensten Ver-
suche angestellt. Man findet die Wappen und das
Monogramm in der Mitte oder auf dem Rande,
mit reicher Anwendung von Gold, mit ausge-
dehnten Postamenten, mit prächtigen Wappen-
zelten oder ohne diese. Endlich scheint sich
3) Beding, Festschrift zur Jubelfeier der Porzellanmanufaktur
Meißen 1910. Fig. 22.
4) Nach gütiger Mitteilung des Professor Hösel in Meißen.
5) Meißner Sparren im Blumenfelde.
6) Diesen Orden hat Brühl schon vor 1733 besessen.
7) Brühl hat am 29. April 1734 Franzeska Anna geb. Kolowrat-
Krakowsky geheiratet. Im blauen Schild ein von Silber und Rot
der Länge nach geteilter Adler auf dem hier die österreichische
rote Binde in weißem Felde als Herzschild gemalt ist, stattdessen
sollte Brust uud Flügel des Adlers mit einem goldenen Neumonde
belegt sein.
Brühl zu einer Tellerform entschlossen zu haben,
die schon im April 1730 von Kaendler geschaffen
worden war. In den Meißner Akten wird sie
wie folgt beschrieben: „in eine Tellerforme, welche
in Gestalt einer Seemuschel war, 2 schwimmende
Schwäne nebst zwei anderen Wasservögeln und
Schilf hineingeschnitten"'. Schwäne, zum Wasser
gehöriges Getier, Pflanzen, Muscheln und die
Welt der Wassergötter wurde nunmehr das Leit-
motiv für dieses Service, das Kaendler mit seinem
Gehülfen Eberlein 1 736-40 geschaffen hat und das
an Großartigkeit der Anlage, an Pracht, an künst-
lerischer Durchführung des Einzelnen jedes
andere ähnliche Werk übertrifft.
Die kraftvolle Formgebung, welche völlige
Beherrschung der Naturformen wie des Materials
zeigt, die kühn geschwungenen Voluten, die Ver-
kröpf ungen und die muskulösen Körper lassen
die Eigenart des Barockkünstlers recht deutlich
erkennen, wenn auch gerade dieses Werk mit
seinem fast überall durchgeführten Muschelmotiv
und in einzelnen anderen Ornamenten den Über-
gang zur Rokokokunst erkennen läßt. Die Farbe
ist dabei recht bescheiden verwendet, nur etwas
Gold, kleine Streublumen sowie Höhung einzelner
Teile kommen vor. Dann aber trägt fast jedes
Stück das Ehewappen des Besitzers.
Am].'27. Mai 1737 hatte Kaiser Karl VI.
Brühl ('in den Reichsgrafenstand erhoben und
ihm folgendes Wappen verliehen8): Viergeteilter
Schild, 1. u. 4. geteilt von Gold und Rot, darin
ein von Schwarz und Weiß geteilter, gekrönter
Doppeladler, 2 u. 3 weißer Sparren im blauen
Felde (s. Anmerkung 5). Dies Wappen, dem
der Orden des weißen polnischen Adlers hinzu-
V, 8) K. Hauptsfaatsarchiv Dresden. Lac. 46S4. Vol. I. Bl. 355 fg.
Abb. 6. Zu dem Artikel: Meißner Porzellan inV Gräflich von Brühischen Schlosse Pforten
756