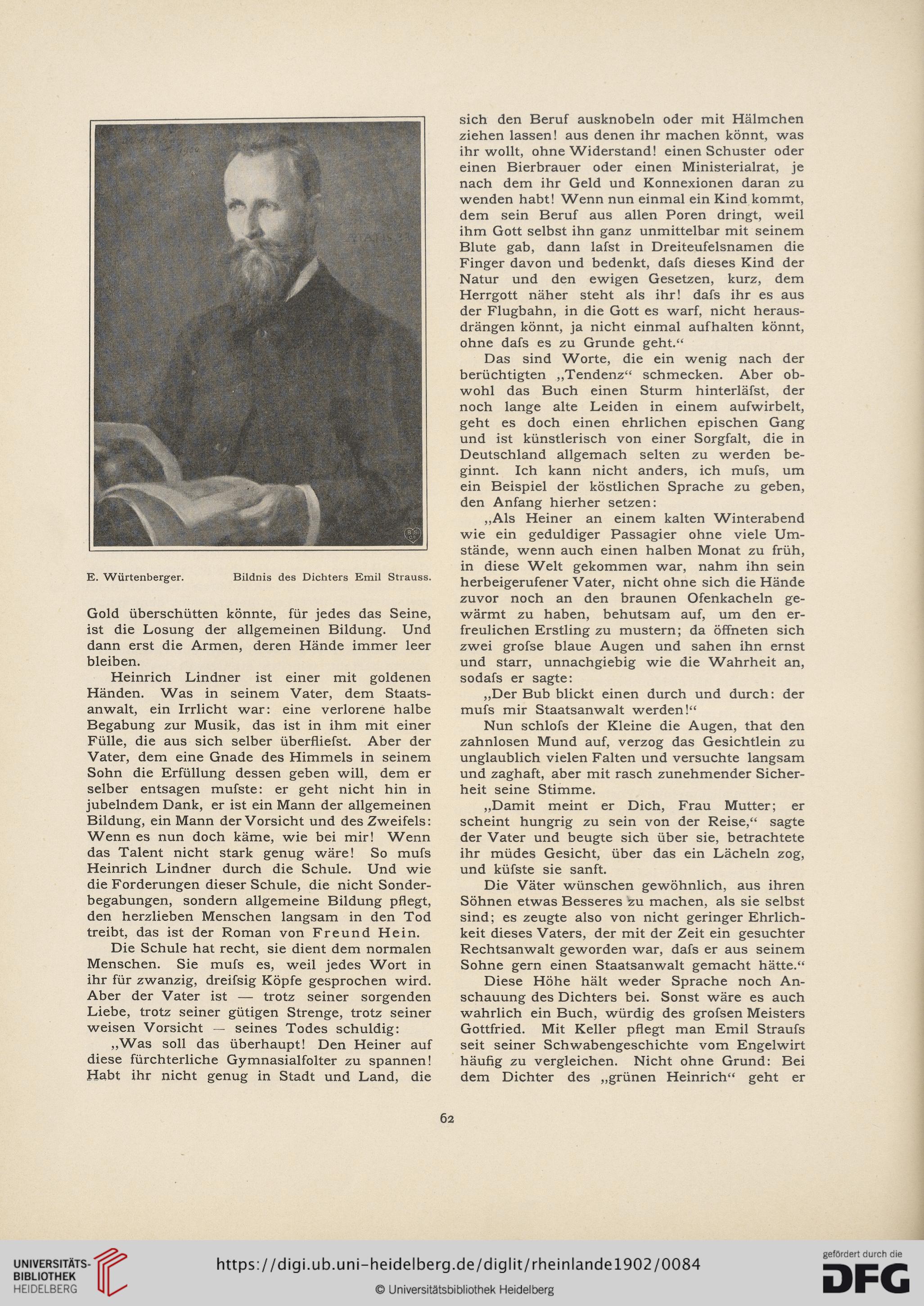E. Würtenberger.
Bildnis des Dichters Emil Strauss.
Gold überschütten könnte, für jedes das Seine,
ist die Losung der allgemeinen Bildung. Und
dann erst die Armen, deren Hände immer leer
bleiben.
Heinrich Lindner ist einer mit goldenen
Händen. Was in seinem Vater, dem Staats-
anwalt, ein Irrlicht war: eine verlorene halbe
Begabung zur Musik, das ist in ihm mit einer
Fülle, die aus sich selber überfliefst. Aber der
Vater, dem eine Gnade des Himmels in seinem
Sohn die Erfüllung dessen geben will, dem er
selber entsagen mufste: er geht nicht hin in
jubelndem Dank, er ist ein Mann der allgemeinen
Bildung, ein Mann der Vorsicht und des Zweifels:
Wenn es nun doch käme, wie bei mir! Wenn
das Talent nicht stark genug wäre! So mufs
Heinrich Lindner durch die Schule. Und wie
die Forderungen dieser Schule, die nicht Sonder-
begabungen, sondern allgemeine Bildung pflegt,
den herzlieben Menschen langsam in den Tod
treibt, das ist der Roman von Freund Hein.
Die Schule hat recht, sie dient dem normalen
Menschen. Sie mufs es, weil jedes Wort in
ihr für zwanzig, dreifsig Köpfe gesprochen wird.
Aber der Vater ist — trotz seiner sorgenden
Liebe, trotz seiner gütigen Strenge, trotz seiner
weisen Vorsicht — seines Todes schuldig:
„Was soll das überhaupt! Den Heiner auf
diese fürchterliche Gymnasialfolter zu spannen!
Habt ihr nicht genug in Stadt und Land, die
sich den Beruf ausknobeln oder mit Hälmchen
ziehen lassen! aus denen ihr machen könnt, was
ihr wollt, ohne Widerstand! einen Schuster oder
einen Bierbrauer oder einen Ministerialrat, je
nach dem ihr Geld und Konnexionen daran zu
wenden habt! Wenn nun einmal ein Kind kommt,
dem sein Beruf aus allen Poren dringt, weil
ihm Gott selbst ihn ganz unmittelbar mit seinem
Blute gab, dann lafst in Dreiteufelsnamen die
Finger davon und bedenkt, dafs dieses Kind der
Natur und den ewigen Gesetzen, kurz, dem
Herrgott näher steht als ihr! dafs ihr es aus
der Flugbahn, in die Gott es warf, nicht heraus-
drängen könnt, ja nicht einmal aufhalten könnt,
ohne dafs es zu Grunde geht.“
Das sind Worte, die ein wenig nach der
berüchtigten „Tendenz“ schmecken. Aber ob-
wohl das Buch einen Sturm hinterläfst, der
noch lange alte Leiden in einem aufwirbelt,
geht es doch einen ehrlichen epischen Gang
und ist künstlerisch von einer Sorgfalt, die in
Deutschland allgemach selten zu werden be-
ginnt. Ich kann nicht anders, ich mufs, um
ein Beispiel der köstlichen Sprache zu geben,
den Anfang hierher setzen:
„Als Heiner an einem kalten Winterabend
wie ein geduldiger Passagier ohne viele Um-
stände, wenn auch einen halben Monat zu früh,
in diese Welt gekommen war, nahm ihn sein
herbeigerufener Vater, nicht ohne sich die Hände
zuvor noch an den braunen Ofenkacheln ge-
wärmt zu haben, behutsam auf, um den er-
freulichen Erstling zu mustern; da öffneten sich
zwei grofse blaue Augen und sahen ihn ernst
und starr, unnachgiebig wie die Wahrheit an,
sodafs er sagte:
„Der Bub blickt einen durch und durch: der
mufs mir Staatsanwalt werden!“
Nun schlofs der Kleine die Augen, that den
zahnlosen Mund auf, verzog das Gesichtlein zu
unglaublich vielen Falten und versuchte langsam
und zaghaft, aber mit rasch zunehmender Sicher-
heit seine Stimme.
„Damit meint er Dich, Frau Mutter; er
scheint hungrig zu sein von der Reise,“ sagte
der Vater und beugte sich über sie, betrachtete
ihr müdes Gesicht, über das ein Lächeln zog,
und küfste sie sanft.
Die Väter wünschen gewöhnlich, aus ihren
Söhnen etwas Besseres zu machen, als sie selbst
sind; es zeugte also von nicht geringer Ehrlich-
keit dieses Vaters, der mit der Zeit ein gesuchter
Rechtsanwalt geworden war, dafs er aus seinem
Sohne gern einen Staatsanwalt gemacht hätte.“
Diese Höhe hält weder Sprache noch An-
schauung des Dichters bei. Sonst wäre es auch
wahrlich ein Buch, würdig des grofsen Meisters
Gottfried. Mit Keller pflegt man Emil Straufs
seit seiner Schwabengeschichte vom Engelwirt
häufig zu vergleichen. Nicht ohne Grund: Bei
dem Dichter des „grünen Heinrich“ geht er
62