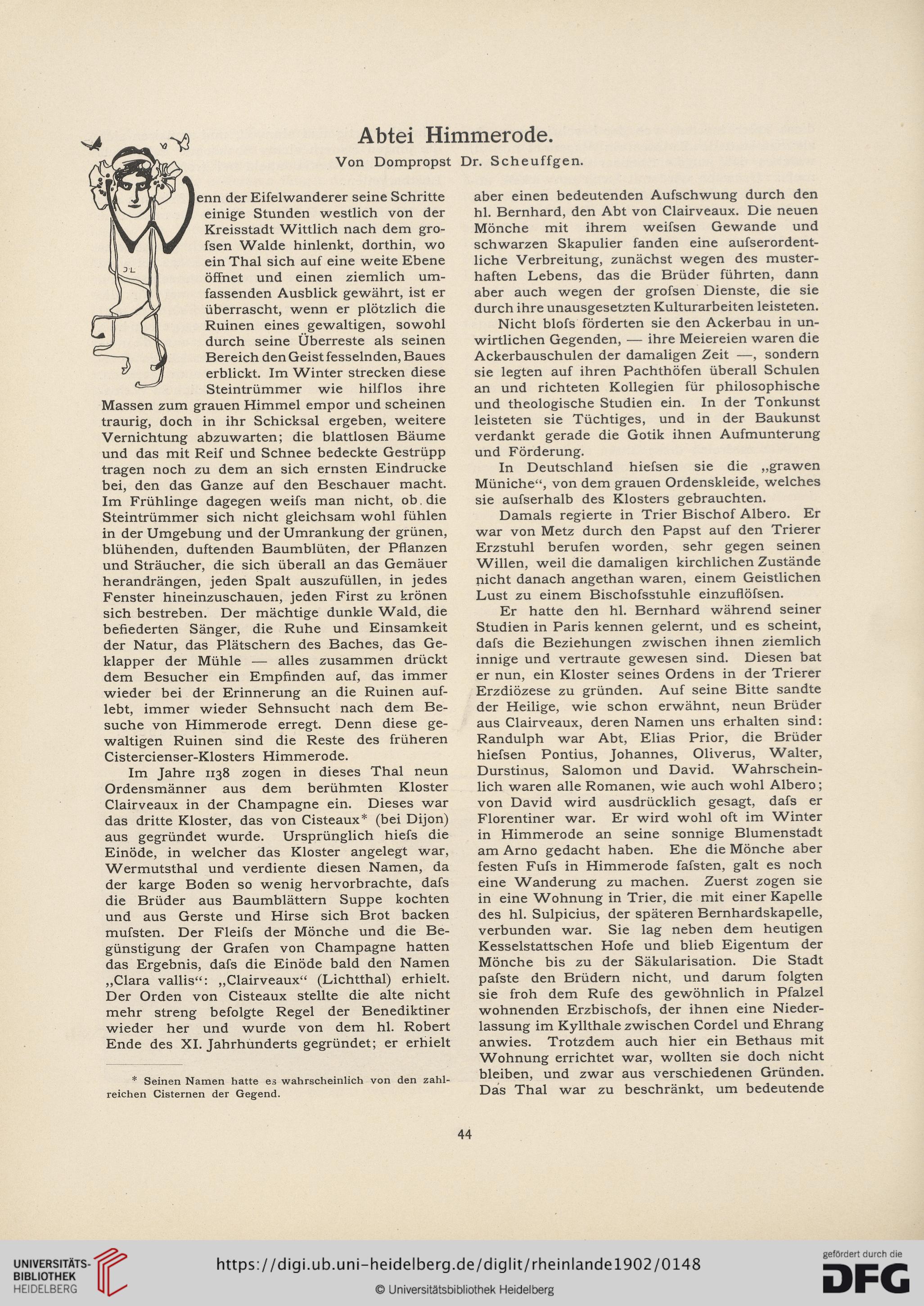Abtei Himmerode.
■ *
Von Dompropst
*JuT^JjitLZ |enn der Eifelwanderer seine Schritte
V—f einige Stunden westlich von der
\ ZX X Kreisstadt Wittlich nach dem gro-
▼ (F fsen Walde hinlenkt, dorthin, wo
( I R ein Thal sich auf eine weite Ebene
öffnet und einen ziemlich um-
j) JH fassenden Ausblick gewährt, ist er
überrascht, wenn er plötzlich die
y O Ruinen eines gewaltigen, sowohl
_) Irs. durch seine Überreste als seinen
i y Bereich den Geist fesselnden, Baues
j erblickt. Im Winter strecken diese
Steintrümmer wie hilflos ihre
Massen zum grauen Himmel empor und scheinen
traurig, doch in ihr Schicksal ergeben, weitere
Vernichtung abzuwarten; die blattlosen Bäume
und das mit Reif und Schnee bedeckte Gestrüpp
tragen noch zu dem an sich ernsten Eindrücke
bei, den das Ganze auf den Beschauer macht.
Im Frühlinge dagegen weifs man nicht, ob. die
Steintrümmer sich nicht gleichsam wohl fühlen
in der Umgebung und der Umrankung der grünen,
blühenden, duftenden Baumblüten, der Pflanzen
und Sträucher, die sich überall an das Gemäuer
herandrängen, jeden Spalt auszufüllen, in jedes
Fenster hineinzuschauen, jeden First zu krönen
sich bestreben. Der mächtige dunkle Wald, die
befiederten Sänger, die Ruhe und Einsamkeit
der Natur, das Plätschern des Baches, das Ge-
klapper der Mühle — alles zusammen drückt
dem Besucher ein Empfinden auf, das immer
wieder bei der Erinnerung an die Ruinen auf-
lebt, immer wieder Sehnsucht nach dem Be-
suche von Himmerode erregt. Denn diese ge-
waltigen Ruinen sind die Reste des früheren
Cistercienser-Klosters Himmerode.
Im Jahre 1138 zogen in dieses Thal neun
Ordensmänner aus dem berühmten Kloster
Clairveaux in der Champagne ein. Dieses war
das dritte Kloster, das von Cisteaux* (bei Dijon)
aus gegründet wurde. Ursprünglich hiefs die
Einöde, in welcher das Kloster angelegt war,
Wermutsthal und verdiente diesen Namen, da
der karge Boden so wenig hervorbrachte, dafs
die Brüder aus Baumblättern Suppe kochten
und aus Gerste und Hirse sich Brot backen
mufsten. Der Fleifs der Mönche und die Be-
günstigung der Grafen von Champagne hatten
das Ergebnis, dafs die Einöde bald den Namen
„Clara vallis“: „Clairveaux“ (Lichtthal) erhielt.
Der Orden von Cisteaux stellte die alte nicht
mehr streng befolgte Regel der Benediktiner
wieder her und wurde von dem hl. Robert
Ende des XI. Jahrhunderts gegründet; er erhielt
* Seinen Namen hatte es wahrscheinlich von den zahl-
reichen Cisternen der Gegend.
Dr. Scheuffgen.
aber einen bedeutenden Aufschwung durch den
hl. Bernhard, den Abt von Clairveaux. Die neuen
Mönche mit ihrem weifsen Gewände und
schwarzen Skapulier fanden eine aufserordent-
liche Verbreitung, zunächst wegen des muster-
haften Lebens, das die Brüder führten, dann
aber auch wegen der grofsen Dienste, die sie
durch ihre unausgesetzten Kulturarbeiten leisteten.
Nicht blofs förderten sie den Ackerbau in un-
wirtlichen Gegenden, — ihre Meiereien waren die
Ackerbauschulen der damaligen Zeit —, sondern
sie legten auf ihren Pachthöfen überall Schulen
an und richteten Kollegien für philosophische
und theologische Studien ein. In der Tonkunst
leisteten sie Tüchtiges, und in der Baukunst
verdankt gerade die Gotik ihnen Aufmunterung
und Förderung.
In Deutschland hiefsen sie die „grawen
Müniche“, von dem grauen Ordenskleide, welches
sie aufserhalb des Klosters gebrauchten.
Damals regierte in Trier Bischof Albero. Er
war von Metz durch den Papst auf den Trierer
Erzstuhl berufen worden, sehr gegen seinen
Willen, weil die damaligen kirchlichen Zustände
nicht danach angethan waren, einem Geistlichen
Lust zu einem Bischofsstuhle einzuflöfsen.
Er hatte den hl. Bernhard während seiner
Studien in Paris kennen gelernt, und es scheint,
dafs die Beziehungen zwischen ihnen ziemlich
innige und vertraute gewesen sind. Diesen bat
er nun, ein Kloster seines Ordens in der Trierer
Erzdiözese zu gründen. Auf seine Bitte sandte
der Heilige, wie schon erwähnt, neun Brüder
aus Clairveaux, deren Namen uns erhalten sind:
Randulph war Abt, Elias Prior, die Brüder
hiefsen Pontius, Johannes, Oliverus, Walter,
Durstinus, Salomon und David. Wahrschein-
lich waren alle Romanen, wie auch wohl Albero;
von David wird ausdrücklich gesagt, dafs er
Florentiner war. Er wird wohl oft im Winter
in Himmerode an seine sonnige Blumenstadt
am Arno gedacht haben. Ehe die Mönche aber
festen Fufs in Himmerode fafsten, galt es noch
eine Wanderung zu machen. Zuerst zogen sie
in eine Wohnung in Trier, die mit einer Kapelle
des hl. Sulpicius, der späteren Bernhardskapelle,
verbunden war. Sie lag neben dem heutigen
Kesselstattschen Hofe und blieb Eigentum der
Mönche bis zu der Säkularisation. Die Stadt
pafste den Brüdern nicht, und darum folgten
sie froh dem Rufe des gewöhnlich in Pfalzel
wohnenden Erzbischofs, der ihnen eine Nieder-
lassung im Kyllthale zwischen Cordei und Ehrang
anwies. Trotzdem auch hier ein Bethaus mit
Wohnung errichtet war, wollten sie doch nicht
bleiben, und zwar aus verschiedenen Gründen.
Das Thal war zu beschränkt, um bedeutende
44
■ *
Von Dompropst
*JuT^JjitLZ |enn der Eifelwanderer seine Schritte
V—f einige Stunden westlich von der
\ ZX X Kreisstadt Wittlich nach dem gro-
▼ (F fsen Walde hinlenkt, dorthin, wo
( I R ein Thal sich auf eine weite Ebene
öffnet und einen ziemlich um-
j) JH fassenden Ausblick gewährt, ist er
überrascht, wenn er plötzlich die
y O Ruinen eines gewaltigen, sowohl
_) Irs. durch seine Überreste als seinen
i y Bereich den Geist fesselnden, Baues
j erblickt. Im Winter strecken diese
Steintrümmer wie hilflos ihre
Massen zum grauen Himmel empor und scheinen
traurig, doch in ihr Schicksal ergeben, weitere
Vernichtung abzuwarten; die blattlosen Bäume
und das mit Reif und Schnee bedeckte Gestrüpp
tragen noch zu dem an sich ernsten Eindrücke
bei, den das Ganze auf den Beschauer macht.
Im Frühlinge dagegen weifs man nicht, ob. die
Steintrümmer sich nicht gleichsam wohl fühlen
in der Umgebung und der Umrankung der grünen,
blühenden, duftenden Baumblüten, der Pflanzen
und Sträucher, die sich überall an das Gemäuer
herandrängen, jeden Spalt auszufüllen, in jedes
Fenster hineinzuschauen, jeden First zu krönen
sich bestreben. Der mächtige dunkle Wald, die
befiederten Sänger, die Ruhe und Einsamkeit
der Natur, das Plätschern des Baches, das Ge-
klapper der Mühle — alles zusammen drückt
dem Besucher ein Empfinden auf, das immer
wieder bei der Erinnerung an die Ruinen auf-
lebt, immer wieder Sehnsucht nach dem Be-
suche von Himmerode erregt. Denn diese ge-
waltigen Ruinen sind die Reste des früheren
Cistercienser-Klosters Himmerode.
Im Jahre 1138 zogen in dieses Thal neun
Ordensmänner aus dem berühmten Kloster
Clairveaux in der Champagne ein. Dieses war
das dritte Kloster, das von Cisteaux* (bei Dijon)
aus gegründet wurde. Ursprünglich hiefs die
Einöde, in welcher das Kloster angelegt war,
Wermutsthal und verdiente diesen Namen, da
der karge Boden so wenig hervorbrachte, dafs
die Brüder aus Baumblättern Suppe kochten
und aus Gerste und Hirse sich Brot backen
mufsten. Der Fleifs der Mönche und die Be-
günstigung der Grafen von Champagne hatten
das Ergebnis, dafs die Einöde bald den Namen
„Clara vallis“: „Clairveaux“ (Lichtthal) erhielt.
Der Orden von Cisteaux stellte die alte nicht
mehr streng befolgte Regel der Benediktiner
wieder her und wurde von dem hl. Robert
Ende des XI. Jahrhunderts gegründet; er erhielt
* Seinen Namen hatte es wahrscheinlich von den zahl-
reichen Cisternen der Gegend.
Dr. Scheuffgen.
aber einen bedeutenden Aufschwung durch den
hl. Bernhard, den Abt von Clairveaux. Die neuen
Mönche mit ihrem weifsen Gewände und
schwarzen Skapulier fanden eine aufserordent-
liche Verbreitung, zunächst wegen des muster-
haften Lebens, das die Brüder führten, dann
aber auch wegen der grofsen Dienste, die sie
durch ihre unausgesetzten Kulturarbeiten leisteten.
Nicht blofs förderten sie den Ackerbau in un-
wirtlichen Gegenden, — ihre Meiereien waren die
Ackerbauschulen der damaligen Zeit —, sondern
sie legten auf ihren Pachthöfen überall Schulen
an und richteten Kollegien für philosophische
und theologische Studien ein. In der Tonkunst
leisteten sie Tüchtiges, und in der Baukunst
verdankt gerade die Gotik ihnen Aufmunterung
und Förderung.
In Deutschland hiefsen sie die „grawen
Müniche“, von dem grauen Ordenskleide, welches
sie aufserhalb des Klosters gebrauchten.
Damals regierte in Trier Bischof Albero. Er
war von Metz durch den Papst auf den Trierer
Erzstuhl berufen worden, sehr gegen seinen
Willen, weil die damaligen kirchlichen Zustände
nicht danach angethan waren, einem Geistlichen
Lust zu einem Bischofsstuhle einzuflöfsen.
Er hatte den hl. Bernhard während seiner
Studien in Paris kennen gelernt, und es scheint,
dafs die Beziehungen zwischen ihnen ziemlich
innige und vertraute gewesen sind. Diesen bat
er nun, ein Kloster seines Ordens in der Trierer
Erzdiözese zu gründen. Auf seine Bitte sandte
der Heilige, wie schon erwähnt, neun Brüder
aus Clairveaux, deren Namen uns erhalten sind:
Randulph war Abt, Elias Prior, die Brüder
hiefsen Pontius, Johannes, Oliverus, Walter,
Durstinus, Salomon und David. Wahrschein-
lich waren alle Romanen, wie auch wohl Albero;
von David wird ausdrücklich gesagt, dafs er
Florentiner war. Er wird wohl oft im Winter
in Himmerode an seine sonnige Blumenstadt
am Arno gedacht haben. Ehe die Mönche aber
festen Fufs in Himmerode fafsten, galt es noch
eine Wanderung zu machen. Zuerst zogen sie
in eine Wohnung in Trier, die mit einer Kapelle
des hl. Sulpicius, der späteren Bernhardskapelle,
verbunden war. Sie lag neben dem heutigen
Kesselstattschen Hofe und blieb Eigentum der
Mönche bis zu der Säkularisation. Die Stadt
pafste den Brüdern nicht, und darum folgten
sie froh dem Rufe des gewöhnlich in Pfalzel
wohnenden Erzbischofs, der ihnen eine Nieder-
lassung im Kyllthale zwischen Cordei und Ehrang
anwies. Trotzdem auch hier ein Bethaus mit
Wohnung errichtet war, wollten sie doch nicht
bleiben, und zwar aus verschiedenen Gründen.
Das Thal war zu beschränkt, um bedeutende
44