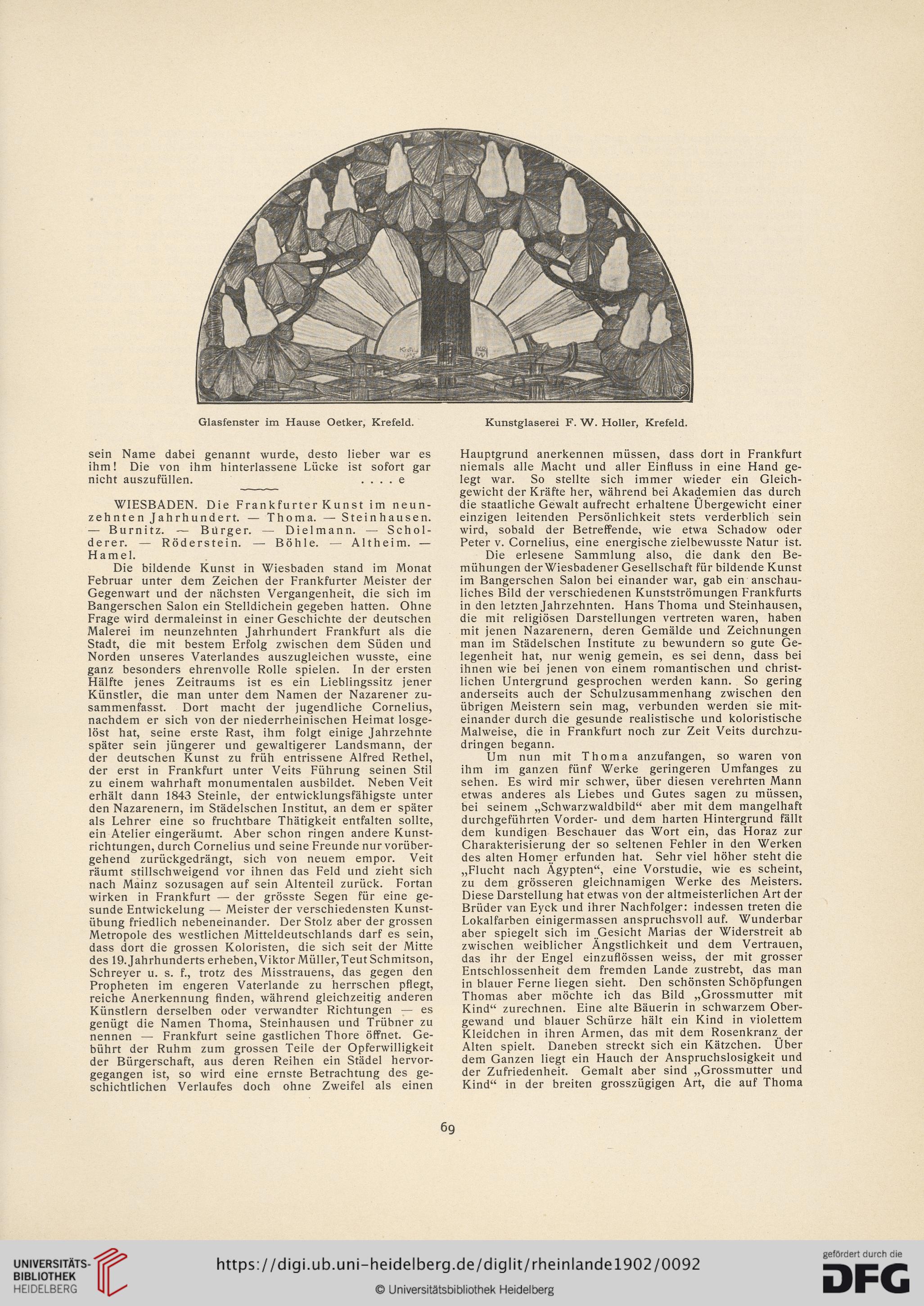Glasfenster im Hause Oetker, Krefeld,
sein Name dabei genannt wurde, desto lieber war es
ihm! Die von ihm hinterlassene Lücke ist sofort gar
nicht auszufüllen. . ... e
WIESBADEN. Die Frankfurter Kunst im neun-
zehnten Jahrhundert. — Thoma. — Steinhausen.
— Burnitz. — Bürger. — Dielmann. — Schol-
derer. — Röderstein. — Bohle. — Altheim. —
Hamel.
Die bildende Kunst in Wiesbaden stand im Monat
Februar unter dem Zeichen der Frankfurter Meister der
Gegenwart und der nächsten Vergangenheit, die sich im
Bangerschen Salon ein Stelldichein gegeben hatten. Ohne
Frage wird dermaleinst in einer Geschichte der deutschen
Malerei im neunzehnten Jahrhundert Frankfurt als die
Stadt, die mit bestem Erfolg zwischen dem Süden und
Norden unseres Vaterlandes auszugleichen wusste, eine
ganz besonders ehrenvolle Rolle spielen. In der ersten
Hälfte jenes Zeitraums ist es ein Lieblingssitz jener
Künstler, die man unter dem Namen der Nazarener zu-
sammenfasst. Dort macht der jugendliche Cornelius,
nachdem er sich von der niederrheinischen Heimat losge-
löst hat, seine erste Rast, ihm folgt einige Jahrzehnte
später sein jüngerer und gewaltigerer Landsmann, der
der deutschen Kunst zu früh entrissene Alfred Rethel,
der erst in Frankfurt unter Veits Führung seinen Stil
zu einem wahrhaft monumentalen ausbildet. Neben Veit
erhält dann 1843 Steinle, der entwicklungsfähigste unter
den Nazarenern, im Städelschen Institut, an dem er später
als Lehrer eine so fruchtbare Thätigkeit entfalten sollte,
ein Atelier eingeräumt. Aber schon ringen andere Kunst-
richtungen, durch Cornelius und seine Freunde nur vorüber-
gehend zurückgedrängt, sich von neuem empor. Veit
räumt stillschweigend vor ihnen das Feld und zieht sich
nach Mainz sozusagen auf sein Altenteil zurück. Fortan
wirken in Frankfurt — der grösste Segen für eine ge-
sunde Entwickelung — Meister der verschiedensten Kunst-
übung friedlich nebeneinander. Der Stolz aber der grossen
Metropole des westlichen Mitteldeutschlands darf es sein,
dass dort die grossen Koloristen, die sich seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts erheben, Viktor Müller,Teut Schmitson,
Schreyer u. s. f., trotz des Misstrauens, das gegen den
Propheten im engeren Vaterlande zu herrschen pflegt,
reiche Anerkennung finden, während gleichzeitig anderen
Künstlern derselben oder verwandter Richtungen — es
genügt die Namen Thoma, Steinhausen und Trübner zu
nennen — Frankfurt seine gastlichen Thore öffnet. Ge-
bührt der Ruhm zum grossen Teile der Opferwilligkeit
der Bürgerschaft, aus deren Reihen ein Städel hervor-
gegangen ist, so wird eine ernste Betrachtung des ge-
schichtlichen Verlaufes doch ohne Zweifel als einen
Kunstglaserei F. W. Holler, Krefeld.
Hauptgrund anerkennen müssen, dass dort in Frankfurt
niemals alle Macht und aller Einfluss in eine Hand ge-
legt war. So stellte sich immer wieder ein Gleich-
gewicht der Kräfte her, während bei Akademien das durch
die staatliche Gewalt aufrecht erhaltene Übergewicht einer
einzigen leitenden Persönlichkeit stets verderblich sein
wird, sobald der Betreffende, wie etwa Schadow oder
Peter v. Cornelius, eine energische zielbewusste Natur ist.
Die erlesene Sammlung also, die dank den Be-
mühungen der Wiesbadener Gesellschaft für bildende Kunst
im Bangerschen Salon bei einander war, gab ein anschau-
liches Bild der verschiedenen Kunstströmungen Frankfurts
in den letzten Jahrzehnten. Hans Thoma und Steinhausen,
die mit religiösen Darstellungen vertreten waren, haben
mit jenen Nazarenern, deren Gemälde und Zeichnungen
man im Städelschen Institute zu bewundern so gute Ge-
legenheit hat, nur wenig gemein, es sei denn, dass bei
ihnen wie bei jenen von einem romantischen und christ-
lichen Untergrund gesprochen werden kann. So gering
anderseits auch der Schulzusammenhang zwischen den
übrigen Meistern sein mag, verbunden werden sie mit-
einander durch die gesunde realistische und koloristische
Malweise, die in Frankfurt noch zur Zeit Veits durchzu-
dringen begann.
Um nun mit Thoma anzufangen, so waren von
ihm im ganzen fünf Werke geringeren Umfanges zu
sehen. Es wird mir schwer, über diesen verehrten Mann
etwas anderes als Liebes und Gutes sagen zu müssen,
bei seinem „Schwarzwaldbild“ aber mit dem mangelhaft
durchgeführten Vorder- und dem harten Hintergrund fällt
dem kundigen Beschauer das Wort ein, das Horaz zur
Charakterisierung der so seltenen Fehler in den Werken
des alten Homer erfunden hat. Sehr viel höher steht die
„Flucht nach Ägypten“, eine Vorstudie, wie es scheint,
zu dem grösseren gleichnamigen Werke des Meisters.
Diese Darstellung hat etwas von der altmeisterlichen Art der
Brüder van Eyck und ihrer Nachfolger: indessen treten die
Lokalfarben einigermassen anspruchsvoll auf. Wunderbar
aber spiegelt sich im Gesicht Marias der Widerstreit ab
zwischen weiblicher Ängstlichkeit und dem Vertrauen,
das ihr der Engel einzuflössen weiss, der mit grosser
Entschlossenheit dem fremden Lande zustrebt, das man
in blauer Ferne liegen sieht. Den schönsten Schöpfungen
Thomas aber möchte ich das Bild „Grossmutter mit
Kind“ zurechnen. Eine alte Bäuerin in schwarzem Ober-
gewand und blauer Schürze hält ein Kind in violettem
Kleidchen in ihren Armen, das mit dem Rosenkranz der
Alten spielt. Daneben streckt sich ein Kätzchen. Über
dem Ganzen liegt ein Hauch der Anspruchslosigkeit und
der Zufriedenheit. Gemalt aber sind „Grossmutter und
Kind“ in der breiten grosszügigen Art, die auf Thoma
69