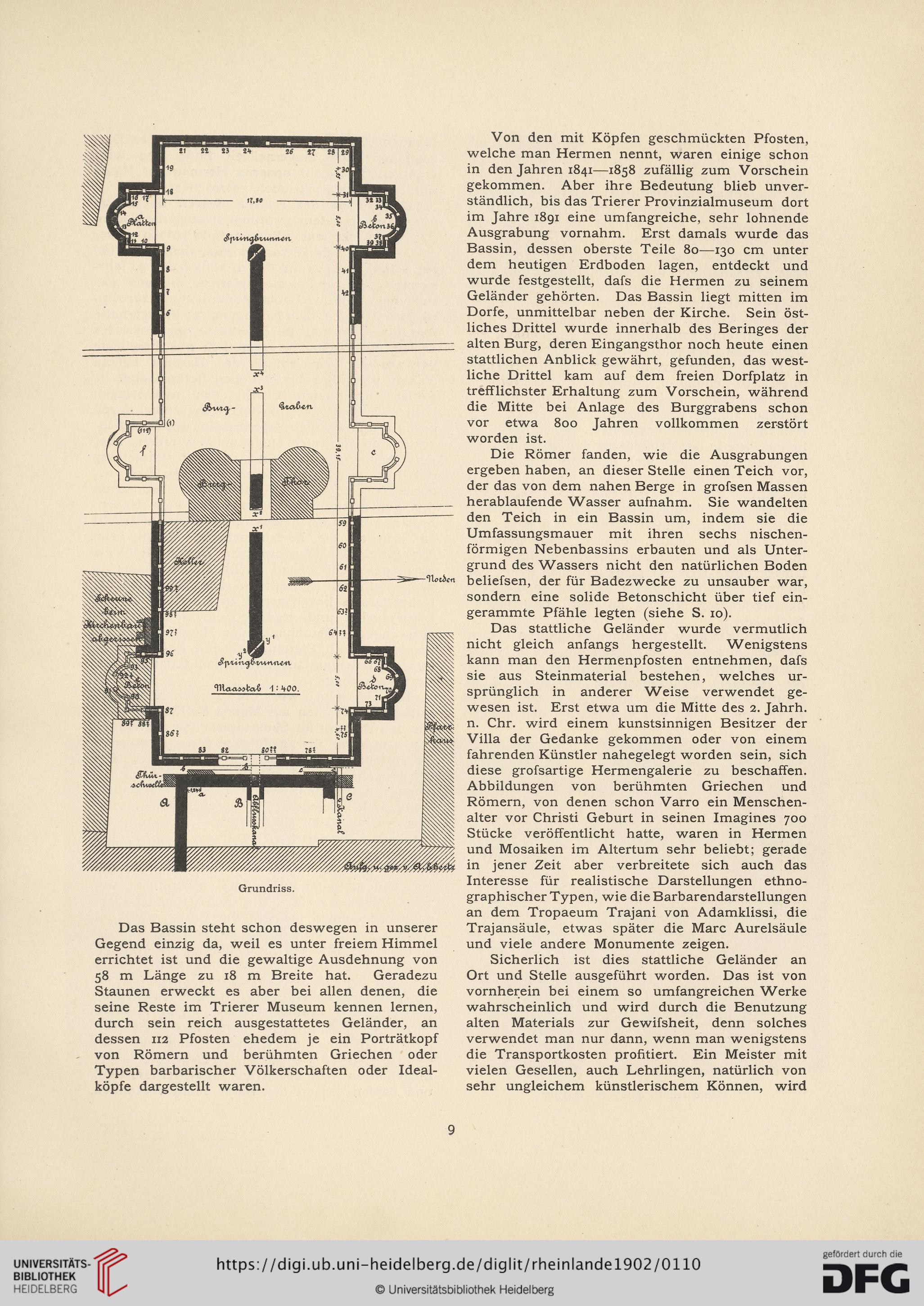Grundriss.
Das Bassin steht schon deswegen in unserer
Gegend einzig da, weil es unter freiem Himmel
errichtet ist und die gewaltige Ausdehnung von
58 m Länge zu 18 m Breite hat. Geradezu
Staunen erweckt es aber bei allen denen, die
seine Reste im Trierer Museum kennen lernen,
durch sein reich ausgestattetes Geländer, an
dessen 112 Pfosten ehedem je ein Porträtkopf
von Römern und berühmten Griechen oder
Typen barbarischer Völkerschaften oder Ideal-
köpfe dargestellt waren.
Von den mit Köpfen geschmückten Pfosten,
welche man Hermen nennt, waren einige schon
in den Jahren 1841—1858 zufällig zum Vorschein
gekommen. Aber ihre Bedeutung blieb unver-
ständlich, bis das Trierer Provinzialmuseum dort
im Jahre 1891 eine umfangreiche, sehr lohnende
Ausgrabung vornahm. Erst damals wurde das
Bassin, dessen oberste Teile 80—130 cm unter
dem heutigen Erdboden lagen, entdeckt und
wurde festgestellt, dafs die Hermen zu seinem
Geländer gehörten. Das Bassin liegt mitten im
Dorfe, unmittelbar neben der Kirche. Sein öst-
liches Drittel wurde innerhalb des Beringes der
alten Burg, deren Eingangsthor noch heute einen
stattlichen Anblick gewährt, gefunden, das west-
liche Drittel kam auf dem freien Dorfplatz in
trefflichster Erhaltung zum Vorschein, während
die Mitte bei Anlage des Burggrabens schon
vor etwa 800 Jahren vollkommen zerstört
worden ist.
Die Römer fanden, wie die Ausgrabungen
ergeben haben, an dieser Stelle einen Teich vor,
der das von dem nahen Berge in grofsen Massen
herablaufende Wasser aufnahm. Sie wandelten
den Teich in ein Bassin um, indem sie die
Umfassungsmauer mit ihren sechs nischen-
förmigen Nebenbassins erbauten und als Unter-
grund des Wassers nicht den natürlichen Boden
beliefsen, der für Badezwecke zu unsauber war,
sondern eine solide Betonschicht über tief ein-
gerammte Pfähle legten (siehe S. 10).
Das stattliche Geländer wurde vermutlich
nicht gleich anfangs hergestellt. Wenigstens
kann man den Hermenpfosten entnehmen, dafs
sie aus Steinmaterial bestehen, welches ur-
sprünglich in anderer Weise verwendet ge-
wesen ist. Erst etwa um die Mitte des 2. Jahrh.
n. Chr. wird einem kunstsinnigen Besitzer der
Villa der Gedanke gekommen oder von einem
fahrenden Künstler nahegelegt worden sein, sich
diese grofsartige Hermengalerie zu beschaffen.
Abbildungen von berühmten Griechen und
Römern, von denen schon Varro ein Menschen-
alter vor Christi Geburt in seinen Imagines 700
Stücke veröffentlicht hatte, waren in Hermen
und Mosaiken im Altertum sehr beliebt; gerade
in jener Zeit aber verbreitete sich auch das
Interesse für realistische Darstellungen ethno-
graphischer Typen, wie die Barbarendarstellungen
an dem Tropaeum Trajani von Adamklissi, die
Trajansäule, etwas später die Marc Aurelsäule
und viele andere Monumente zeigen.
Sicherlich ist dies stattliche Geländer an
Ort und Stelle ausgeführt worden. Das ist von
vornherein bei einem so umfangreichen Werke
wahrscheinlich und wird durch die Benutzung
alten Materials zur Gewifsheit, denn solches
verwendet man nur dann, wenn man wenigstens
die Transportkosten profitiert. Ein Meister mit
vielen Gesellen, auch Lehrlingen, natürlich von
sehr ungleichem künstlerischem Können, wird
9
Das Bassin steht schon deswegen in unserer
Gegend einzig da, weil es unter freiem Himmel
errichtet ist und die gewaltige Ausdehnung von
58 m Länge zu 18 m Breite hat. Geradezu
Staunen erweckt es aber bei allen denen, die
seine Reste im Trierer Museum kennen lernen,
durch sein reich ausgestattetes Geländer, an
dessen 112 Pfosten ehedem je ein Porträtkopf
von Römern und berühmten Griechen oder
Typen barbarischer Völkerschaften oder Ideal-
köpfe dargestellt waren.
Von den mit Köpfen geschmückten Pfosten,
welche man Hermen nennt, waren einige schon
in den Jahren 1841—1858 zufällig zum Vorschein
gekommen. Aber ihre Bedeutung blieb unver-
ständlich, bis das Trierer Provinzialmuseum dort
im Jahre 1891 eine umfangreiche, sehr lohnende
Ausgrabung vornahm. Erst damals wurde das
Bassin, dessen oberste Teile 80—130 cm unter
dem heutigen Erdboden lagen, entdeckt und
wurde festgestellt, dafs die Hermen zu seinem
Geländer gehörten. Das Bassin liegt mitten im
Dorfe, unmittelbar neben der Kirche. Sein öst-
liches Drittel wurde innerhalb des Beringes der
alten Burg, deren Eingangsthor noch heute einen
stattlichen Anblick gewährt, gefunden, das west-
liche Drittel kam auf dem freien Dorfplatz in
trefflichster Erhaltung zum Vorschein, während
die Mitte bei Anlage des Burggrabens schon
vor etwa 800 Jahren vollkommen zerstört
worden ist.
Die Römer fanden, wie die Ausgrabungen
ergeben haben, an dieser Stelle einen Teich vor,
der das von dem nahen Berge in grofsen Massen
herablaufende Wasser aufnahm. Sie wandelten
den Teich in ein Bassin um, indem sie die
Umfassungsmauer mit ihren sechs nischen-
förmigen Nebenbassins erbauten und als Unter-
grund des Wassers nicht den natürlichen Boden
beliefsen, der für Badezwecke zu unsauber war,
sondern eine solide Betonschicht über tief ein-
gerammte Pfähle legten (siehe S. 10).
Das stattliche Geländer wurde vermutlich
nicht gleich anfangs hergestellt. Wenigstens
kann man den Hermenpfosten entnehmen, dafs
sie aus Steinmaterial bestehen, welches ur-
sprünglich in anderer Weise verwendet ge-
wesen ist. Erst etwa um die Mitte des 2. Jahrh.
n. Chr. wird einem kunstsinnigen Besitzer der
Villa der Gedanke gekommen oder von einem
fahrenden Künstler nahegelegt worden sein, sich
diese grofsartige Hermengalerie zu beschaffen.
Abbildungen von berühmten Griechen und
Römern, von denen schon Varro ein Menschen-
alter vor Christi Geburt in seinen Imagines 700
Stücke veröffentlicht hatte, waren in Hermen
und Mosaiken im Altertum sehr beliebt; gerade
in jener Zeit aber verbreitete sich auch das
Interesse für realistische Darstellungen ethno-
graphischer Typen, wie die Barbarendarstellungen
an dem Tropaeum Trajani von Adamklissi, die
Trajansäule, etwas später die Marc Aurelsäule
und viele andere Monumente zeigen.
Sicherlich ist dies stattliche Geländer an
Ort und Stelle ausgeführt worden. Das ist von
vornherein bei einem so umfangreichen Werke
wahrscheinlich und wird durch die Benutzung
alten Materials zur Gewifsheit, denn solches
verwendet man nur dann, wenn man wenigstens
die Transportkosten profitiert. Ein Meister mit
vielen Gesellen, auch Lehrlingen, natürlich von
sehr ungleichem künstlerischem Können, wird
9