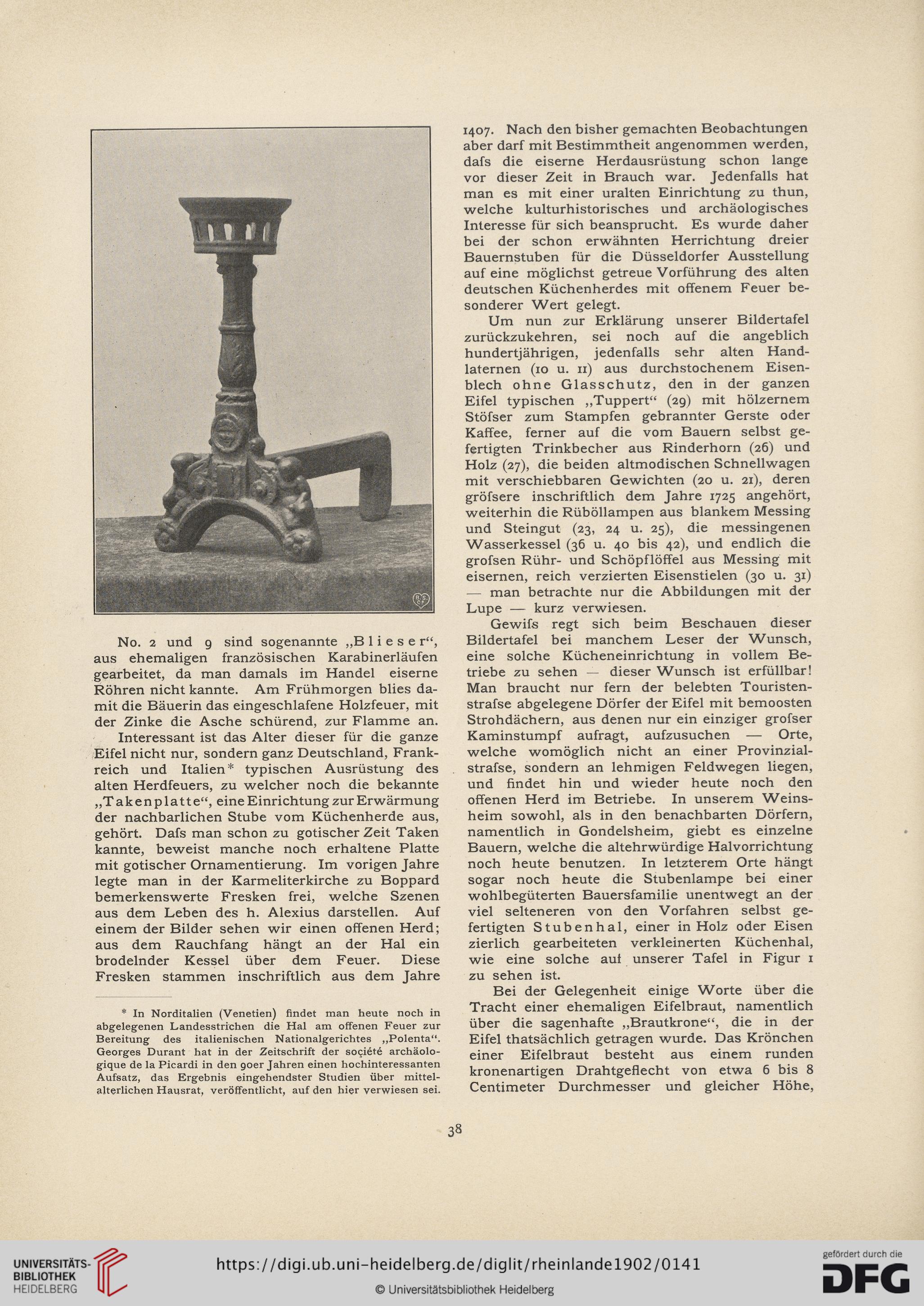No. 2 und 9 sind sogenannte „B 1 i e s e r“,
aus ehemaligen französischen Karabinerläufen
gearbeitet, da man damals im Handel eiserne
Röhren nicht kannte. Am Frühmorgen blies da-
mit die Bäuerin das eingeschlafene Holzfeuer, mit
der Zinke die Asche schürend, zur Flamme an.
Interessant ist das Alter dieser für die ganze
Eifel nicht nur, sondern ganz Deutschland, Frank-
reich und Italien* typischen Ausrüstung des
alten Herdfeuers, zu welcher noch die bekannte
„T a k e n p 1 a 11 e“, eine Einrichtung zur Erwärmung
der nachbarlichen Stube vom Küchenherde aus,
gehört. Dafs man schon zu gotischer Zeit Taken
kannte, beweist manche noch erhaltene Platte
mit gotischer Ornamentierung. Im vorigen Jahre
legte man in der Karmeliterkirche zu Boppard
bemerkenswerte Fresken frei, welche Szenen
aus dem Leben des h. Alexius darstellen. Auf
einem der Bilder sehen wir einen offenen Herd;
aus dem Rauchfang hängt an der Hal ein
brodelnder Kessel über dem Feuer. Diese
Fresken stammen inschriftlich aus dem Jahre
* In Norditalien (Venetien) findet man heute noch in
abgelegenen Landesstrichen die Hal am offenen Feuer zur
Bereitung des italienischen Nationalgerichtes „Polenta“.
Georges Durant hat in der Zeitschrift der soqiete archäolo-
gique de la Picardi in den goerJahren einen hochinteressanten
Aufsatz, das Ergebnis eingehendster Studien über mittel-
alterlichen Hausrat, veröffentlicht, auf den hier verwiesen sei.
1407. Nach den bisher gemachten Beobachtungen
aber darf mit Bestimmtheit angenommen werden,
dafs die eiserne Herdausrüstung schon lange
vor dieser Zeit in Brauch war. Jedenfalls hat
man es mit einer uralten Einrichtung zu thun,
welche kulturhistorisches und archäologisches
Interesse für sich beansprucht. Es wurde daher
bei der schon erwähnten Herrichtung dreier
Bauernstuben für die Düsseldorfer Ausstellung
auf eine möglichst getreue Vorführung des alten
deutschen Küchenherdes mit offenem Feuer be-
sonderer Wert gelegt.
Um nun zur Erklärung unserer Bildertafel
zurückzukehren, sei noch auf die angeblich
hundertjährigen, jedenfalls sehr alten Hand-
laternen (10 u. 11) aus durchstochenem Eisen-
blech ohne Glasschutz, den in der ganzen
Eifel typischen „Tuppert“ (29) mit hölzernem
Stöfser zum Stampfen gebrannter Gerste oder
Kaffee, ferner auf die vom Bauern selbst ge-
fertigten Trinkbecher aus Rinderhorn (26) und
Holz (27), die beiden altmodischen Schnellwagen
mit verschiebbaren Gewichten (20 u. 21), deren
gröfsere inschriftlich dem Jahre 1725 angehört,
weiterhin die Rüböllampen aus blankem Messing
und Steingut (23, 24 u. 25), die messingenen
Wasserkessel (36 u. 40 bis 42), und endlich die
grofsen Rühr- und Schöpflöffel aus Messing mit
eisernen, reich verzierten Eisenstielen (30 u. 31)
— man betrachte nur die Abbildungen mit der
Lupe — kurz verwiesen.
Gewifs regt sich beim Beschauen dieser
Bildertafel bei manchem Leser der Wunsch,
eine solche Kücheneinrichtung in vollem Be-
triebe zu sehen — dieser Wunsch ist erfüllbar!
Man braucht nur fern der belebten Touristen-
strafse abgelegene Dörfer der Eifel mit bemoosten
Strohdächern, aus denen nur ein einziger grofser
Kaminstumpf aufragt, aufzusuchen — Orte,
welche womöglich nicht an einer Provinzial-
strafse, sondern an lehmigen Feldwegen liegen,
und findet hin und wieder heute noch den
offenen Herd im Betriebe. In unserem Weins-
heim sowohl, als in den benachbarten Dörfern,
namentlich in Gondelsheim, giebt es einzelne
Bauern, welche die altehrwürdige Haivorrichtung
noch heute benutzen. In letzterem Orte hängt
sogar noch heute die Stubenlampe bei einer
wohlbegüterten Bauersfamilie unentwegt an der
viel selteneren von den Vorfahren selbst ge-
fertigten Stubenhai, einer in Holz oder Eisen
zierlich gearbeiteten verkleinerten Küchenhai,
wie eine solche auf unserer Tafel in Figur 1
zu sehen ist.
Bei der Gelegenheit einige Worte über die
Tracht einer ehemaligen Eifelbraut, namentlich
über die sagenhafte „Brautkrone“, die in der
Eifel thatsächlich getragen wurde. Das Krönchen
einer Eifelbraut besteht aus einem runden
kronenartigen Drahtgeflecht von etwa 6 bis 8
Centimeter Durchmesser und gleicher Höhe,
38