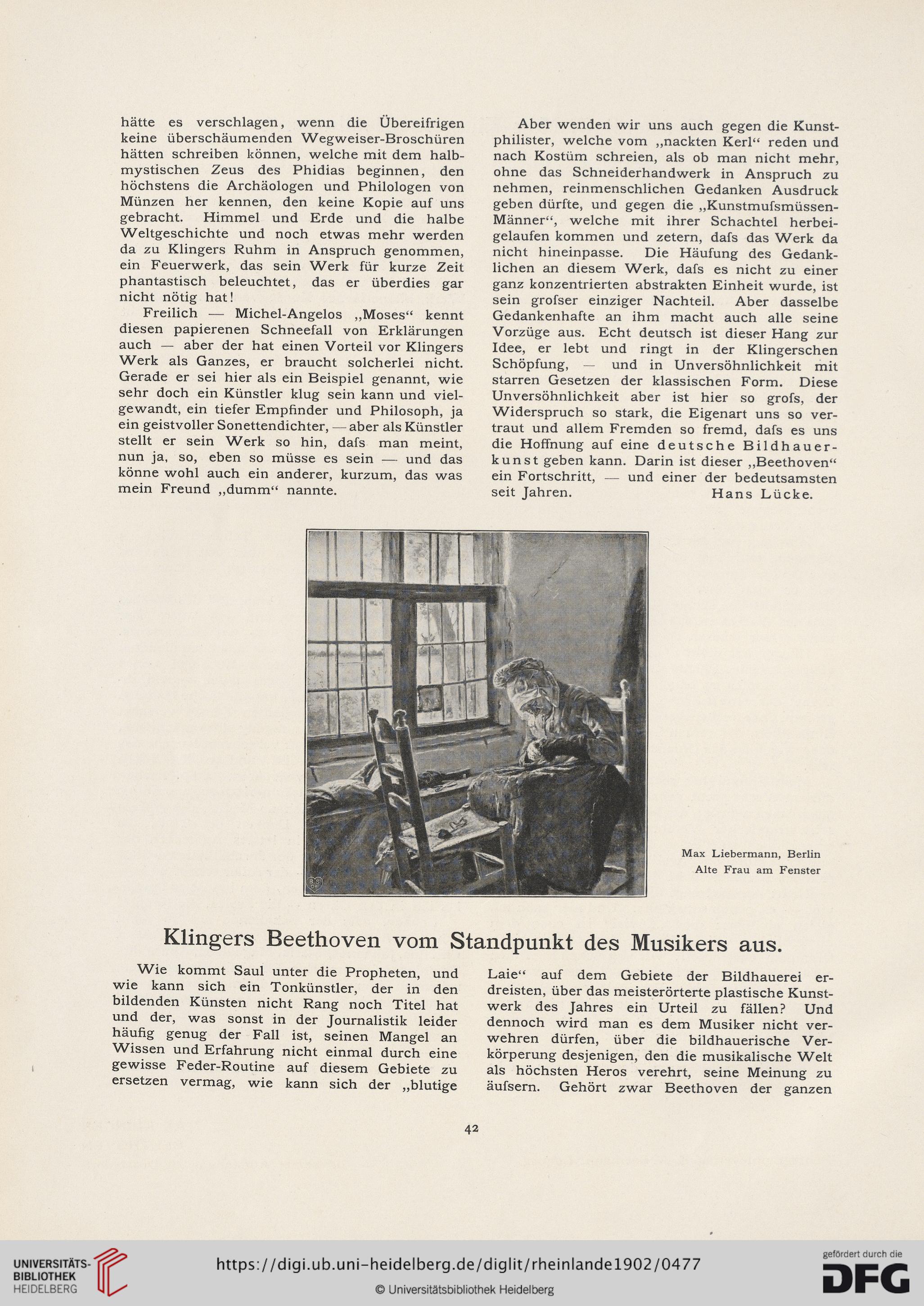hätte es verschlagen, wenn die Übereifrigen
keine überschäumenden Wegweiser-Broschüren
hätten schreiben können, welche mit dem halb-
mystischen Zeus des Phidias beginnen, den
höchstens die Archäologen und Philologen von
Münzen her kennen, den keine Kopie auf uns
gebracht. Himmel und Erde und die halbe
Weltgeschichte und noch etwas mehr werden
da zu Klingers Ruhm in Anspruch genommen,
ein Feuerwerk, das sein Werk für kurze Zeit
phantastisch beleuchtet, das er überdies gar
nicht nötig hat!
Freilich — Michel-Angelos „Moses“ kennt
diesen papierenen Schneefall von Erklärungen
auch — aber der hat einen Vorteil vor Klingers
Werk als Ganzes, er braucht solcherlei nicht.
Gerade er sei hier als ein Beispiel genannt, wie
sehr doch ein Künstler klug sein kann und viel-
gewandt, ein tiefer Empfinder und Philosoph, ja
ein geistvoller Sonettendichter, —aber als Künstler
stellt er sein Werk so hin, dafs man meint,
nun ja, so, eben so müsse es sein — und das
könne wohl auch ein anderer, kurzum, das was
mein Freund „dumm“ nannte.
Aber wenden wir uns auch gegen die Kunst-
philister, welche vom „nackten Kerl“ reden und
nach Kostüm schreien, als ob man nicht mehr,
ohne das Schneiderhandwerk in Anspruch zu
nehmen, reinmenschlichen Gedanken Ausdruck
geben dürfte, und gegen die „Kunstmufsmüssen-
Männer“, welche mit ihrer Schachtel herbei-
gelaufen kommen und zetern, dafs das Werk da
nicht hineinpasse. Die Häufung des Gedank-
lichen an diesem Werk, dafs es nicht zu einer
ganz konzentrierten abstrakten Einheit wurde, ist
sein grofser einziger Nachteil. Aber dasselbe
Gedankenhafte an ihm macht auch alle seine
Vorzüge aus. Echt deutsch ist dieser Hang zur
Idee, er lebt und ringt in der Klingerschen
Schöpfung, — und in Unversöhnlichkeit mit
starren Gesetzen der klassischen Form. Diese
Unversöhnlichkeit aber ist hier so grofs, der
Widerspruch so stark, die Eigenart uns so ver-
traut und allem Fremden so fremd, dafs es uns
die Hoffnung auf eine deutsche Bildhauer-
kunst geben kann. Darin ist dieser „Beethoven“
ein Fortschritt, — und einer der bedeutsamsten
seit Jahren. Hans Lücke.
Max Liebermann, Berlin
Alte Frau am Fenster
Klingers Beethoven vom Standpunkt des Musikers aus.
Wie kommt Saul unter die Propheten, und
wie kann sich ein Tonkünstler, der in den
bildenden Künsten nicht Rang noch Titel hat
und der, was sonst in der Journalistik leider
häufig genug der Fall ist, seinen Mangel an
Wissen und Erfahrung nicht einmal durch eine
gewisse Feder-Routine auf diesem Gebiete zu
ersetzen vermag, wie kann sich der „blutige
Laie“ auf dem Gebiete der Bildhauerei er-
dreisten, über das meisterörterte plastische Kunst-
werk des Jahres ein Urteil zu fällen? Und
dennoch wird man es dem Musiker nicht ver-
wehren dürfen, über die bildhauerische Ver-
körperung desjenigen, den die musikalische Welt
als höchsten Heros verehrt, seine Meinung zu
äufsern. Gehört zwar Beethoven der ganzen
42
keine überschäumenden Wegweiser-Broschüren
hätten schreiben können, welche mit dem halb-
mystischen Zeus des Phidias beginnen, den
höchstens die Archäologen und Philologen von
Münzen her kennen, den keine Kopie auf uns
gebracht. Himmel und Erde und die halbe
Weltgeschichte und noch etwas mehr werden
da zu Klingers Ruhm in Anspruch genommen,
ein Feuerwerk, das sein Werk für kurze Zeit
phantastisch beleuchtet, das er überdies gar
nicht nötig hat!
Freilich — Michel-Angelos „Moses“ kennt
diesen papierenen Schneefall von Erklärungen
auch — aber der hat einen Vorteil vor Klingers
Werk als Ganzes, er braucht solcherlei nicht.
Gerade er sei hier als ein Beispiel genannt, wie
sehr doch ein Künstler klug sein kann und viel-
gewandt, ein tiefer Empfinder und Philosoph, ja
ein geistvoller Sonettendichter, —aber als Künstler
stellt er sein Werk so hin, dafs man meint,
nun ja, so, eben so müsse es sein — und das
könne wohl auch ein anderer, kurzum, das was
mein Freund „dumm“ nannte.
Aber wenden wir uns auch gegen die Kunst-
philister, welche vom „nackten Kerl“ reden und
nach Kostüm schreien, als ob man nicht mehr,
ohne das Schneiderhandwerk in Anspruch zu
nehmen, reinmenschlichen Gedanken Ausdruck
geben dürfte, und gegen die „Kunstmufsmüssen-
Männer“, welche mit ihrer Schachtel herbei-
gelaufen kommen und zetern, dafs das Werk da
nicht hineinpasse. Die Häufung des Gedank-
lichen an diesem Werk, dafs es nicht zu einer
ganz konzentrierten abstrakten Einheit wurde, ist
sein grofser einziger Nachteil. Aber dasselbe
Gedankenhafte an ihm macht auch alle seine
Vorzüge aus. Echt deutsch ist dieser Hang zur
Idee, er lebt und ringt in der Klingerschen
Schöpfung, — und in Unversöhnlichkeit mit
starren Gesetzen der klassischen Form. Diese
Unversöhnlichkeit aber ist hier so grofs, der
Widerspruch so stark, die Eigenart uns so ver-
traut und allem Fremden so fremd, dafs es uns
die Hoffnung auf eine deutsche Bildhauer-
kunst geben kann. Darin ist dieser „Beethoven“
ein Fortschritt, — und einer der bedeutsamsten
seit Jahren. Hans Lücke.
Max Liebermann, Berlin
Alte Frau am Fenster
Klingers Beethoven vom Standpunkt des Musikers aus.
Wie kommt Saul unter die Propheten, und
wie kann sich ein Tonkünstler, der in den
bildenden Künsten nicht Rang noch Titel hat
und der, was sonst in der Journalistik leider
häufig genug der Fall ist, seinen Mangel an
Wissen und Erfahrung nicht einmal durch eine
gewisse Feder-Routine auf diesem Gebiete zu
ersetzen vermag, wie kann sich der „blutige
Laie“ auf dem Gebiete der Bildhauerei er-
dreisten, über das meisterörterte plastische Kunst-
werk des Jahres ein Urteil zu fällen? Und
dennoch wird man es dem Musiker nicht ver-
wehren dürfen, über die bildhauerische Ver-
körperung desjenigen, den die musikalische Welt
als höchsten Heros verehrt, seine Meinung zu
äufsern. Gehört zwar Beethoven der ganzen
42