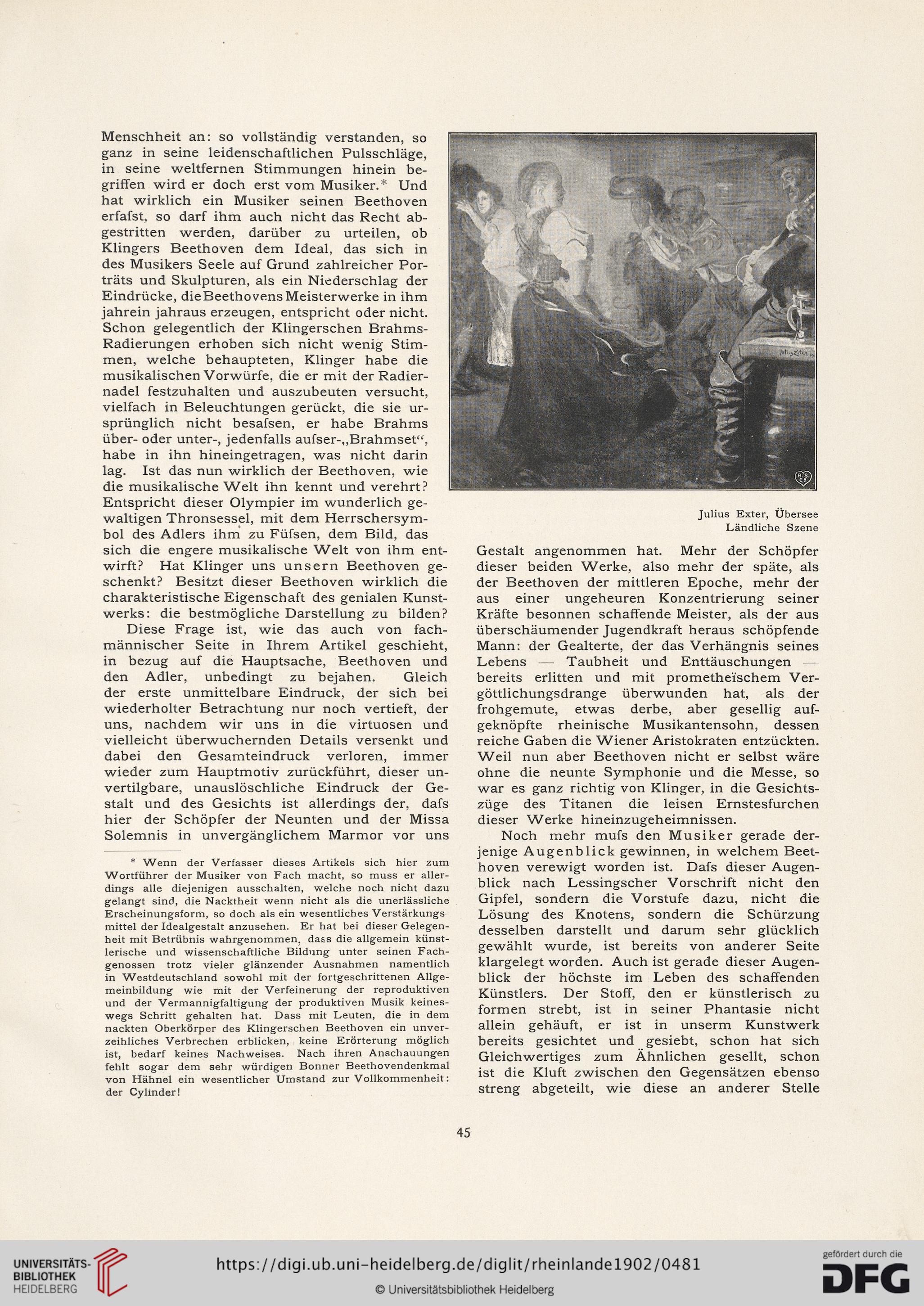Menschheit an: so vollständig verstanden, so
ganz in seine leidenschaftlichen Pulsschläge,
in seine weltfernen Stimmungen hinein be-
griffen wird er doch erst vom Musiker.* Und
hat wirklich ein Musiker seinen Beethoven
erfafst, so darf ihm auch nicht das Recht ab-
gestritten werden, darüber zu urteilen, ob
Klingers Beethoven dem Ideal, das sich in
des Musikers Seele auf Grund zahlreicher Por-
träts und Skulpturen, als ein Niederschlag der
Eindrücke, dieBeethovensMeisterwerke in ihm
jahrein jahraus erzeugen, entspricht oder nicht.
Schon gelegentlich der Klingerschen Brahms-
Radierungen erhoben sich nicht wenig Stim-
men, welche behaupteten, Klinger habe die
musikalischen Vorwürfe, die er mit der Radier-
nadel festzuhalten und auszubeuten versucht,
vielfach in Beleuchtungen gerückt, die sie ur-
sprünglich nicht besafsen, er habe Brahms
über- oder unter-, jedenfalls aufser-,,Brahmset“,
habe in ihn hineingetragen, was nicht darin
lag. Ist das nun wirklich der Beethoven, wie
die musikalische Welt ihn kennt und verehrt?
Entspricht dieser Olympier im wunderlich ge-
waltigen Thronsessel, mit dem Herrschersym-
bol des Adlers ihm zu Füfsen, dem Bild, das
sich die engere musikalische Welt von ihm ent-
wirft? Hat Klinger uns unsern Beethoven ge-
schenkt? Besitzt dieser Beethoven wirklich die
charakteristische Eigenschaft des genialen Kunst-
werks: die bestmögliche Darstellung zu bilden?
Diese Frage ist, wie das auch von fach-
männischer Seite in Ihrem Artikel geschieht,
in bezug auf die Hauptsache, Beethoven und
den Adler, unbedingt zu bejahen. Gleich
der erste unmittelbare Eindruck, der sich bei
wiederholter Betrachtung nur noch vertieft, der
uns, nachdem wir uns in die virtuosen und
vielleicht überwuchernden Details versenkt und
dabei den Gesamteindruck verloren, immer
wieder zum Hauptmotiv zurückführt, dieser un-
vertilgbare, unauslöschliche Eindruck der Ge-
stalt und des Gesichts ist allerdings der, dafs
hier der Schöpfer der Neunten und der Missa
Solemnis in unvergänglichem Marmor vor uns
* Wenn der Verfasser dieses Artikels sich hier zum
Wortführer der Musiker von Fach macht, so muss er aller-
dings alle diejenigen ausschalten, welche noch nicht dazu
gelangt sind, die Nacktheit wenn nicht als die unerlässliche
Erscheinungsform, so doch als ein wesentliches Verstärkungs
mittel der Idealgestalt anzusehen. Er hat bei dieser Gelegen-
heit mit Betrübnis wahrgenommen, dass die allgemein künst-
lerische und wissenschaftliche Bildung unter seinen Fach-
genossen trotz vieler glänzender Ausnahmen namentlich
in Westdeutschland sowohl mit der fortgeschrittenen Allge-
meinbildung wie mit der Verfeinerung der reproduktiven
und der Vermannigfaltigung der produktiven Musik keines-
wegs Schritt gehalten hat. Dass mit Leuten, die in dem
nackten Oberkörper des Klingerschen Beethoven ein unver-
zeihliches Verbrechen erblicken, keine Erörterung möglich
ist, bedarf keines Nachweises. Nach ihren Anschauungen
fehlt sogar dem sehr würdigen Bonner Beethovendenkmal
von Hähnel ein wesentlicher Umstand zur Vollkommenheit:
der Cylinder!
Julius Exter, Übersee
Ländliche Szene
Gestalt angenommen hat. Mehr der Schöpfer
dieser beiden Werke, also mehr der späte, als
der Beethoven der mittleren Epoche, mehr der
aus einer ungeheuren Konzentrierung seiner
Kräfte besonnen schaffende Meister, als der aus
überschäumender Jugendkraft heraus schöpfende
Mann: der Gealterte, der das Verhängnis seines
Lebens — Taubheit und Enttäuschungen —
bereits erlitten und mit prometheischem Ver-
göttlichungsdrange überwunden hat, als der
frohgemute, etwas derbe, aber gesellig auf-
geknöpfte rheinische Musikantensohn, dessen
reiche Gaben die Wiener Aristokraten entzückten.
Weil nun aber Beethoven nicht er selbst wäre
ohne die neunte Symphonie und die Messe, so
war es ganz richtig von Klinger, in die Gesichts-
züge des Titanen die leisen Ernstesfurchen
dieser Werke hineinzugeheimnissen.
Noch mehr mufs den Musiker gerade der-
jenige Augenblick gewinnen, in welchem Beet-
hoven verewigt worden ist. Dafs dieser Augen-
blick nach Lessingscher Vorschrift nicht den
Gipfel, sondern die Vorstufe dazu, nicht die
Lösung des Knotens, sondern die Schürzung
desselben darstellt und darum sehr glücklich
gewählt wurde, ist bereits von anderer Seite
klargelegt worden. Auch ist gerade dieser Augen-
blick der höchste im Leben des schaffenden
Künstlers. Der Stoff, den er künstlerisch zu
formen strebt, ist in seiner Phantasie nicht
allein gehäuft, er ist in unserm Kunstwerk
bereits gesichtet und gesiebt, schon hat sich
Gleichwertiges zum Ähnlichen gesellt, schon
ist die Kluft zwischen den Gegensätzen ebenso
streng abgeteilt, wie diese an anderer Stelle
45
ganz in seine leidenschaftlichen Pulsschläge,
in seine weltfernen Stimmungen hinein be-
griffen wird er doch erst vom Musiker.* Und
hat wirklich ein Musiker seinen Beethoven
erfafst, so darf ihm auch nicht das Recht ab-
gestritten werden, darüber zu urteilen, ob
Klingers Beethoven dem Ideal, das sich in
des Musikers Seele auf Grund zahlreicher Por-
träts und Skulpturen, als ein Niederschlag der
Eindrücke, dieBeethovensMeisterwerke in ihm
jahrein jahraus erzeugen, entspricht oder nicht.
Schon gelegentlich der Klingerschen Brahms-
Radierungen erhoben sich nicht wenig Stim-
men, welche behaupteten, Klinger habe die
musikalischen Vorwürfe, die er mit der Radier-
nadel festzuhalten und auszubeuten versucht,
vielfach in Beleuchtungen gerückt, die sie ur-
sprünglich nicht besafsen, er habe Brahms
über- oder unter-, jedenfalls aufser-,,Brahmset“,
habe in ihn hineingetragen, was nicht darin
lag. Ist das nun wirklich der Beethoven, wie
die musikalische Welt ihn kennt und verehrt?
Entspricht dieser Olympier im wunderlich ge-
waltigen Thronsessel, mit dem Herrschersym-
bol des Adlers ihm zu Füfsen, dem Bild, das
sich die engere musikalische Welt von ihm ent-
wirft? Hat Klinger uns unsern Beethoven ge-
schenkt? Besitzt dieser Beethoven wirklich die
charakteristische Eigenschaft des genialen Kunst-
werks: die bestmögliche Darstellung zu bilden?
Diese Frage ist, wie das auch von fach-
männischer Seite in Ihrem Artikel geschieht,
in bezug auf die Hauptsache, Beethoven und
den Adler, unbedingt zu bejahen. Gleich
der erste unmittelbare Eindruck, der sich bei
wiederholter Betrachtung nur noch vertieft, der
uns, nachdem wir uns in die virtuosen und
vielleicht überwuchernden Details versenkt und
dabei den Gesamteindruck verloren, immer
wieder zum Hauptmotiv zurückführt, dieser un-
vertilgbare, unauslöschliche Eindruck der Ge-
stalt und des Gesichts ist allerdings der, dafs
hier der Schöpfer der Neunten und der Missa
Solemnis in unvergänglichem Marmor vor uns
* Wenn der Verfasser dieses Artikels sich hier zum
Wortführer der Musiker von Fach macht, so muss er aller-
dings alle diejenigen ausschalten, welche noch nicht dazu
gelangt sind, die Nacktheit wenn nicht als die unerlässliche
Erscheinungsform, so doch als ein wesentliches Verstärkungs
mittel der Idealgestalt anzusehen. Er hat bei dieser Gelegen-
heit mit Betrübnis wahrgenommen, dass die allgemein künst-
lerische und wissenschaftliche Bildung unter seinen Fach-
genossen trotz vieler glänzender Ausnahmen namentlich
in Westdeutschland sowohl mit der fortgeschrittenen Allge-
meinbildung wie mit der Verfeinerung der reproduktiven
und der Vermannigfaltigung der produktiven Musik keines-
wegs Schritt gehalten hat. Dass mit Leuten, die in dem
nackten Oberkörper des Klingerschen Beethoven ein unver-
zeihliches Verbrechen erblicken, keine Erörterung möglich
ist, bedarf keines Nachweises. Nach ihren Anschauungen
fehlt sogar dem sehr würdigen Bonner Beethovendenkmal
von Hähnel ein wesentlicher Umstand zur Vollkommenheit:
der Cylinder!
Julius Exter, Übersee
Ländliche Szene
Gestalt angenommen hat. Mehr der Schöpfer
dieser beiden Werke, also mehr der späte, als
der Beethoven der mittleren Epoche, mehr der
aus einer ungeheuren Konzentrierung seiner
Kräfte besonnen schaffende Meister, als der aus
überschäumender Jugendkraft heraus schöpfende
Mann: der Gealterte, der das Verhängnis seines
Lebens — Taubheit und Enttäuschungen —
bereits erlitten und mit prometheischem Ver-
göttlichungsdrange überwunden hat, als der
frohgemute, etwas derbe, aber gesellig auf-
geknöpfte rheinische Musikantensohn, dessen
reiche Gaben die Wiener Aristokraten entzückten.
Weil nun aber Beethoven nicht er selbst wäre
ohne die neunte Symphonie und die Messe, so
war es ganz richtig von Klinger, in die Gesichts-
züge des Titanen die leisen Ernstesfurchen
dieser Werke hineinzugeheimnissen.
Noch mehr mufs den Musiker gerade der-
jenige Augenblick gewinnen, in welchem Beet-
hoven verewigt worden ist. Dafs dieser Augen-
blick nach Lessingscher Vorschrift nicht den
Gipfel, sondern die Vorstufe dazu, nicht die
Lösung des Knotens, sondern die Schürzung
desselben darstellt und darum sehr glücklich
gewählt wurde, ist bereits von anderer Seite
klargelegt worden. Auch ist gerade dieser Augen-
blick der höchste im Leben des schaffenden
Künstlers. Der Stoff, den er künstlerisch zu
formen strebt, ist in seiner Phantasie nicht
allein gehäuft, er ist in unserm Kunstwerk
bereits gesichtet und gesiebt, schon hat sich
Gleichwertiges zum Ähnlichen gesellt, schon
ist die Kluft zwischen den Gegensätzen ebenso
streng abgeteilt, wie diese an anderer Stelle
45