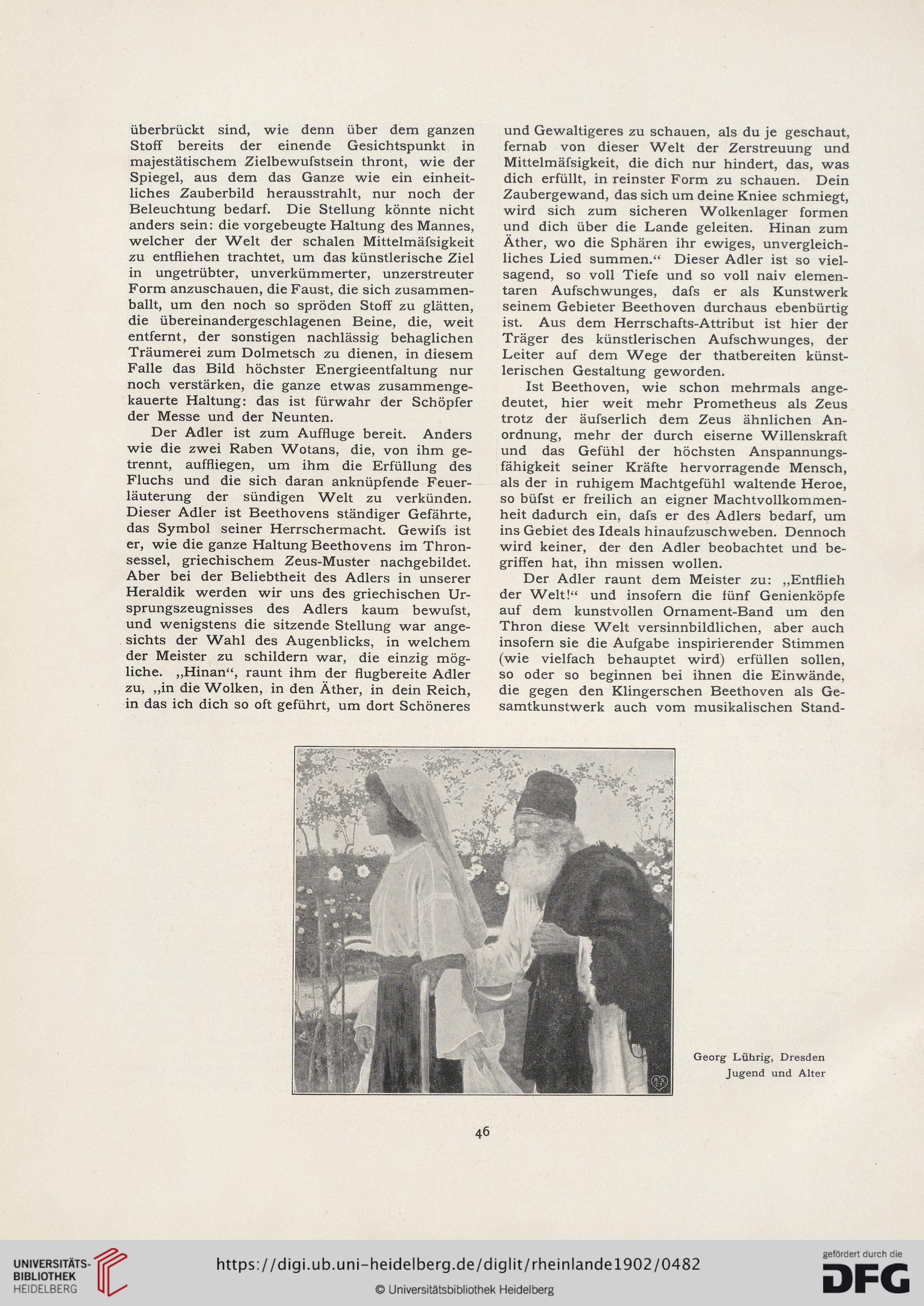überbrückt sind, wie denn über dem ganzen
Stoff bereits der einende Gesichtspunkt in
majestätischem Zielbewufstsein thront, wie der
Spiegel, aus dem das Ganze wie ein einheit-
liches Zauberbild herausstrahlt, nur noch der
Beleuchtung bedarf. Die Stellung könnte nicht
anders sein: die vorgebeugte Haltung des Mannes,
welcher der Welt der schalen Mittelmäfsigkeit
zu entfliehen trachtet, um das künstlerische Ziel
in ungetrübter, unverkümmerter, unzerstreuter
Form anzuschauen, die Faust, die sich zusammen-
ballt, um den noch so spröden Stoff zu glätten,
die übereinandergeschlagenen Beine, die, weit
entfernt, der sonstigen nachlässig behaglichen
Träumerei zum Dolmetsch zu dienen, in diesem
Falle das Bild höchster Energieentfaltung nur
noch verstärken, die ganze etwas zusammenge-
kauerte Haltung: das ist fürwahr der Schöpfer
der Messe und der Neunten.
Der Adler ist zum Auffluge bereit. Anders
wie die zwei Raben Wotans, die, von ihm ge-
trennt, auffliegen, um ihm die Erfüllung des
Fluchs und die sich daran anknüpfende Feuer-
läuterung der sündigen Welt zu verkünden.
Dieser Adler ist Beethovens ständiger Gefährte,
das Symbol seiner Herrschermacht. Gewifs ist
er, wie die ganze Haltung Beethovens im Thron-
sessel, griechischem Zeus-Muster nachgebildet.
Aber bei der Beliebtheit des Adlers in unserer
Heraldik werden wir uns des griechischen Ur-
sprungszeugnisses des Adlers kaum bewufst,
und wenigstens die sitzende Stellung war ange-
sichts der Wahl des Augenblicks, in welchem
der Meister zu schildern war, die einzig mög-
liche. „Hinan“, raunt ihm der flugbereite Adler
zu, „in die Wolken, in den Äther, in dein Reich,
in das ich dich so oft geführt, um dort Schöneres
und Gewaltigeres zu schauen, als du je geschaut,
fernab von dieser Welt der Zerstreuung und
Mittelmäfsigkeit, die dich nur hindert, das, was
dich erfüllt, in reinster Form zu schauen. Dein
Zaubergewand, das sich um deine Kniee schmiegt,
wird sich zum sicheren Wolkenlager formen
und dich über die Lande geleiten. Hinan zum
Äther, wo die Sphären ihr ewiges, unvergleich-
liches Lied summen.“ Dieser Adler ist so viel-
sagend, so voll Tiefe und so voll naiv elemen-
taren Aufschwunges, dafs er als Kunstwerk
seinem Gebieter Beethoven durchaus ebenbürtig
ist. Aus dem Herrschafts-Attribut ist hier der
Träger des künstlerischen Aufschwunges, der
Leiter auf dem Wege der thatbereiten künst-
lerischen Gestaltung geworden.
Ist Beethoven, wie schon mehrmals ange-
deutet, hier weit mehr Prometheus als Zeus
trotz der äufserlich dem Zeus ähnlichen An-
ordnung, mehr der durch eiserne Willenskraft
und das Gefühl der höchsten Anspannungs-
fähigkeit seiner Kräfte hervorragende Mensch,
als der in ruhigem Machtgefühl waltende Heroe,
so büfst er freilich an eigner Machtvollkommen-
heit dadurch ein, dafs er des Adlers bedarf, um
ins Gebiet des Ideals hinaufzuschweben. Dennoch
wird keiner, der den Adler beobachtet und be-
griffen hat, ihn missen wollen.
Der Adler raunt dem Meister zu: „Entflieh
der Welt!“ und insofern die fünf Genienköpfe
auf dem kunstvollen Ornament-Band um den
Thron diese Welt versinnbildlichen, aber auch
insofern sie die Aufgabe inspirierender Stimmen
(wie vielfach behauptet wird) erfüllen sollen,
so oder so beginnen bei ihnen die Einwände,
die gegen den Klingerschen Beethoven als Ge-
samtkunstwerk auch vom musikalischen Stand-
Georg Lührig, Dresden
Jugend und Alter
46
Stoff bereits der einende Gesichtspunkt in
majestätischem Zielbewufstsein thront, wie der
Spiegel, aus dem das Ganze wie ein einheit-
liches Zauberbild herausstrahlt, nur noch der
Beleuchtung bedarf. Die Stellung könnte nicht
anders sein: die vorgebeugte Haltung des Mannes,
welcher der Welt der schalen Mittelmäfsigkeit
zu entfliehen trachtet, um das künstlerische Ziel
in ungetrübter, unverkümmerter, unzerstreuter
Form anzuschauen, die Faust, die sich zusammen-
ballt, um den noch so spröden Stoff zu glätten,
die übereinandergeschlagenen Beine, die, weit
entfernt, der sonstigen nachlässig behaglichen
Träumerei zum Dolmetsch zu dienen, in diesem
Falle das Bild höchster Energieentfaltung nur
noch verstärken, die ganze etwas zusammenge-
kauerte Haltung: das ist fürwahr der Schöpfer
der Messe und der Neunten.
Der Adler ist zum Auffluge bereit. Anders
wie die zwei Raben Wotans, die, von ihm ge-
trennt, auffliegen, um ihm die Erfüllung des
Fluchs und die sich daran anknüpfende Feuer-
läuterung der sündigen Welt zu verkünden.
Dieser Adler ist Beethovens ständiger Gefährte,
das Symbol seiner Herrschermacht. Gewifs ist
er, wie die ganze Haltung Beethovens im Thron-
sessel, griechischem Zeus-Muster nachgebildet.
Aber bei der Beliebtheit des Adlers in unserer
Heraldik werden wir uns des griechischen Ur-
sprungszeugnisses des Adlers kaum bewufst,
und wenigstens die sitzende Stellung war ange-
sichts der Wahl des Augenblicks, in welchem
der Meister zu schildern war, die einzig mög-
liche. „Hinan“, raunt ihm der flugbereite Adler
zu, „in die Wolken, in den Äther, in dein Reich,
in das ich dich so oft geführt, um dort Schöneres
und Gewaltigeres zu schauen, als du je geschaut,
fernab von dieser Welt der Zerstreuung und
Mittelmäfsigkeit, die dich nur hindert, das, was
dich erfüllt, in reinster Form zu schauen. Dein
Zaubergewand, das sich um deine Kniee schmiegt,
wird sich zum sicheren Wolkenlager formen
und dich über die Lande geleiten. Hinan zum
Äther, wo die Sphären ihr ewiges, unvergleich-
liches Lied summen.“ Dieser Adler ist so viel-
sagend, so voll Tiefe und so voll naiv elemen-
taren Aufschwunges, dafs er als Kunstwerk
seinem Gebieter Beethoven durchaus ebenbürtig
ist. Aus dem Herrschafts-Attribut ist hier der
Träger des künstlerischen Aufschwunges, der
Leiter auf dem Wege der thatbereiten künst-
lerischen Gestaltung geworden.
Ist Beethoven, wie schon mehrmals ange-
deutet, hier weit mehr Prometheus als Zeus
trotz der äufserlich dem Zeus ähnlichen An-
ordnung, mehr der durch eiserne Willenskraft
und das Gefühl der höchsten Anspannungs-
fähigkeit seiner Kräfte hervorragende Mensch,
als der in ruhigem Machtgefühl waltende Heroe,
so büfst er freilich an eigner Machtvollkommen-
heit dadurch ein, dafs er des Adlers bedarf, um
ins Gebiet des Ideals hinaufzuschweben. Dennoch
wird keiner, der den Adler beobachtet und be-
griffen hat, ihn missen wollen.
Der Adler raunt dem Meister zu: „Entflieh
der Welt!“ und insofern die fünf Genienköpfe
auf dem kunstvollen Ornament-Band um den
Thron diese Welt versinnbildlichen, aber auch
insofern sie die Aufgabe inspirierender Stimmen
(wie vielfach behauptet wird) erfüllen sollen,
so oder so beginnen bei ihnen die Einwände,
die gegen den Klingerschen Beethoven als Ge-
samtkunstwerk auch vom musikalischen Stand-
Georg Lührig, Dresden
Jugend und Alter
46