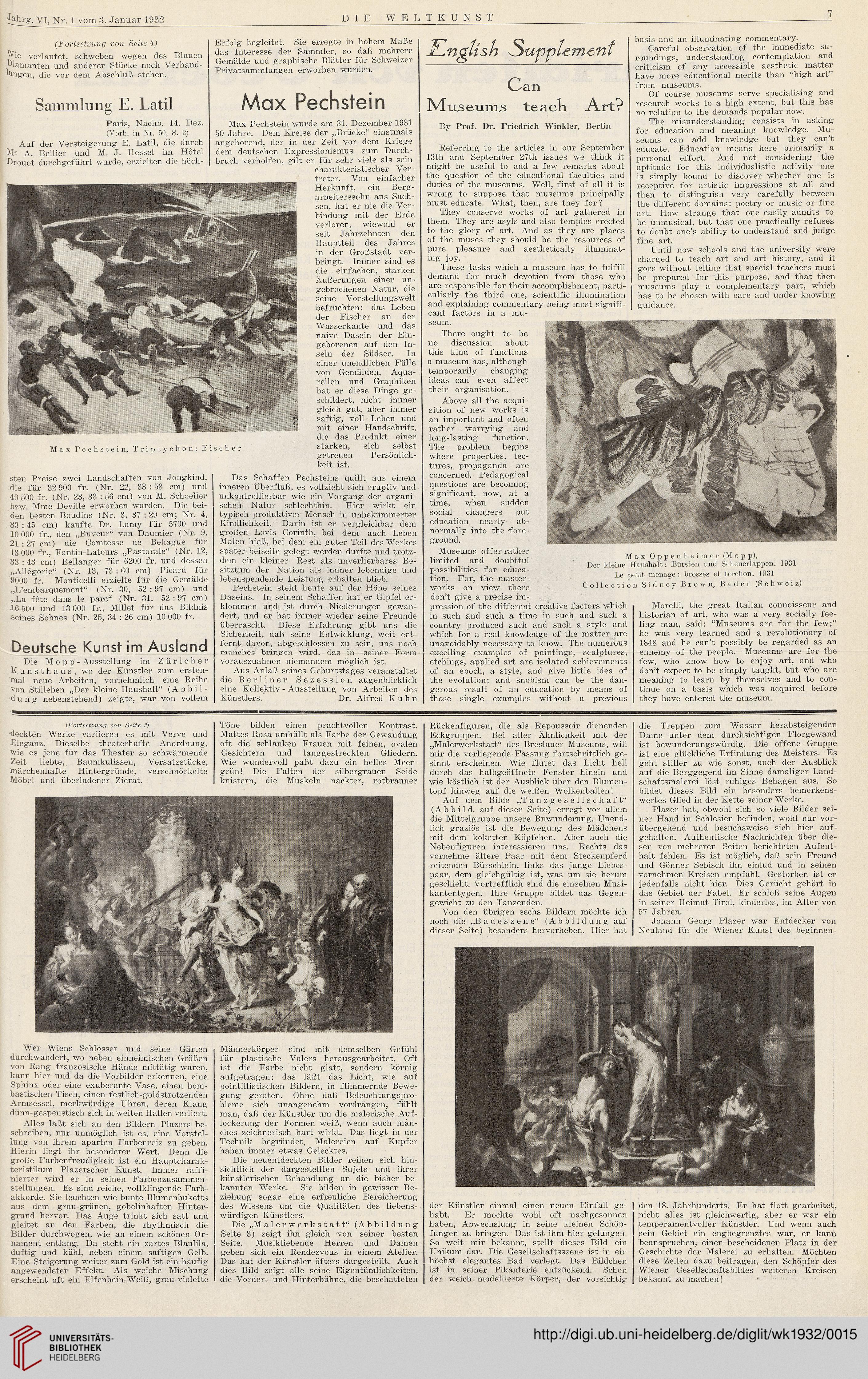jajirg. VI, Nr. 1 vom 3. Januar 1932
DIE WELTKUNST
(Fortsetzung von Seite i)
^Vie verlautet, schweben wegen des Blauen
Biamanten und anderer Stücke noch Verhand-
lungen, die vor dem Abschluß stehen.
Erfolg begleitet. Sie erregte in hohem Maße
das Interesse der Sammler, so daß mehrere
Gemälde und graphische Blätter für Schweizer
Privatsammlungen erworben wurden.
Sammlung E. Latil
Paris, Nachb. 14. Dez.
(Vorb. in Nr. 50, S. 2)
Auf der Versteigerung E. Latil, die durch
Mc A. Bellier und M. J. Hessel im Hotel
Drouot durchgeführt wurde, erzielten die hoch-
Max Pechstein
Max Pechstein wurde am 31. Dezember 1931
50 Jahre. Dem Kreise der „Brücke“ einstmals
angehörend, der in der Zeit vor dem Kriege
dem deutschen Expressionismus zum Durch-
bruch verholfen, gilt er für sehr viele als sein
charakteristischer Ver-
treter. Von einfacher
Herkunft, ein Berg-
arbeiterssohn aus Sach-
sen, hat er nie die Ver-
bindung mit der Erde
verloren, wiewohl er
seit Jahrzehnten den
Hauptteil des Jahres
in der Großstadt ver-
bringt. Immer sind es
die einfachen, starken
Äußerungen einer un-
gebrochenen Natur, die
seine Vorstellungswelt
befruchten: das Leben
der Fischer an der
Wasserkante und das
naive Dasein der Ein-
geborenen auf den In-
seln der Südsee. In
einer unendlichen Fülle
von Gemälden, Aqua-
rellen und Graphiken
hat er diese Dinge ge-
schildert, nicht immer
gleich gut, aber immer
saftig, voll Leben und
mit einer Handschrift,
die das Produkt einer
starken, sich selbst
getreuen Persönlich-
keit ist.
Max Pechstein, Triptychon: Fischer
sten Preise zwei Landschaften von Jongkind,
die für 32 900 fr. (Nr. 22, 33:53 cm) und
40 500 fr. (Nr. 23, 33 : 56 cm) von M. Schoeller
bzw. Mme Deville erworben wurden. Die bei-
den besten Boudins (Nr. 3, 37 : 29 cm; Nr. 4,
33 :45 cm) kaufte Dr. Lamy für 5700 und
10 000 fr., den „Buveur“ von Daumier (Nr. 9,
21 :27 cm) die Comtesse de Behague für
13 000 fr., Fantin-Latours „Pastorale“ (Nr. 12,
33 :43 cm) Bellanger für 6200 fr. und dessen
„Allegorie“ (Nr. 13, 73 :60 cm) Picard für
9000 fr. Monticelli erzielte für die Gemälde
„L’embarquement“ (Nr. 30, 52 :97 cm) und
„La fete dans le parc“ (Nr. 31, 52 :97 cm)
16 500 und 13 000 fr., Millet für das Bildnis
seines Sohnes (Nr. 25, 34 : 26 cm) 10 000 fr.
Deutsche Kunst im Ausland
Die Mopp- Ausstellung im Züricher
Kunsthaus, wo der Künstler zum ersten-
mal neue Arbeiten, vornehmlich eine Reihe
von Stilleben „Der kleine Haushalt“ (Abbil-
dung nebenstehend) zeigte, war von vollem
Das Schaffen Pechsteins quillt aus einem
inneren Überfluß, es vollzieht sich eruptiv und
unkontrollierbar wie ein Vorgang der organi-
schen Natur schlechthin. Hier wirkt ein
typisch produktiver Mensch in unbekümmerter
Kindlichkeit. Darin ist er vergleichbar dem
großen Lovis Corinth, bei dem auch Leben
Malen hieß, bei dem ein guter Teil des Werkes
später beiseite gelegt werden durfte und trotz-
dem ein kleiner Rest als unverlierbares Be-
sitztum der Nation als immer lebendige und
lebenspendende Leistung erhalten blieb.
Pechstein steht heute auf der Höhe seines
Daseins. In seinem Schaffen hat er Gipfel er-
klommen und ist durch Niederungen gewan-
dert, und er hat immer wieder seine Freunde
überrascht. Diese Erfahrung gibt uns die
Sicherheit, daß seine Entwicklung, weit ent-
fernt davon, abgeschlossen zu sein, uns noch
manches bringen wird, das in seiner Form
vorauszuahnen niemandem möglich ist.
Aus Anlaß seines Geburtstages veranstaltet
die Berliner Sezession augenblicklich
eine Kollektiv - Ausstellung von Arbeiten des
Künstlers. Dr. Alfred Kuhn
to be
about
Morelli, the great Italian connoisseur and
historian of art, who was a very socially fee-
ling man, said: "Museums are for the few;“
he was very learned and a revolutionary of
1848 and he can’t possibly be regarded as an
ennemy of the people. Museums are for the
few, who know how to enjoy art, and who
don’t expect to be simply taught, but who are
meaning to learn by themselves and to con-
tinue on a basis which was acquired before
they have entered the museum.
There ought
no discussion
this kind of functions
a museum has, although
temporarily changing
ideas can even affect
their Organisation.
Above all the acqui-
sition of new works is
an important and offen
rather worrying and
long-Iasting function.
The problem begins
where properties, lec-
tures, Propaganda are
concerned. Pedagogical
questions are becoming
significant, now, at a
time, when sudden
social changers put
education nearly ab-
normally into the fore-
ground.
Museums offer rather
limited and doubtfui
possibilities for educa¬
tion. For, the master-
works on view there
don’t give a precise Im-
pression of the different Creative factors which
in such and such a time in such and such a
country produced such and such a style and
which for a real knowledge of the matter are
unavoidably necessary to know. The numerous
excelling examplcs of paintings, sculptures,
etchings, applied art are isolated achievements
of an epoch, a style, and give little idea of
the evolution; and snobism can be the dan-
gerous result of an education by means of
those single examples without a previous
Max Oppenheimer (Mopp),
Der kleine Haushalt: Bürsten und Scheuerlappen. 1931
Le petit menage : brosses et torchon. 1931
Collection Sidney Brown, Baden (Schweiz)
basis and an illuminating commentary.
Careful observation of the immediate su-
roundings, understanding contemplation and
criticism of any accessible aesthetic matter
have more educational merits than “high art”
from museums.
Of course museums serve specialising and
research works to a high extent, but this has
no relation to the demands populär now.
The misunderstanding consists in asking
for education and meaning knowledge. Mu-
seums can add knowledge but they can’t
educate. Education means here primarily a
personal effort. And not considering the
aptitude for this individualistic activity one
is simply bound to discover whether one is
receptive for artistic impressions at all and
then to distinguish very carefully between
the different domains: poetry or music or fine
art. How stränge that one easily admits to
be unmusical, but that one practically refuses
to doubt one’s ability to understand and judge
fine art.
Until now schools and the university were
charged to teach art and art history, and it
goes without telling that special teachers must
be prepared for this purpose, and that then
museums play a complementary part, which
has to be chosen with care and under knowing
guidance.
Hn^lish Supplement
Can
Museums teach Art?
By Prof. Dr. Friedrich Winkler, Berlin
Referring to the articles in our September
13th and September 27th issues we think it
might be useful to add a few remarks about
the question of the educational faculties and
duties of the museums. Well, first of all it is
wrong to suppose that museums principally
must educate. What, then, are they for?
They conserve works of art gathered in
them. They are asyls and also temples erected
to the glory of art. And as they are places
of the muses they should be the resources of
pure pleasure and aesthetically illuminat-
ing joy.
These tasks which a museum has to fulfill
demand for much devotion from those who
are responsible for their accomplishment, parti-
culiarly the third one, scientific Illumination
and explaining commentary being most signifi-
cant factors in a mu¬
seum.
{Fortsetzung von Seite 3)
deckten Werke variieren es mit Verve und
Eleganz. Dieselbe theaterhafte Anordnung,
wie es jene für das Theater so schwärmende
Zeit liebte, Baumkulissen, Versatzstücke,
märchenhafte Hintergründe, verschnörkelte
Möbel und überladener Zierat.
Töne bilden einen prachtvollen Kontrast.
Mattes Rosa umhüllt als Farbe der Gewandung
oft die schlanken Frauen mit feinen, ovalen
Gesichtern und langgestreckten Gliedern.
Wie wundervoll paßt dazu ein helles Meer-
grün! Die Falten der silbergrauen Seide
knistern, die Muskeln nackter, rotbrauner
Wer Wiens Schlösser und seine Gärten
durchwandert, wo neben einheimischen Größen
von Rang französische Hände mittätig waren,
kann hier und da die Vorbilder erkennen, eine
Sphinx oder eine exuberante Vase, einen bom-
bastischen Tisch, einen festlich-goldstrotzenden
Armsessel, merkwürdige Uhren, deren Klang
dünn-gespenstisch sich in weiten Hallen verliert.
Alles läßt sich an den Bildern Plazers be-
schreiben, nur unmöglich ist es, eine Vorstel-
lung von ihrem aparten Farbenreiz zu geben.
Hierin liegt ihr besonderer Wert. Denn die
große Farbenfreudigkeit ist ein Hauptcharak-
teristikum Plazerscher Kunst. Immer raffi-
nierter wird er in seinen Farbenzusammen-
stellungen. Es sind reiche, vollklingende Farb-
akkorde. Sie leuchten wie bunte Blumenbuketts
aus dem grau-grünen, gobelinhaften Hinter-
grund hervor. Das Auge trinkt sich satt und
gleitet an den Farben, die rhythmisch die
Bilder durchwogen, wie an einem schönen Or-
nament entlang. Da steht ein zartes Blaulila,
duftig und kühl, neben einem saftigen Gelb.
Eine Steigerung weiter zum Gold ist ein häufig
angewendeter Effekt. Als weiche Mischung
erscheint oft ein Elfenbein-Weiß, grau-violette
Männerkörper sind mit demselben Gefühl
für plastische Valers herausgearbeitet. Oft
ist die Farbe nicht glatt, sondern körnig
auf getragen; das läßt das Licht, wie auf
pointillistischen Bildern, in flimmernde Bewe-
gung geraten. Ohne daß Beleuchtungspro-
bleme sich unangenehm vordrängen, fühlt
man, daß der Künstler um die malerische Auf-
lockerung der Formen weiß, wenn auch man-
ches zeichnerisch hart wirkt. Das liegt in der
Technik begründet, Malereien auf Kupfer
haben immer etwas Gelecktes.
Die neuentdeckten Bilder reihen sich hin-
sichtlich der dargestellten Sujets und ihrer
künstlerischen Behandlung an die bisher be-
kannten Werke. Sie bilden in gewisser Be-
ziehung sogar eine erfreuliche Bereicherung
des Wissens um die Qualitäten des liebens-
würdigen Künstlers.
Die „M aler Werkstatt“ (Abbildung
Seite 3) zeigt ihn gleich von seiner besten
Seite. Musikliebende Herren und Damen
geben sich ein Rendezvous in einem Atelier.
Das hat der Künstler öfters dargestellt. Auch
dies Bild zeigt alle seine Eigentümlichkeiten,
die Vorder- und Hinterbühne, die beschatteten
Rückenfiguren, die als Repoussoir dienenden
Eckgruppen. Bei aller Ähnlichkeit mit der
„Malerwerkstatt“ des Breslauer Museums, will
mir die vorliegende Fassung fortschrittlich ge-
sinnt erscheinen. Wie flutet das Licht hell
durch das halbgeöffnete Fenster hinein und
wie köstlich ist der Ausblick über den Blumen-
topf hinweg auf die weißen Wolkenballen!
Auf dem Bilde „Tanzgesellschaft“
(Abbild, auf dieser Seite) erregt vor allem
die Mittelgruppe unsere Bnwunderung. Unend-
lich graziös ist die Bewegung des Mädchens
mit dem koketten Köpfchen. Aber auch die
Nebenfiguren interessieren uns. Rechts das
vornehme ältere Paar mit dem Steckenpferd
reitenden Bürschlein, links das junge Liebes-
paar, dem gleichgültig ist, was um sie herum
geschieht. Vortrefflich sind die einzelnen Musi-
kantentypen. Ihre Gruppe bildet das Gegen-
gewicht zu den Tanzenden.
Von den übrigen sechs Bildern möchte ich
noch die „Badeszene“ (Abbildung auf
dieser Seite) besonders hervorheben. Hier hat
die Treppen zum Wasser herabsteigenden
Dame unter dem durchsichtigen Florgewand
ist bewunderungswürdig. Die offene Gruppe
ist eine glückliche Erfindung des Meisters. Es
geht stiller zu wie sonst, auch der Ausblick
auf die Berggegend im Sinne damaliger Land-
schaftsmalerei löst ruhiges Behagen aus. So
bildet dieses Bild ein besonders bemerkens-
wertes Glied in der Kette seiner Werke.
Plazer hat, obwohl sich so viele Bilder sei-
ner Hand in Schlesien befinden, wohl nur vor-
übergehend und besuchsweise sich hier auf-
gehalten. Authentische Nachrichten über die-
sen von mehreren Seiten berichteten Aufent-
halt fehlen. Es ist möglich, daß sein Freund
und Gönner Sebisch ihn einlud und in seinen
vornehmen Kreisen empfahl. Gestorben ist er
jedenfalls nicht hier. Dies Gerücht gehört in
das Gebiet der Fabel. Er schloß seine Augen
in seiner Heimat Tirol, kinderlos, im Alter von
57 Jahren.
Johann Georg Plazer war Entdecker von
Neuland für die Wienei- Kunst des beginnen-
der Künstler einmal einen neuen Einfall ge-
habt. Er mochte wohl oft nachgesonnen
haben, Abwechslung in seine kleinen Schöp-
fungen zu bringen. Das ist ihm hier gelungen
So weit mir bekannt, stellt dieses Bild ein
Unikum dar. Die Gesellschaftsszene ist in eir
höchst elegantes Bad verlegt. Das Bildchen
ist in seiner Pikanterie entzückend. Schon
der weich modellierte Körper, der vorsichtig
den 18. Jahrhunderts. Er hat flott gearbeitet,
nicht alles ist gleichwertig, aber er war ein
temperamentvoller Künstler. Und wenn auch
sein Gebiet ein engbegrenztes war, er kann
beanspruchen, einen bescheidenen Platz in der
Geschichte der Malerei zu erhalten. Möchten
diese Zeilen dazu beitragen, den Schöpfer des
Wiener Gesellschaftsbildes weiteren Kreisen
bekannt zu machen!
DIE WELTKUNST
(Fortsetzung von Seite i)
^Vie verlautet, schweben wegen des Blauen
Biamanten und anderer Stücke noch Verhand-
lungen, die vor dem Abschluß stehen.
Erfolg begleitet. Sie erregte in hohem Maße
das Interesse der Sammler, so daß mehrere
Gemälde und graphische Blätter für Schweizer
Privatsammlungen erworben wurden.
Sammlung E. Latil
Paris, Nachb. 14. Dez.
(Vorb. in Nr. 50, S. 2)
Auf der Versteigerung E. Latil, die durch
Mc A. Bellier und M. J. Hessel im Hotel
Drouot durchgeführt wurde, erzielten die hoch-
Max Pechstein
Max Pechstein wurde am 31. Dezember 1931
50 Jahre. Dem Kreise der „Brücke“ einstmals
angehörend, der in der Zeit vor dem Kriege
dem deutschen Expressionismus zum Durch-
bruch verholfen, gilt er für sehr viele als sein
charakteristischer Ver-
treter. Von einfacher
Herkunft, ein Berg-
arbeiterssohn aus Sach-
sen, hat er nie die Ver-
bindung mit der Erde
verloren, wiewohl er
seit Jahrzehnten den
Hauptteil des Jahres
in der Großstadt ver-
bringt. Immer sind es
die einfachen, starken
Äußerungen einer un-
gebrochenen Natur, die
seine Vorstellungswelt
befruchten: das Leben
der Fischer an der
Wasserkante und das
naive Dasein der Ein-
geborenen auf den In-
seln der Südsee. In
einer unendlichen Fülle
von Gemälden, Aqua-
rellen und Graphiken
hat er diese Dinge ge-
schildert, nicht immer
gleich gut, aber immer
saftig, voll Leben und
mit einer Handschrift,
die das Produkt einer
starken, sich selbst
getreuen Persönlich-
keit ist.
Max Pechstein, Triptychon: Fischer
sten Preise zwei Landschaften von Jongkind,
die für 32 900 fr. (Nr. 22, 33:53 cm) und
40 500 fr. (Nr. 23, 33 : 56 cm) von M. Schoeller
bzw. Mme Deville erworben wurden. Die bei-
den besten Boudins (Nr. 3, 37 : 29 cm; Nr. 4,
33 :45 cm) kaufte Dr. Lamy für 5700 und
10 000 fr., den „Buveur“ von Daumier (Nr. 9,
21 :27 cm) die Comtesse de Behague für
13 000 fr., Fantin-Latours „Pastorale“ (Nr. 12,
33 :43 cm) Bellanger für 6200 fr. und dessen
„Allegorie“ (Nr. 13, 73 :60 cm) Picard für
9000 fr. Monticelli erzielte für die Gemälde
„L’embarquement“ (Nr. 30, 52 :97 cm) und
„La fete dans le parc“ (Nr. 31, 52 :97 cm)
16 500 und 13 000 fr., Millet für das Bildnis
seines Sohnes (Nr. 25, 34 : 26 cm) 10 000 fr.
Deutsche Kunst im Ausland
Die Mopp- Ausstellung im Züricher
Kunsthaus, wo der Künstler zum ersten-
mal neue Arbeiten, vornehmlich eine Reihe
von Stilleben „Der kleine Haushalt“ (Abbil-
dung nebenstehend) zeigte, war von vollem
Das Schaffen Pechsteins quillt aus einem
inneren Überfluß, es vollzieht sich eruptiv und
unkontrollierbar wie ein Vorgang der organi-
schen Natur schlechthin. Hier wirkt ein
typisch produktiver Mensch in unbekümmerter
Kindlichkeit. Darin ist er vergleichbar dem
großen Lovis Corinth, bei dem auch Leben
Malen hieß, bei dem ein guter Teil des Werkes
später beiseite gelegt werden durfte und trotz-
dem ein kleiner Rest als unverlierbares Be-
sitztum der Nation als immer lebendige und
lebenspendende Leistung erhalten blieb.
Pechstein steht heute auf der Höhe seines
Daseins. In seinem Schaffen hat er Gipfel er-
klommen und ist durch Niederungen gewan-
dert, und er hat immer wieder seine Freunde
überrascht. Diese Erfahrung gibt uns die
Sicherheit, daß seine Entwicklung, weit ent-
fernt davon, abgeschlossen zu sein, uns noch
manches bringen wird, das in seiner Form
vorauszuahnen niemandem möglich ist.
Aus Anlaß seines Geburtstages veranstaltet
die Berliner Sezession augenblicklich
eine Kollektiv - Ausstellung von Arbeiten des
Künstlers. Dr. Alfred Kuhn
to be
about
Morelli, the great Italian connoisseur and
historian of art, who was a very socially fee-
ling man, said: "Museums are for the few;“
he was very learned and a revolutionary of
1848 and he can’t possibly be regarded as an
ennemy of the people. Museums are for the
few, who know how to enjoy art, and who
don’t expect to be simply taught, but who are
meaning to learn by themselves and to con-
tinue on a basis which was acquired before
they have entered the museum.
There ought
no discussion
this kind of functions
a museum has, although
temporarily changing
ideas can even affect
their Organisation.
Above all the acqui-
sition of new works is
an important and offen
rather worrying and
long-Iasting function.
The problem begins
where properties, lec-
tures, Propaganda are
concerned. Pedagogical
questions are becoming
significant, now, at a
time, when sudden
social changers put
education nearly ab-
normally into the fore-
ground.
Museums offer rather
limited and doubtfui
possibilities for educa¬
tion. For, the master-
works on view there
don’t give a precise Im-
pression of the different Creative factors which
in such and such a time in such and such a
country produced such and such a style and
which for a real knowledge of the matter are
unavoidably necessary to know. The numerous
excelling examplcs of paintings, sculptures,
etchings, applied art are isolated achievements
of an epoch, a style, and give little idea of
the evolution; and snobism can be the dan-
gerous result of an education by means of
those single examples without a previous
Max Oppenheimer (Mopp),
Der kleine Haushalt: Bürsten und Scheuerlappen. 1931
Le petit menage : brosses et torchon. 1931
Collection Sidney Brown, Baden (Schweiz)
basis and an illuminating commentary.
Careful observation of the immediate su-
roundings, understanding contemplation and
criticism of any accessible aesthetic matter
have more educational merits than “high art”
from museums.
Of course museums serve specialising and
research works to a high extent, but this has
no relation to the demands populär now.
The misunderstanding consists in asking
for education and meaning knowledge. Mu-
seums can add knowledge but they can’t
educate. Education means here primarily a
personal effort. And not considering the
aptitude for this individualistic activity one
is simply bound to discover whether one is
receptive for artistic impressions at all and
then to distinguish very carefully between
the different domains: poetry or music or fine
art. How stränge that one easily admits to
be unmusical, but that one practically refuses
to doubt one’s ability to understand and judge
fine art.
Until now schools and the university were
charged to teach art and art history, and it
goes without telling that special teachers must
be prepared for this purpose, and that then
museums play a complementary part, which
has to be chosen with care and under knowing
guidance.
Hn^lish Supplement
Can
Museums teach Art?
By Prof. Dr. Friedrich Winkler, Berlin
Referring to the articles in our September
13th and September 27th issues we think it
might be useful to add a few remarks about
the question of the educational faculties and
duties of the museums. Well, first of all it is
wrong to suppose that museums principally
must educate. What, then, are they for?
They conserve works of art gathered in
them. They are asyls and also temples erected
to the glory of art. And as they are places
of the muses they should be the resources of
pure pleasure and aesthetically illuminat-
ing joy.
These tasks which a museum has to fulfill
demand for much devotion from those who
are responsible for their accomplishment, parti-
culiarly the third one, scientific Illumination
and explaining commentary being most signifi-
cant factors in a mu¬
seum.
{Fortsetzung von Seite 3)
deckten Werke variieren es mit Verve und
Eleganz. Dieselbe theaterhafte Anordnung,
wie es jene für das Theater so schwärmende
Zeit liebte, Baumkulissen, Versatzstücke,
märchenhafte Hintergründe, verschnörkelte
Möbel und überladener Zierat.
Töne bilden einen prachtvollen Kontrast.
Mattes Rosa umhüllt als Farbe der Gewandung
oft die schlanken Frauen mit feinen, ovalen
Gesichtern und langgestreckten Gliedern.
Wie wundervoll paßt dazu ein helles Meer-
grün! Die Falten der silbergrauen Seide
knistern, die Muskeln nackter, rotbrauner
Wer Wiens Schlösser und seine Gärten
durchwandert, wo neben einheimischen Größen
von Rang französische Hände mittätig waren,
kann hier und da die Vorbilder erkennen, eine
Sphinx oder eine exuberante Vase, einen bom-
bastischen Tisch, einen festlich-goldstrotzenden
Armsessel, merkwürdige Uhren, deren Klang
dünn-gespenstisch sich in weiten Hallen verliert.
Alles läßt sich an den Bildern Plazers be-
schreiben, nur unmöglich ist es, eine Vorstel-
lung von ihrem aparten Farbenreiz zu geben.
Hierin liegt ihr besonderer Wert. Denn die
große Farbenfreudigkeit ist ein Hauptcharak-
teristikum Plazerscher Kunst. Immer raffi-
nierter wird er in seinen Farbenzusammen-
stellungen. Es sind reiche, vollklingende Farb-
akkorde. Sie leuchten wie bunte Blumenbuketts
aus dem grau-grünen, gobelinhaften Hinter-
grund hervor. Das Auge trinkt sich satt und
gleitet an den Farben, die rhythmisch die
Bilder durchwogen, wie an einem schönen Or-
nament entlang. Da steht ein zartes Blaulila,
duftig und kühl, neben einem saftigen Gelb.
Eine Steigerung weiter zum Gold ist ein häufig
angewendeter Effekt. Als weiche Mischung
erscheint oft ein Elfenbein-Weiß, grau-violette
Männerkörper sind mit demselben Gefühl
für plastische Valers herausgearbeitet. Oft
ist die Farbe nicht glatt, sondern körnig
auf getragen; das läßt das Licht, wie auf
pointillistischen Bildern, in flimmernde Bewe-
gung geraten. Ohne daß Beleuchtungspro-
bleme sich unangenehm vordrängen, fühlt
man, daß der Künstler um die malerische Auf-
lockerung der Formen weiß, wenn auch man-
ches zeichnerisch hart wirkt. Das liegt in der
Technik begründet, Malereien auf Kupfer
haben immer etwas Gelecktes.
Die neuentdeckten Bilder reihen sich hin-
sichtlich der dargestellten Sujets und ihrer
künstlerischen Behandlung an die bisher be-
kannten Werke. Sie bilden in gewisser Be-
ziehung sogar eine erfreuliche Bereicherung
des Wissens um die Qualitäten des liebens-
würdigen Künstlers.
Die „M aler Werkstatt“ (Abbildung
Seite 3) zeigt ihn gleich von seiner besten
Seite. Musikliebende Herren und Damen
geben sich ein Rendezvous in einem Atelier.
Das hat der Künstler öfters dargestellt. Auch
dies Bild zeigt alle seine Eigentümlichkeiten,
die Vorder- und Hinterbühne, die beschatteten
Rückenfiguren, die als Repoussoir dienenden
Eckgruppen. Bei aller Ähnlichkeit mit der
„Malerwerkstatt“ des Breslauer Museums, will
mir die vorliegende Fassung fortschrittlich ge-
sinnt erscheinen. Wie flutet das Licht hell
durch das halbgeöffnete Fenster hinein und
wie köstlich ist der Ausblick über den Blumen-
topf hinweg auf die weißen Wolkenballen!
Auf dem Bilde „Tanzgesellschaft“
(Abbild, auf dieser Seite) erregt vor allem
die Mittelgruppe unsere Bnwunderung. Unend-
lich graziös ist die Bewegung des Mädchens
mit dem koketten Köpfchen. Aber auch die
Nebenfiguren interessieren uns. Rechts das
vornehme ältere Paar mit dem Steckenpferd
reitenden Bürschlein, links das junge Liebes-
paar, dem gleichgültig ist, was um sie herum
geschieht. Vortrefflich sind die einzelnen Musi-
kantentypen. Ihre Gruppe bildet das Gegen-
gewicht zu den Tanzenden.
Von den übrigen sechs Bildern möchte ich
noch die „Badeszene“ (Abbildung auf
dieser Seite) besonders hervorheben. Hier hat
die Treppen zum Wasser herabsteigenden
Dame unter dem durchsichtigen Florgewand
ist bewunderungswürdig. Die offene Gruppe
ist eine glückliche Erfindung des Meisters. Es
geht stiller zu wie sonst, auch der Ausblick
auf die Berggegend im Sinne damaliger Land-
schaftsmalerei löst ruhiges Behagen aus. So
bildet dieses Bild ein besonders bemerkens-
wertes Glied in der Kette seiner Werke.
Plazer hat, obwohl sich so viele Bilder sei-
ner Hand in Schlesien befinden, wohl nur vor-
übergehend und besuchsweise sich hier auf-
gehalten. Authentische Nachrichten über die-
sen von mehreren Seiten berichteten Aufent-
halt fehlen. Es ist möglich, daß sein Freund
und Gönner Sebisch ihn einlud und in seinen
vornehmen Kreisen empfahl. Gestorben ist er
jedenfalls nicht hier. Dies Gerücht gehört in
das Gebiet der Fabel. Er schloß seine Augen
in seiner Heimat Tirol, kinderlos, im Alter von
57 Jahren.
Johann Georg Plazer war Entdecker von
Neuland für die Wienei- Kunst des beginnen-
der Künstler einmal einen neuen Einfall ge-
habt. Er mochte wohl oft nachgesonnen
haben, Abwechslung in seine kleinen Schöp-
fungen zu bringen. Das ist ihm hier gelungen
So weit mir bekannt, stellt dieses Bild ein
Unikum dar. Die Gesellschaftsszene ist in eir
höchst elegantes Bad verlegt. Das Bildchen
ist in seiner Pikanterie entzückend. Schon
der weich modellierte Körper, der vorsichtig
den 18. Jahrhunderts. Er hat flott gearbeitet,
nicht alles ist gleichwertig, aber er war ein
temperamentvoller Künstler. Und wenn auch
sein Gebiet ein engbegrenztes war, er kann
beanspruchen, einen bescheidenen Platz in der
Geschichte der Malerei zu erhalten. Möchten
diese Zeilen dazu beitragen, den Schöpfer des
Wiener Gesellschaftsbildes weiteren Kreisen
bekannt zu machen!