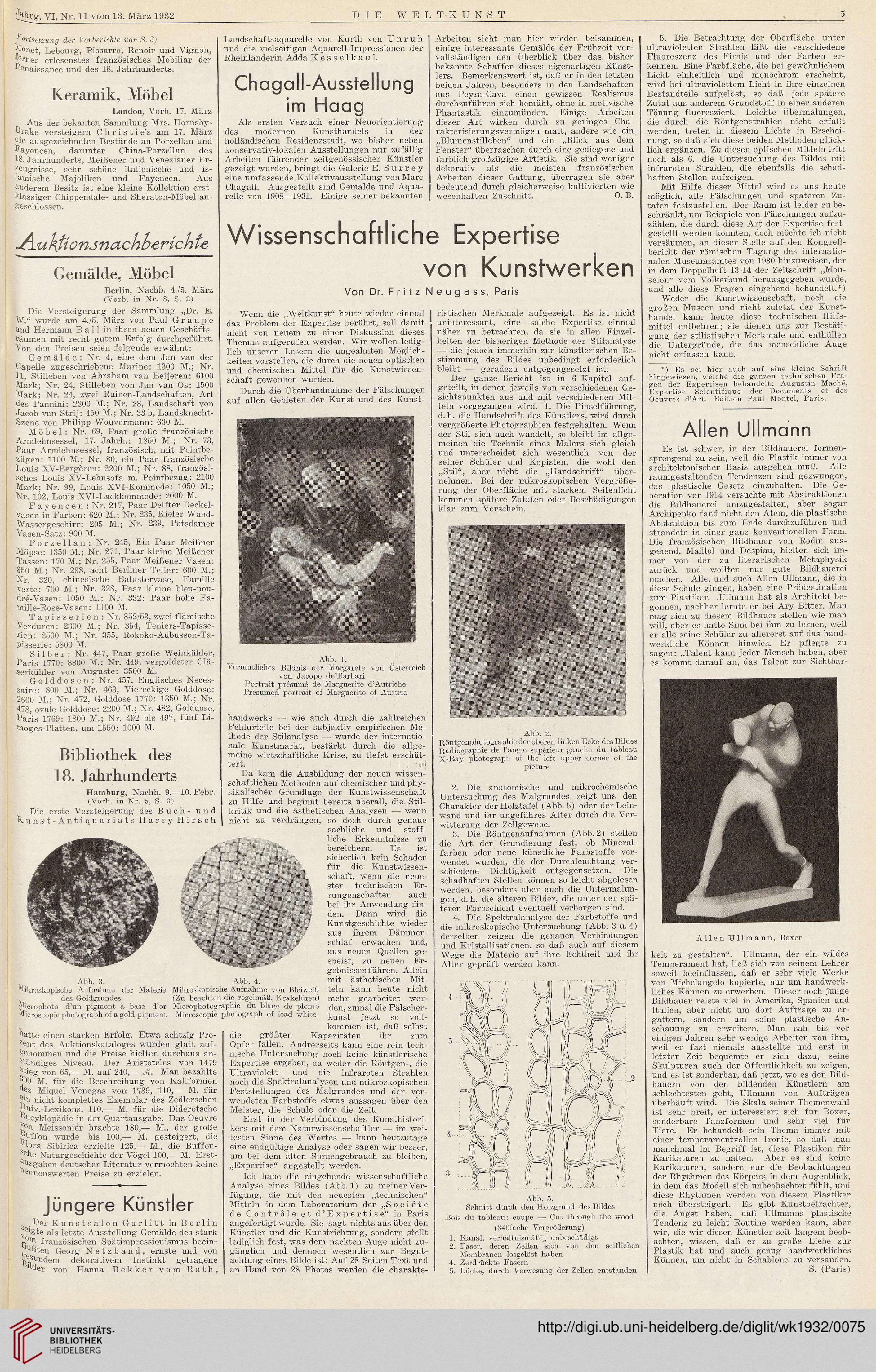DIE WELT KUNST
5
’i*rg. VI, Nr. 11 vom 13. März 1932
Fortsetzung der Vorberichte von S. 3)
Nonet, Lebourg, Pissarro, Renoir und Vignon,
ferner erlesenstes französisches Mobiliar der
Renaissance und des 18. Jahrhunderts.
Keramik, Möbel
London, Vorb. 17. März
Aus der bekanten Sammlung Mrs. Hornsby-
Drake versteigern C h r i s t i e’s am 17. März
die ausgezeichneten Bestände an Porzellan und
Fayencen, darunter China-Porzellan des
18. Jahrhunderts, Meißener und Venezianer Er-
zeugnisse, sehr schöne italienische und is-
lamische Majoliken und Fayencen. Aus
anderem Besitz ist eine kleine Kollektion erst-
klassiger Chippendale- und Sheraton-Möbel an-
geschlossen.
Landschaftsaquarelle von Kurth von Unruh
und die vielseitigen Aquarell-Impressionen der
Rheinländerin Adda Kess elkaul.
Chagall-Ausstellung
im Haag
Als ersten Versuch einer Neuorientierung
des modernen Kunsthandels in der
holländischen Residenzstadt, wo bisher neben
konservativ-lokalen Ausstellungen nur zufällig
Arbeiten führender zeitgenössischer Künstler
gezeigt wurden, bringt die Galerie E. S u r r e y
eine umfassende Kollektivausstellung von Marc
Chagall. Ausgestellt sind Gemälde und Aqua-
relle von 1908—1931. Einige seiner bekannten
Arbeiten sieht man hier wieder beisammen,
einige interessante Gemälde der Frühzeit ver-
vollständigen den Überblick über das bisher
bekannte Schaffen dieses eigenartigen Künst-
lers. Bemerkenswert ist, daß er in den letzten
beiden Jahren, besonders in den Landschaften
aus Peyra-Cava einen gewissen Realismus
durchzuführen sich bemüht, ohne in motivische
Phantastik einzumünden. Einige Arbeiten
dieser Art wirken durch zu geringes Cha-
rakterisierungsvermögen matt, andere wie ein
„Blumenstilleben“ und ein „Blick aus dem
Fenster“ überraschen durch eine gediegene und
farblich großzügige Artistik. Sie sind weniger
dekorativ als die meisten französischen
Arbeiten dieser Gattung, überragen sie aber
bedeutend durch gleicherweise kultivierten wie
wesenhaften Zuschnitt. O. B.
Aulrfionsnachberichte
Gemälde, Möbel
Wissenschaftliche Expertise
von Kunstwerken
Berlin, Nachb. 4.15. März
(Vorb. in Nr. 8, S. 2)
Von Dr. Fritz Neuga ss, Paris
Die Versteigerung der Sammlung „Dr. E.
W.“ wurde am 4./5. März von Paul Graupe
Und Hermann Ball in ihren neuen Geschäfts-
läumen mit recht gutem Erfolg durchgeführt.
Von den Preisen seien folgende erwähnt:
Gemälde : Nr. 4, eine dem Jan van der
Capelle zugeschriebene Marine: 1300 M.; Nr.
11, Stilleben von Abraham van Beijeren: 6100
Mark; Nr. 24, Stilleben von Jan van Os: 1500
Mark; Nr. 24, zwei Ruinen-Landschaften, Art
des Pannini: 2300 M.; Nr. 28, Landschaft von
Jacob van Strij: 450 M.; Nr. 33 b, Landsknecht-
Szene von Philipp Wouvermann: 630 M.
Möbel: Nr. 69, Paar große französische
Armlehnsessel, 17. Jahrh.: 1850 M.; Nr. 73,
Paar Armlehnsessel, französisch, mit Pointbe-
zügen: 1100 M.; Nr. 80, ein Paar französische
Louis XV-Bergeren: 2200 M.; Nr. 88, französi-
sches Louis XV-Lehnsofa m. Pointbezug: 2100
Mark; Nr. 99, Louis XVI-Kommode: 1050 M.;
Nr. 102, Louis XVI-Lackkommode: 2000 M.
Fayencen : Nr. 217, Paar Delfter Deckel-
Vasen in Farben: 620 M.; Nr. 235, Kieler Wand-
Wassergeschirr: 205 M.; Nr. 239, Potsdamer
Vasen-Satz: 900 M.
Porzellan : Nr. 245, Ein Paar Meißner
Möpse: 1350 M.; Nr. 271, Paar kleine Meißener
Tassen: 170 M.; Nr. 255, Paar Meißener Vasen:
350 M.; Nr. 298, acht Berliner Teller: 600 M.;
Nr. 320, chinesische Balustervase, Familie
Verte: 700 M.; Nr. 328, Paar kleine bleu-pou-
dre-Vasen: 1050 M.; Nr. 332: Paar hohe Fa-
ftiille-Rose-Vasen: 1100 M.
Tapisserien : Nr. 352/53, zwei flämische
Verduren: 2300 M.; Nr. 354, Teniers-Tapisse-
rien: 2500 M.; Nr. 355, Rokoko-Aubusson-Ta-
pisserie: 5800 M.
Silber : Nr. 447, Paar große Weinkühler,
Paris 1770: 8800 M.; Nr. 449, vergoldeter Glä-
serkühler von Auguste: 3500 M.
Golddosen : Nr. 457, Englisches Neces-
saire: 800 M.; Nr. 463, Viereckige Golddose:
2600 M.; Nr. 472, Golddose 1770: 1350 M.; Nr.
478, ovale Golddose: 2200 M.; Nr. 482, Golddose,
Paris 1769: 1800 M.; Nr. 492 bis 497, fünf Li-
hioges-Platten, um 1550: 1000 M.
Bibliothek des
18. Jahrhunderts
Hamburg, Nachb. 9.—10. Febr.
(Vorb. in Nr. 5, S. 3)
Die erste Versteigerung des Buch- und
Kunst-Antiquariats Harry Hirsch
Wenn die „Weltkunst“ heute wieder einmal
das Problem der Expertise berührt, soll damit
nicht von neuem zu einer Diskussion dieses
Themas auf gerufen werden. Wir wollen ledig-
lich unseren Lesern die ungeahnten Möglich-
keiten vorstellen, die durch die neuen optischen
und chemischen Mittel für die Kunstwissen-
schaft gewonnen wurden.
Durch die Überhandnahme der Fälschungen
auf allen Gebieten der Kunst und des Kunst-
Abb. 1.
Vermutliches Bildnis der Margarete von Österreich
von Jacopo de’Barbari
Portrait presume de Marguerite d’Autriche
Presumed portrait of Marguerite of Austria
handwerks — wie auch durch die zahlreichen
Fehlurteile bei der subjektiv empirischen Me-
thode der Stilanalyse — wurde der internatio-
nale Kunstmarkt, bestärkt durch die allge-
meine wirtschaftliche Krise, zu tiefst erschüt-
tert. ‘ ! I • I ! <(V
Da kam die Ausbildung der neuen wissen-
schaftlichen Methoden auf chemischer und phy-
sikalischer Grundlage der Kunstwissenschaft
zu Hilfe und beginnt bereits überall, die Stil-
kritik und die ästhetischen Analysen — wenn
nicht zu verdrängen, so doch durch genaue
sachliche und stoff-
Abb. 3.
Mikroskopische Aufnahme der Materie
. des Goldgrundes.
Microphoto d’un pigment ä base d’or
Microscopic photograph of a gold pigment
Abb. 4.
Mikroskopische Aufnahme von Bleiweiß
(Zu beachten die regelmäß. Krakelüren)
Microphotographie du blanc de plomb
Microscopic photograph of lead white
liehe Erkenntnisse zu
bereichern. Es ist
sicherlich kein Schaden
für die Kunstwissen-
schaft, wenn die neue-
sten technischen Er-
rungenschaften auch
bei ihr Anwendung fin-
den. Dann wird die
Kunstgeschichte wieder
aus ihrem Dämmer-
schlaf erwachen und,
aus neuen Quellen ge-
speist, zu neuen Er-
gebnissenführen. Allein
mit ästhetischen Mit-
teln kann heute nicht
mehr gearbeitet wer-
den, zumal die Fälscher-
kunst jetzt so voll¬
matte einen starken Erfolg. Etwa achtzig Pro-
Vnt des Auktionskataloges wurden glatt auf-
Senommen und die Preise hielten durchaus an-
bändiges Niveau. Der Aristoteles von 1479
bieg von 65,— M. auf 240,— M. Man bezahlte
^00 M. für die Beschreibung von Kalifornien
-s Miquel Venegas von 1739, 110,— M. für
®ln nicht komplettes Exemplar des Zedlerschen
Pniv.-Lexikons, 110,— M. für die Diderotsche
Rncyklopädie in der Quartausgabe. Das Oeuvre
V>n Meissonier brachte 180,— M., der große
Jüiffon wurde bis 100,— M. gesteigert, die
lora Sibirica erzielte 125,— M., die Buffon-
Sche Naturgeschichte der Vögel 100,— M. Erst-
ausgaben deutscher Literatur vermochten keine
'ler)nenswerten Preise zu erzielen.
Jüngere Künstler
. I>er Kunstsalon Gurlitt in Berlin
,'f'Vrte als letzte Ausstellung Gemälde des stark
französischen Spätimpressionismus beein-
Rßten Georg Netzband, ernste und von
jj.'Shndem dekorativem Instinkt getragene
lder von Hanna Bekker vom Rath,
kommen ist, daß selbst
die größten Kapazitäten ihr zum
Opfer fallen. Andrerseits kann eine rein tech-
nische Untersuchung noch keine künstlerische
Expertise ergeben, da weder die Röntgen-, die
Ultraviolett- und die infraroten Strahlen
noch die Spektralanalysen und mikroskopischen
Feststellungen des Malgrundes und der ver-
wendeten Farbstoffe etwas aussagen über den
Meister, die Schule oder die Zeit.
Erst in der Verbindung des Kunsthistori-
kers mit dem Naturwissenschaftler — im wei-
testen Sinne des Wortes — kann heutzutage
eine endgültige Analyse oder sagen wir besser,
um bei dem alten Sprachgebrauch zu bleiben,
„Expertise“ angestellt werden.
Ich habe die eingehende wissenschaftliche
Analyse eines Bildes (Abb. 1) zu meiner Ver-
fügung, die mit den neuesten „technischen“
Mitteln in dem Laboratorium der „S o c i e t e
de Contröle et d’Expertise“ in Paris
angefertigt wurde. Sie sagt nichts aus über den
Künstler und die Kunstrichtung, sondern stellt
lediglich fest, was dem nackten Auge nicht zu-
gänglich und dennoch wesentlich zur Begut-
achtung eines Bilde ist: Auf 28 Seiten Text und
an Hand von 28 Photos werden die charakte¬
ristischen Merkmale aufgezeigt. Es ist nicht
uninteressant, eine solche Expertise einmal
näher zu betrachten, da sie in allen Einzel-
heiten der bisherigen Methode der Stilanalyse
— die jedoch immerhin zur künstlerischen Be-
stimmung des Bildes unbedingt erforderlich
bleibt — geradezu entgegengesetzt ist.
Der ganze Bericht ist in 6 Kapitel auf-
geteilt, in denen jeweils von verschiedenen Ge-
sichtspunkten aus und mit verschiedenen Mit-
teln vorgegangen wird. 1. Die Pinselführung,
d. h. die Handschrift des Künstlers, wird durch
vergrößerte Photographien festgehalten. Wenn
der Stil sich auch wandelt, so bleibt im allge-
meinen die Technik eines Malers sich gleich
und unterscheidet sich wesentlich von der
seiner Schüler und Kopisten, die wohl den
„Stil“, aber nicht die „Handschrift“ über-
nehmen. Bei der mikroskopischen Vergröße-
rung der Oberfläche mit starkem Seitenlicht
kommen spätere Zutaten oder Beschädigungen
klar zum Vorschein.
Abb. 2.
Röntgenphotographie der oberen linken Ecke des Bildes
Radiographie de l’angle superieur gauche du tableau
X-Ray photograph of the left upper Corner of the
picture
2. Die anatomische und mikrochemische
Untersuchung des Malgrundes zeigt uns den
Charakter der Holztafel (Abb. 5) oder der Lein-
wand und ihr ungefähres Alter durch die Ver-
witterung der Zellgewebe.
3. Die Röntgenaufnahmen (Abb. 2) stellen
die Art der Grundierung fest, ob Mineral-
farben oder neue künstliche Farbstoffe ver-
wendet wurden, die der Durchleuchtung ver-
schiedene Dichtigkeit entgegensetzen. Die
schadhaften Stellen können so leicht abgelesen
werden, besonders aber auch die Untermalun-
gen, d. h. die älteren Bilder, die unter der spä-
teren Farbschicht eventuell verborgen sind.
4. Die Spektralanalyse der Farbstoffe und
die mikroskopische Untersuchung (Abb. 3 u. 4)
derselben zeigen die genauen Verbindungen
und Kristallisationen, so daß auch auf diesem
Wege die Materie auf ihre Echtheit und ihr
Alter geprüft werden kann.
Abb. 5.
Schnitt durch den Holzgrund des Bildes
Bois du tableau: coupe — Cut through the wood
(340faehe Vergrößerung)
1. Kanal, verhältnismäßig unbeschädigt
2. Faser, deren Zellen sich von den seitlichen
Membranen losgelöst haben
4. Zerdrückte Fasern
5. Lücke, durch Verwesung der Zellen entstanden
5. Die Betrachtung der Oberfläche unter
ultravioletten Strahlen läßt die verschiedene
Fluoreszenz des Firnis und der Farben er-
kennen. Eine Farbfläche, die bei gewöhnlichem
Licht einheitlich und monochrom erscheint,
wird bei ultraviolettem Licht in ihre einzelnen
Bestandteile aufgelöst, so daß jede spätere
Zutat aus anderem Grundstoff in einer anderen
Tönung fluoresziert. Leichte Übermalungen,
die durch die Röntgenstrahlen nicht erfaßt
werden, treten in diesem Lichte in Erschei-
nung, so daß sich diese beiden Methoden glück-
lich ergänzen. Zu diesen optischen Mitteln tritt
noch als 6. die Untersuchung des Bildes mit
infraroten Strahlen, die ebenfalls die schad-
haften Stellen aufzeigen.
Mit Hilfe dieser Mittel wird es uns heute
möglich, alle Fälschungen und späteren Zu-
taten festzustellen. Der Raum ist leider zu be-
schränkt, um Beispiele von Fälschungen aufzu-
zählen, die durch diese Art der Expertise fest-
gestellt werden konnten, doch möchte ich nicht
versäumen, an dieser Stelle auf den Kongreß-
bericht der römischen Tagung des internatio-
nalen Museumsamtes von 1930 hinzuweisen, der
in dem Doppelheft 13-14 der Zeitschrift „Mou-
seion“ vom Völkerbund herausgegeben wurde,
und alle diese Fragen eingehend behandelt.*)
Weder die Kunstwissenschaft, noch die
großen Museen und nicht zuletzt der Kunst-
handel kann heute diese technischen Hilfs-
mittel entbehren; sie dienen uns zur Bestäti-
gung der stilistischen Merkmale und enthüllen
die Untergründe, die das menschliche Auge
nicht erfassen kann.
*) Es sei hier auch auf eine kleine Schrift
hingewiesen, welche die ganzen technischen Fra-
gen der Expertisen behandelt: Augustin Mache,
Expertise Scientifique des Documents et des
Oeuvres d’Art. Edition Paul Montel, Paris.
All en Ullmann
Es ist schwer, in der Bildhauerei formen-
sprengend zu sein, weil die Plastik immer von
architektonischer Basis ausgehen muß. Alle
raumgestaltenden Tendenzen sind gezwungen,
das plastische Gesetz einzuhalten. Die Ge-
neration vor 1914 versuchte mit Abstraktionen
die Bildhauerei umzugestalten, aber sogar
Archipenko fand nicht den Atem, die plastische
Abstraktion bis zum Ende durchzuführen und
strandete in einer ganz konventionellen Form.
Die französischen Bildhauer von Rodin aus-
gehend, Maillol und Despiau, hielten sich im-
mer von der zu literarischen Metaphysik
zurück und wollten nur gute Bildhauerei
machen. Alle, und auch Allen Ullmann, die in
diese Schule gingen, haben eine Prädestination
zum Plastiker. .Ullmann hat als Architekt be-
gonnen, nachher lernte er bei Ary Bitter. Man
mag sich zu diesem Bildhauer stellen wie man
will, aber es hatte Sinn bei ihm zu lernen, weil
er alle seine Schüler zu allererst auf das hand-
werkliche Können hinwies. Er pflegte zu
sagen: „Talent kann jeder Mensch haben, aber
es kommt darauf an, das Talent zur Sichtbar-
Allen Ullmann, Boxer
keit zu gestalten“. Ullmann, der ein wildes
Temperament hat, ließ sich von seinem Lehrer
soweit beeinflussen, daß er sehr viele Werke
von Michelangelo kopierte, nur um handwerk-
liches Können zu erwerben. Dieser noch junge
Bildhauer reiste viel in Amerika, Spanien und
Italien, aber nicht um dort Aufträge zu er-
gattern, sondern um seine plastische An-
schauung zu erweitern. Man sah bis vor
einigen Jahren sehr wenige Arbeiten von ihm,
weil er fast niemals ausstellte und erst in
letzter Zeit bequemte er sich dazu, seine
Skulpturen auch der Öffentlichkeit zu zeigen,
und es ist sonderbar, daß jetzt, wo es den Bild-
hauern von den bildenden Künstlern am
schlechtesten geht, Ullmann von Aufträgen
überhäuft wird. Die Skala seiner Themenwahl
ist sehr breit, er interessiert sich für Boxer,
sonderbare Tanzformen und sehr viel für
Tiere. Er behandelt sein Thema immer mit
einer temperamentvollen Ironie, so daß man
manchmal im Begriff ist, diese Plastiken für
Karikaturen zu halten. Aber es sind keine
Karikaturen, sondern nur die Beobachtungen
der Rhythmen des Körpers in dem Augenblick,
in dem das Modell sich unbeobachtet fühlt, und
diese Rhythmen werden von diesem Plastiker
noch übersteigert. Es gibt Kunstbetrachter,
die Angst haben, daß Ullmanns plastische
Tendenz zu leicht Routine werden kann, aber
wir, die wir diesen Künstler seit langem beob-
achten, wissen, daß er zu große Liebe zur
Plastik hat und auch genug handwerkliches
Können, um nicht in Schablone zu versanden.
S. (Paris)
5
’i*rg. VI, Nr. 11 vom 13. März 1932
Fortsetzung der Vorberichte von S. 3)
Nonet, Lebourg, Pissarro, Renoir und Vignon,
ferner erlesenstes französisches Mobiliar der
Renaissance und des 18. Jahrhunderts.
Keramik, Möbel
London, Vorb. 17. März
Aus der bekanten Sammlung Mrs. Hornsby-
Drake versteigern C h r i s t i e’s am 17. März
die ausgezeichneten Bestände an Porzellan und
Fayencen, darunter China-Porzellan des
18. Jahrhunderts, Meißener und Venezianer Er-
zeugnisse, sehr schöne italienische und is-
lamische Majoliken und Fayencen. Aus
anderem Besitz ist eine kleine Kollektion erst-
klassiger Chippendale- und Sheraton-Möbel an-
geschlossen.
Landschaftsaquarelle von Kurth von Unruh
und die vielseitigen Aquarell-Impressionen der
Rheinländerin Adda Kess elkaul.
Chagall-Ausstellung
im Haag
Als ersten Versuch einer Neuorientierung
des modernen Kunsthandels in der
holländischen Residenzstadt, wo bisher neben
konservativ-lokalen Ausstellungen nur zufällig
Arbeiten führender zeitgenössischer Künstler
gezeigt wurden, bringt die Galerie E. S u r r e y
eine umfassende Kollektivausstellung von Marc
Chagall. Ausgestellt sind Gemälde und Aqua-
relle von 1908—1931. Einige seiner bekannten
Arbeiten sieht man hier wieder beisammen,
einige interessante Gemälde der Frühzeit ver-
vollständigen den Überblick über das bisher
bekannte Schaffen dieses eigenartigen Künst-
lers. Bemerkenswert ist, daß er in den letzten
beiden Jahren, besonders in den Landschaften
aus Peyra-Cava einen gewissen Realismus
durchzuführen sich bemüht, ohne in motivische
Phantastik einzumünden. Einige Arbeiten
dieser Art wirken durch zu geringes Cha-
rakterisierungsvermögen matt, andere wie ein
„Blumenstilleben“ und ein „Blick aus dem
Fenster“ überraschen durch eine gediegene und
farblich großzügige Artistik. Sie sind weniger
dekorativ als die meisten französischen
Arbeiten dieser Gattung, überragen sie aber
bedeutend durch gleicherweise kultivierten wie
wesenhaften Zuschnitt. O. B.
Aulrfionsnachberichte
Gemälde, Möbel
Wissenschaftliche Expertise
von Kunstwerken
Berlin, Nachb. 4.15. März
(Vorb. in Nr. 8, S. 2)
Von Dr. Fritz Neuga ss, Paris
Die Versteigerung der Sammlung „Dr. E.
W.“ wurde am 4./5. März von Paul Graupe
Und Hermann Ball in ihren neuen Geschäfts-
läumen mit recht gutem Erfolg durchgeführt.
Von den Preisen seien folgende erwähnt:
Gemälde : Nr. 4, eine dem Jan van der
Capelle zugeschriebene Marine: 1300 M.; Nr.
11, Stilleben von Abraham van Beijeren: 6100
Mark; Nr. 24, Stilleben von Jan van Os: 1500
Mark; Nr. 24, zwei Ruinen-Landschaften, Art
des Pannini: 2300 M.; Nr. 28, Landschaft von
Jacob van Strij: 450 M.; Nr. 33 b, Landsknecht-
Szene von Philipp Wouvermann: 630 M.
Möbel: Nr. 69, Paar große französische
Armlehnsessel, 17. Jahrh.: 1850 M.; Nr. 73,
Paar Armlehnsessel, französisch, mit Pointbe-
zügen: 1100 M.; Nr. 80, ein Paar französische
Louis XV-Bergeren: 2200 M.; Nr. 88, französi-
sches Louis XV-Lehnsofa m. Pointbezug: 2100
Mark; Nr. 99, Louis XVI-Kommode: 1050 M.;
Nr. 102, Louis XVI-Lackkommode: 2000 M.
Fayencen : Nr. 217, Paar Delfter Deckel-
Vasen in Farben: 620 M.; Nr. 235, Kieler Wand-
Wassergeschirr: 205 M.; Nr. 239, Potsdamer
Vasen-Satz: 900 M.
Porzellan : Nr. 245, Ein Paar Meißner
Möpse: 1350 M.; Nr. 271, Paar kleine Meißener
Tassen: 170 M.; Nr. 255, Paar Meißener Vasen:
350 M.; Nr. 298, acht Berliner Teller: 600 M.;
Nr. 320, chinesische Balustervase, Familie
Verte: 700 M.; Nr. 328, Paar kleine bleu-pou-
dre-Vasen: 1050 M.; Nr. 332: Paar hohe Fa-
ftiille-Rose-Vasen: 1100 M.
Tapisserien : Nr. 352/53, zwei flämische
Verduren: 2300 M.; Nr. 354, Teniers-Tapisse-
rien: 2500 M.; Nr. 355, Rokoko-Aubusson-Ta-
pisserie: 5800 M.
Silber : Nr. 447, Paar große Weinkühler,
Paris 1770: 8800 M.; Nr. 449, vergoldeter Glä-
serkühler von Auguste: 3500 M.
Golddosen : Nr. 457, Englisches Neces-
saire: 800 M.; Nr. 463, Viereckige Golddose:
2600 M.; Nr. 472, Golddose 1770: 1350 M.; Nr.
478, ovale Golddose: 2200 M.; Nr. 482, Golddose,
Paris 1769: 1800 M.; Nr. 492 bis 497, fünf Li-
hioges-Platten, um 1550: 1000 M.
Bibliothek des
18. Jahrhunderts
Hamburg, Nachb. 9.—10. Febr.
(Vorb. in Nr. 5, S. 3)
Die erste Versteigerung des Buch- und
Kunst-Antiquariats Harry Hirsch
Wenn die „Weltkunst“ heute wieder einmal
das Problem der Expertise berührt, soll damit
nicht von neuem zu einer Diskussion dieses
Themas auf gerufen werden. Wir wollen ledig-
lich unseren Lesern die ungeahnten Möglich-
keiten vorstellen, die durch die neuen optischen
und chemischen Mittel für die Kunstwissen-
schaft gewonnen wurden.
Durch die Überhandnahme der Fälschungen
auf allen Gebieten der Kunst und des Kunst-
Abb. 1.
Vermutliches Bildnis der Margarete von Österreich
von Jacopo de’Barbari
Portrait presume de Marguerite d’Autriche
Presumed portrait of Marguerite of Austria
handwerks — wie auch durch die zahlreichen
Fehlurteile bei der subjektiv empirischen Me-
thode der Stilanalyse — wurde der internatio-
nale Kunstmarkt, bestärkt durch die allge-
meine wirtschaftliche Krise, zu tiefst erschüt-
tert. ‘ ! I • I ! <(V
Da kam die Ausbildung der neuen wissen-
schaftlichen Methoden auf chemischer und phy-
sikalischer Grundlage der Kunstwissenschaft
zu Hilfe und beginnt bereits überall, die Stil-
kritik und die ästhetischen Analysen — wenn
nicht zu verdrängen, so doch durch genaue
sachliche und stoff-
Abb. 3.
Mikroskopische Aufnahme der Materie
. des Goldgrundes.
Microphoto d’un pigment ä base d’or
Microscopic photograph of a gold pigment
Abb. 4.
Mikroskopische Aufnahme von Bleiweiß
(Zu beachten die regelmäß. Krakelüren)
Microphotographie du blanc de plomb
Microscopic photograph of lead white
liehe Erkenntnisse zu
bereichern. Es ist
sicherlich kein Schaden
für die Kunstwissen-
schaft, wenn die neue-
sten technischen Er-
rungenschaften auch
bei ihr Anwendung fin-
den. Dann wird die
Kunstgeschichte wieder
aus ihrem Dämmer-
schlaf erwachen und,
aus neuen Quellen ge-
speist, zu neuen Er-
gebnissenführen. Allein
mit ästhetischen Mit-
teln kann heute nicht
mehr gearbeitet wer-
den, zumal die Fälscher-
kunst jetzt so voll¬
matte einen starken Erfolg. Etwa achtzig Pro-
Vnt des Auktionskataloges wurden glatt auf-
Senommen und die Preise hielten durchaus an-
bändiges Niveau. Der Aristoteles von 1479
bieg von 65,— M. auf 240,— M. Man bezahlte
^00 M. für die Beschreibung von Kalifornien
-s Miquel Venegas von 1739, 110,— M. für
®ln nicht komplettes Exemplar des Zedlerschen
Pniv.-Lexikons, 110,— M. für die Diderotsche
Rncyklopädie in der Quartausgabe. Das Oeuvre
V>n Meissonier brachte 180,— M., der große
Jüiffon wurde bis 100,— M. gesteigert, die
lora Sibirica erzielte 125,— M., die Buffon-
Sche Naturgeschichte der Vögel 100,— M. Erst-
ausgaben deutscher Literatur vermochten keine
'ler)nenswerten Preise zu erzielen.
Jüngere Künstler
. I>er Kunstsalon Gurlitt in Berlin
,'f'Vrte als letzte Ausstellung Gemälde des stark
französischen Spätimpressionismus beein-
Rßten Georg Netzband, ernste und von
jj.'Shndem dekorativem Instinkt getragene
lder von Hanna Bekker vom Rath,
kommen ist, daß selbst
die größten Kapazitäten ihr zum
Opfer fallen. Andrerseits kann eine rein tech-
nische Untersuchung noch keine künstlerische
Expertise ergeben, da weder die Röntgen-, die
Ultraviolett- und die infraroten Strahlen
noch die Spektralanalysen und mikroskopischen
Feststellungen des Malgrundes und der ver-
wendeten Farbstoffe etwas aussagen über den
Meister, die Schule oder die Zeit.
Erst in der Verbindung des Kunsthistori-
kers mit dem Naturwissenschaftler — im wei-
testen Sinne des Wortes — kann heutzutage
eine endgültige Analyse oder sagen wir besser,
um bei dem alten Sprachgebrauch zu bleiben,
„Expertise“ angestellt werden.
Ich habe die eingehende wissenschaftliche
Analyse eines Bildes (Abb. 1) zu meiner Ver-
fügung, die mit den neuesten „technischen“
Mitteln in dem Laboratorium der „S o c i e t e
de Contröle et d’Expertise“ in Paris
angefertigt wurde. Sie sagt nichts aus über den
Künstler und die Kunstrichtung, sondern stellt
lediglich fest, was dem nackten Auge nicht zu-
gänglich und dennoch wesentlich zur Begut-
achtung eines Bilde ist: Auf 28 Seiten Text und
an Hand von 28 Photos werden die charakte¬
ristischen Merkmale aufgezeigt. Es ist nicht
uninteressant, eine solche Expertise einmal
näher zu betrachten, da sie in allen Einzel-
heiten der bisherigen Methode der Stilanalyse
— die jedoch immerhin zur künstlerischen Be-
stimmung des Bildes unbedingt erforderlich
bleibt — geradezu entgegengesetzt ist.
Der ganze Bericht ist in 6 Kapitel auf-
geteilt, in denen jeweils von verschiedenen Ge-
sichtspunkten aus und mit verschiedenen Mit-
teln vorgegangen wird. 1. Die Pinselführung,
d. h. die Handschrift des Künstlers, wird durch
vergrößerte Photographien festgehalten. Wenn
der Stil sich auch wandelt, so bleibt im allge-
meinen die Technik eines Malers sich gleich
und unterscheidet sich wesentlich von der
seiner Schüler und Kopisten, die wohl den
„Stil“, aber nicht die „Handschrift“ über-
nehmen. Bei der mikroskopischen Vergröße-
rung der Oberfläche mit starkem Seitenlicht
kommen spätere Zutaten oder Beschädigungen
klar zum Vorschein.
Abb. 2.
Röntgenphotographie der oberen linken Ecke des Bildes
Radiographie de l’angle superieur gauche du tableau
X-Ray photograph of the left upper Corner of the
picture
2. Die anatomische und mikrochemische
Untersuchung des Malgrundes zeigt uns den
Charakter der Holztafel (Abb. 5) oder der Lein-
wand und ihr ungefähres Alter durch die Ver-
witterung der Zellgewebe.
3. Die Röntgenaufnahmen (Abb. 2) stellen
die Art der Grundierung fest, ob Mineral-
farben oder neue künstliche Farbstoffe ver-
wendet wurden, die der Durchleuchtung ver-
schiedene Dichtigkeit entgegensetzen. Die
schadhaften Stellen können so leicht abgelesen
werden, besonders aber auch die Untermalun-
gen, d. h. die älteren Bilder, die unter der spä-
teren Farbschicht eventuell verborgen sind.
4. Die Spektralanalyse der Farbstoffe und
die mikroskopische Untersuchung (Abb. 3 u. 4)
derselben zeigen die genauen Verbindungen
und Kristallisationen, so daß auch auf diesem
Wege die Materie auf ihre Echtheit und ihr
Alter geprüft werden kann.
Abb. 5.
Schnitt durch den Holzgrund des Bildes
Bois du tableau: coupe — Cut through the wood
(340faehe Vergrößerung)
1. Kanal, verhältnismäßig unbeschädigt
2. Faser, deren Zellen sich von den seitlichen
Membranen losgelöst haben
4. Zerdrückte Fasern
5. Lücke, durch Verwesung der Zellen entstanden
5. Die Betrachtung der Oberfläche unter
ultravioletten Strahlen läßt die verschiedene
Fluoreszenz des Firnis und der Farben er-
kennen. Eine Farbfläche, die bei gewöhnlichem
Licht einheitlich und monochrom erscheint,
wird bei ultraviolettem Licht in ihre einzelnen
Bestandteile aufgelöst, so daß jede spätere
Zutat aus anderem Grundstoff in einer anderen
Tönung fluoresziert. Leichte Übermalungen,
die durch die Röntgenstrahlen nicht erfaßt
werden, treten in diesem Lichte in Erschei-
nung, so daß sich diese beiden Methoden glück-
lich ergänzen. Zu diesen optischen Mitteln tritt
noch als 6. die Untersuchung des Bildes mit
infraroten Strahlen, die ebenfalls die schad-
haften Stellen aufzeigen.
Mit Hilfe dieser Mittel wird es uns heute
möglich, alle Fälschungen und späteren Zu-
taten festzustellen. Der Raum ist leider zu be-
schränkt, um Beispiele von Fälschungen aufzu-
zählen, die durch diese Art der Expertise fest-
gestellt werden konnten, doch möchte ich nicht
versäumen, an dieser Stelle auf den Kongreß-
bericht der römischen Tagung des internatio-
nalen Museumsamtes von 1930 hinzuweisen, der
in dem Doppelheft 13-14 der Zeitschrift „Mou-
seion“ vom Völkerbund herausgegeben wurde,
und alle diese Fragen eingehend behandelt.*)
Weder die Kunstwissenschaft, noch die
großen Museen und nicht zuletzt der Kunst-
handel kann heute diese technischen Hilfs-
mittel entbehren; sie dienen uns zur Bestäti-
gung der stilistischen Merkmale und enthüllen
die Untergründe, die das menschliche Auge
nicht erfassen kann.
*) Es sei hier auch auf eine kleine Schrift
hingewiesen, welche die ganzen technischen Fra-
gen der Expertisen behandelt: Augustin Mache,
Expertise Scientifique des Documents et des
Oeuvres d’Art. Edition Paul Montel, Paris.
All en Ullmann
Es ist schwer, in der Bildhauerei formen-
sprengend zu sein, weil die Plastik immer von
architektonischer Basis ausgehen muß. Alle
raumgestaltenden Tendenzen sind gezwungen,
das plastische Gesetz einzuhalten. Die Ge-
neration vor 1914 versuchte mit Abstraktionen
die Bildhauerei umzugestalten, aber sogar
Archipenko fand nicht den Atem, die plastische
Abstraktion bis zum Ende durchzuführen und
strandete in einer ganz konventionellen Form.
Die französischen Bildhauer von Rodin aus-
gehend, Maillol und Despiau, hielten sich im-
mer von der zu literarischen Metaphysik
zurück und wollten nur gute Bildhauerei
machen. Alle, und auch Allen Ullmann, die in
diese Schule gingen, haben eine Prädestination
zum Plastiker. .Ullmann hat als Architekt be-
gonnen, nachher lernte er bei Ary Bitter. Man
mag sich zu diesem Bildhauer stellen wie man
will, aber es hatte Sinn bei ihm zu lernen, weil
er alle seine Schüler zu allererst auf das hand-
werkliche Können hinwies. Er pflegte zu
sagen: „Talent kann jeder Mensch haben, aber
es kommt darauf an, das Talent zur Sichtbar-
Allen Ullmann, Boxer
keit zu gestalten“. Ullmann, der ein wildes
Temperament hat, ließ sich von seinem Lehrer
soweit beeinflussen, daß er sehr viele Werke
von Michelangelo kopierte, nur um handwerk-
liches Können zu erwerben. Dieser noch junge
Bildhauer reiste viel in Amerika, Spanien und
Italien, aber nicht um dort Aufträge zu er-
gattern, sondern um seine plastische An-
schauung zu erweitern. Man sah bis vor
einigen Jahren sehr wenige Arbeiten von ihm,
weil er fast niemals ausstellte und erst in
letzter Zeit bequemte er sich dazu, seine
Skulpturen auch der Öffentlichkeit zu zeigen,
und es ist sonderbar, daß jetzt, wo es den Bild-
hauern von den bildenden Künstlern am
schlechtesten geht, Ullmann von Aufträgen
überhäuft wird. Die Skala seiner Themenwahl
ist sehr breit, er interessiert sich für Boxer,
sonderbare Tanzformen und sehr viel für
Tiere. Er behandelt sein Thema immer mit
einer temperamentvollen Ironie, so daß man
manchmal im Begriff ist, diese Plastiken für
Karikaturen zu halten. Aber es sind keine
Karikaturen, sondern nur die Beobachtungen
der Rhythmen des Körpers in dem Augenblick,
in dem das Modell sich unbeobachtet fühlt, und
diese Rhythmen werden von diesem Plastiker
noch übersteigert. Es gibt Kunstbetrachter,
die Angst haben, daß Ullmanns plastische
Tendenz zu leicht Routine werden kann, aber
wir, die wir diesen Künstler seit langem beob-
achten, wissen, daß er zu große Liebe zur
Plastik hat und auch genug handwerkliches
Können, um nicht in Schablone zu versanden.
S. (Paris)