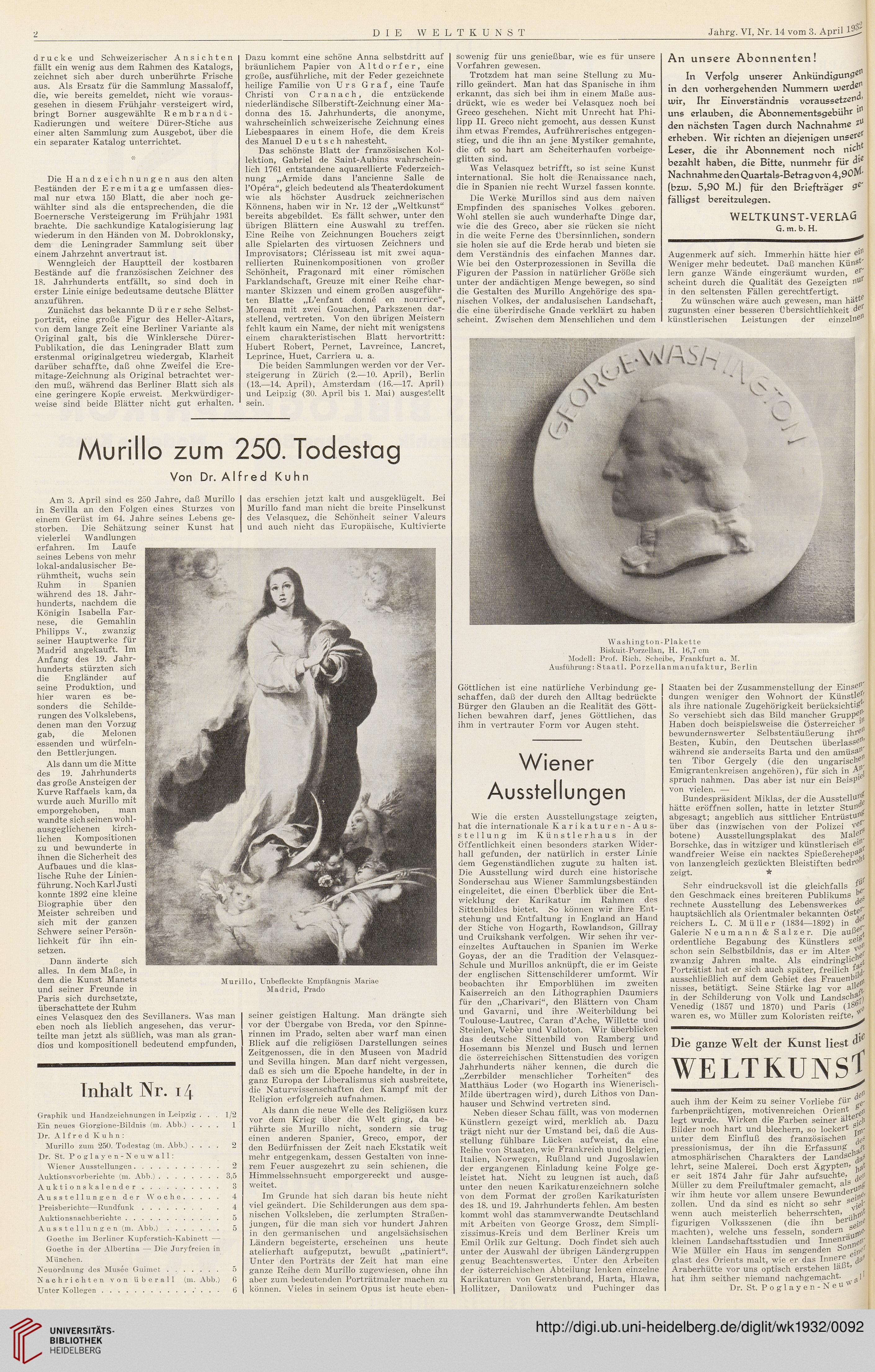2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VI, Nr. 14 vom 3. April
drucke und Schweizerischer Ansichten
fällt ein wenig aus dem Rahmen des Katalogs,
zeichnet sich aber durch unberührte Frische
aus. Als Ersatz für die Sammlung Massaloff,
die, wie bereits gemeldet, nicht wie voraus-
gesehen in diesem Frühjahr versteigert wird,
bringt Borner ausgewählte Rembrandt -
Radierungen und weitere Dürer-Stiche aus
einer alten Sammlung zum Ausgebot, über die
ein separater Katalog unterrichtet.
Die Handzeichnungen aus den alten
Beständen der Eremitage umfassen dies-
mal nur etwa 150 Blatt, die aber noch ge-
wählter sind als die entsprechenden, die die
Boernersche Versteigerung im Frühjahr 1931
brachte. Die sachkundige Katalogisierung lag
wiederum in den Händen von M. Dobroklonsky,
dem die Leningrader Sammlung seit über
einem Jahrzehnt an vertraut ist.
Wenngleich der Hauptteil der kostbaren
Bestände auf die französischen Zeichner des
18. Jahrhunderts entfällt, so sind doch in
erster Linie einige bedeutsame deutsche Blätter
anzuführen.
Zunächst das bekannte Dürer sehe Selbst-
porträt, eine große Figur des Heller-Altars,
von dem lange Zeit eine Berliner Variante als
Original galt, bis die Winklersche Dürer-
Publikation, die das Leningrader Blatt zum
erstenmal originalgetreu wiedergab, Klarheit
darüber schaffte, daß ohne Zweifel die Ere-
mitage-Zeichnung als Original betrachtet wer-
den muß, während das Berliner Blatt sich als
eine geringere Kopie erweist. Merkwürdiger-
weise sind beide Blätter nicht gut erhalten.
Dazu kommt eine schöne Anna selbstdritt auf
bräunlichem Papier von Altdorfer, eine
große, ausführliche, mit der Feder gezeichnete
heilige Familie von Urs Graf, eine Taufe
Christi von Cranach, die entzückende
niederländische Silberstift-Zeichnung einer Ma-
donna des 15. Jahrhunderts, die anonyme,
wahrscheinlich schweizerische Zeichnung eines
Liebespaares in einem Hofe, die dem Kreis
des Manuel Deutsch nahesteht.
Das schönste Blatt der französischen Kol-
lektion, Gabriel de Saint-Aubins wahrschein-
lich 1761 entstandene aquarellierte Federzeich-
nung „Armide dans l’ancienne Salle de
l’Opera“, gleich bedeutend als Theaterdokument
wie als höchster Ausdruck zeichnerischen
Könnens, haben wir in Nr. 12 der „Weltkunst“
bereits abgebildet. Es fällt schwer, unter den
übrigen Blättern eine Auswahl zu treffen.
Eine Reihe von Zeichnungen Bouchers zeigt
alle Spielarten des virtuosen Zeichners und
Improvisators; Clerisseau ist mit zwei aqua-
rellierten Ruinenkompositionen von großer
Schönheit, Fragonard mit einer römischen
Parklandschaft, Greuze mit einer Reihe char-
manter Skizzen und einem großen ausgeführ-
ten Blatte „L’enfant donne en nourrice“,
Moreau mit zwei Gouachen, Parkszenen dar-
stellend, vertreten. Von den übrigen Meistern
fehlt kaum ein Name, der nicht mit wenigstens
einem charakteristischen Blatt hervortritt:
Hubert Robert, Pernet, Lavreince, Lancret,
Leprince, Huet, Carriera u. a.
Die beiden Sammlungen werden vor der Ver-
steigerung in Zürich (2.—10. April), Berlin
(13.—14. April), Amsterdam (16.—17. April)
und Leipzig (30. April bis 1. Mai) ausgestellt
sein.
Murillo zum 250. Todestag
Von Dr. Alfred Kuhn
Am 3. April sind es 250 Jahre, daß Murillo
in Sevilla an den Folgen eines Sturzes von
einem Gerüst im 64. Jahre seines Lebens ge-
storben. Die Schätzung seiner Kunst hat
vielerlei Wandlungen
erfahren. Im Laufe
seines Lebens von mehr
lokal-andalusischer Be-
rühmtheit, wuchs sein
Ruhm in Spanien
während des 18. Jahr¬
hunderts, nachdem die
Königin Isabella Far¬
nese, die Gemahlin
Philipps V., zwanzig
seiner Hauptwerke für
Madrid angekauft. Im
Anfang des 19. Jahr¬
hunderts stürzten sich
die Engländer auf
seine Produktion, und
hier waren es be¬
sonders die Schilde¬
rungen des Volkslebens,
denen man den Vorzug
gab, die Melonen
essenden und würfeln-
den Bettlerjungen.
Als dann um die Mitte
des 19. Jahrhunderts
das große Ansteigen der
Kurve Raffaels kam, da
wurde auch Murillo mit
emporgehoben, man
wandte sichseineniwohl-
ausgeglichenen kirch¬
lichen Kompositionen
zu und bewunderte in
ihnen die Sicherheit des
Aufbaues und die klas-
lische Ruhe der Linien¬
führung. N och Karl Justi
konnte 1892 eine kleine
Biographie über den
Meister schreiben und
sich mit der ganzen
Schwere seiner Persön¬
lichkeit für ihn ein-
setzen.
Dann änderte sich
alles. In dem Maße, in
dem die Kunst Manets
und seiner Freunde in
Paris sich durchsetzte,
überschattete der Ruhm
eines Velasquez den des Sevillaners. Was man
eben noch als lieblich angesehen, das verur-
teilte man jetzt als süßlich, was man als gran-
dios und kompositionell bedeutend empfunden,
Inhalt Nr. 14
Graphik und Handzeichnungen in Leipzig . . . 1/2
Ein neues Giorgione-Bildnis (m. Abb.) .... 1
Dr. Alfred Kuhn:
Murillo zum 250. Todestag (m. Abb.) .... 2
Dr. St. Poglayen-Neuwall:
Wiener Ausstellungen. 2
Auktionsvorberichte (m. Abb.).3,5
Auktionskalender. 3
Ausstellungen der Woche. 4
Preisberichte—Rundfunk. 4
Auktionsnachberichte. 5
Ausstellungen (m. Abb.). . 5
Goethe im Berliner Kupferstich-Kabinett —
Goethe in der Albertina — Die Juryfreien in
München.
Neuordnung des Musee Guimet . .. 5
Nachrichten von überall (m. Abb.) 6
Unter Kollegen. . - 6
das erschien jetzt kalt und ausgeklügelt. Bei
Murillo fand man nicht die breite Pinselkunst
des Velasquez, die Schönheit seiner Valeurs
und auch nicht das Europäische, Kultivierte
seiner geistigen Haltung. Man drängte sich
vor der Übergabe von Breda, vor den Spinne-
rinnen im Prado, selten aber warf man einen
Blick auf die religiösen Darstellungen seines
Zeitgenossen, die in den Museen von Madrid
und Sevilla hingen. Man darf nicht vergessen,
daß es sich um die Epoche handelte, in der in
ganz Europa der Liberalismus sich ausbreitete,
die Naturwissenschaften den Kampf mit der
Religion erfolgreich aufnahmen.
Als dann die neue Welle des Religiösen kurz
vor dem Krieg über die Welt ging, da be-
rührte sie Murillo nicht, sondern sie trug
einen anderen Spanier, Greco, empor, der
den Bedürfnissen der Zeit nach Ekstatik weit
mehr entgegenkam, dessen Gestalten von inne-
rem Feuer ausgezehrt zu sein schienen, die
Himmelssehnsucht emporgereckt und ausge-
weitet.
Im Grunde hat sich daran bis heute nicht
viel geändert. Die Schilderungen aus dem spa-
nischen Volksleben, die zerlumpten Straßen-
jungen, für die man sich vor hundert Jahren
in den germanischen und angelsächsischen
Ländern begeisterte, erscheinen uns heute
atelierhaft aufgeputzt, bewußt „patiniert“.
Unter den Porträts der Zeit hat man eine
ganze Reihe dem Murillo zugewiesen, ohne ihn
aber zum bedeutenden Porträtmaler machen zu
können. Vieles in seinem Opus ist heute eben-
Murillo, Unbefleckte Empfängnis Mariae
Madrid, Prado
sowenig für uns genießbar, wie es für unsere
Vorfahren gewesen.
Trotzdem hat man seine Stellung zu Mu-
rillo geändert. Man hat das Spanische in ihm
erkannt, das sich bei ihm in einem Maße aus-
drückt, wie es weder bei Velasquez noch bei
Greco geschehen. Nicht mit Unrecht hat Phi-
lipp II. Greco nicht gemocht, aus dessen Kunst
ihm etwas Fremdes, Aufrührerisches entgegen-
stieg, und die ihn an jene Mystiker gemahnte,
die oft so hart am Scheiterhaufen vorbeige-
glitten sind.
Was Velasquez betrifft, so ist seine Kunst
international. Sie holt die Renaissance nach,
die in Spanien nie recht Wurzel fassen konnte.
Die Werke Murillos sind aus dem naiven
Empfinden des spanisches Volkes geboren.
Wohl stellen sie auch wunderhafte Dinge dar,
wie die des Greco, aber sie rücken sie nicht
in die weite Ferne des Übersinnlichen, sondern
sie holen sie auf die Erde herab und bieten sie
dem Verständnis des einfachen Mannes dar.
Wie bei den Osterprozessionen in Sevilla die
Figuren der Passion in natürlicher Größe sich
unter der andächtigen Menge bewegen, so sind
die Gestalten des Murillo Angehörige des spa-
nischen Volkes, der andalusischen Landschaft,
die eine überirdische Gnade verklärt zu haben
scheint. Zwischen dem Menschlichen und dem
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündigung*1
in den vorhergehenden Nummern tuerd^i*
wir, Ihr Einverständnis voraussetzend»
uns erlauben, die Abonnementsgebühr '**
den nächsten Tagen durch Nachnahme ztI
erheben. Wir richten an diejenigen unser2*
Leser, die ihr Abonnement noch nic^
bezahlt haben, die Bitte, nunmehr für
Nachnahme den Quartals-Betrag von 4,90M'
(bzu). 5,90 M.) für den Briefträger Se'
fäUigst bereitzulegen.
WELTKUNST-VERLAG
G.m. b. H.
Augenmerk auf sich. Immerhin hätte hier ei'*
Weniger mehr bedeutet. Daß manchen KünS*'
lern ganze Wände eingeräumt wurden, e*j
scheint durch die Qualität des Gezeigten r111
in den seltensten Fällen gerechtfertigt.
Zu wünschen wäre auch gewesen, man hat**
zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit de*
künstlerischen Leistungen der einzeln®’’
Washington-Plakette
Biskuit-Porzellan, H. 16,7 cm
Modell: Prof. Rich. Scheibe, Frankfurt a. M.
Ausführung: Staat 1. Porzellanmanufaktur, Berlin
Göttlichen ist eine natürliche Verbindung ge-
schaffen, daß der durch den Alltag bedrückte
Bürger den Glauben an die Realität des Gött-
lichen bewahren darf, jenes Göttlichen, das
ihm in vertrauter Form vor Augen steht.
Wiener
Ausstellungen
Wie die ersten Ausstellungstage zeigten,
hat die internationale Karikaturen- Aus-
stellung im Künstlerhaus in der
Öffentlichkeit einen besonders starken Wider-
hall gefunden, der natürlich in erster Linie
dem Gegenständlichen zugute zu halten ist.
Die Ausstellung wird durch eine historische
Sonderschau aus Wiener Sammlungsbeständen
eingeleitet, die einen Überblick über die Ent-
wicklung der Karikatur im Rahmen des
Sittenbildes bietet. So können wir ihre Ent-
stehung und Entfaltung in England an Hand
der Stiche von Hogarth, Rowlandson, Gillray
und Cruikshank verfolgen. Wir sehen ihr ver-
einzeltes Auftauchen in Spanien im Werke
Goyas, der an die Tradition der Velasquez-
Schule und Murillos anknüpft, die er im Geiste
der englischen Sittenschilderer umformt. Wir
beobachten ihr Emporblühen im zweiten
Kaiserreich an den Lithographien Daumiers
für den „Charivari“, den Blättern von Cham
und Gavarni, und ihre Weiterbildung bei
Toulouse-Lautrec, Caran d’Ache, Willette und
Steinlen, Veber und Valloton. Wir überblicken
das deutsche Sittenbild von Ramberg und
Hosemann bis Menzel und Busch und lernen
die österreichischen Sittenstudien des vorigen
Jahrhunderts näher kennen, die durch die
„Zerrbilder menschlicher Torheiten“ des
Matthäus Loder (wo Hogarth ins Wienerisch-
Milde übertragen wird), durch Lithos von Dan-
hauser und Schwind vertreten sind.
Neben dieser Schau fällt, was von modernen
Künstlern gezeigt wird, merklich ab. Dazu
trägt nicht nur der Umstand bei, daß die Aus-
stellung fühlbare Lücken aufweist, da eine
Reihe von Staaten, wie Frankreich und Belgien,
Italien, Norwegen, Rußland und Jugoslawien
der ergangenen Einladung keine Folge ge-
leistet hat. Nicht zu leugnen ist auch, daß
unter den neuen Karikaturenzeichnern solche
von dem Format der großen Karikaturisten
des 18. und 19. Jahrhunderts fehlen. Am besten
kommt wohl das stammverwandte Deutschland
mit Arbeiten von George Grosz, dem Simpli-
zissimus-Kreis und dem Berliner Kreis um
Emil Orlik zur Geltung. Doch findet sich auch
unter der Auswahl der übrigen Ländergruppen
genug Beachtenswertes. Unter den Arbeiten
der österreichischen Abteilung lenken einzelne
Karikaturen von Gerstenbrand, Harta, Hlawa,
Hollitzer, Danilowatz und Puchinger das
Staaten bei der Zusammenstellung der EinSeI*
düngen weniger den Wohnort der Künstle*'
als ihre nationale Zugehörigkeit berücksichtig
So verschiebt sich das Bild mancher Grupp®!1
Haben doch beispielsweise die Österreicher *'
bewundernswerter Selbstentäußerung ihr®1
Besten, Kubin, den Deutschen überlass®11'
während sie anderseits Barta und den amüsa*1'
ten Tibor Gergely (die den ungarisch®,
Emigrantenkreisen angehören), für sich in A”|
spruch nahmen. Das aber ist nur ein Beisp’1
von vielen. —
Bundespräsident Miklas, der die Ausstell11'!*
hätte eröffnen sollen, hatte in letzter Stüh®,
abgesagt; angeblich aus sittlicher Entrüstu'1*
über das (inzwischen von der Polizei v®
botene) Ausstellungsplakat des Mal®*,
Borschke, das in witziger und künstlerisch ei’*
wandfreier Weise ein nacktes Spießerehep3^
von lanzengleich gezückten Bleistiften bedr®’’
zeigt. *
Sehr eindrucksvoll ist die gleichfalls
den Geschmack eines breiteren Publikums *’ s
rechnete Ausstellung des Lebenswerkes ® „
hauptsächlich als Orientmaler bekannten Öst® (
reichers L. C. Müller (1834—1892) in
Galerie Neumann & Salzer. Die auß®*j
ordentliche Begabung des Künstlers Z® ,,
schon sein Selbstbildnis, das er im Alter- 'L
zwanzig Jahren malte. Als eindringliche
Porträtist hat er sich auch später, freilich i'.’jj,
ausschließlich auf dem Gebiet des Frauenb’1^
nisses, betätigt. Seine Stärke lag vor
in der Schilderung von Volk und Landsch#;
Venedig (1857 und 1870) und Paris (18S
w^ei^s^woMüllerzumKoloristenreifte^^
Die ganze Welt der Kunst liest
WELTKUNSj
- d®**
auch ihm der Keim zu seiner Vorliebe für
farbenprächtigen, motivenreichen Orient
legt wurde. Wirken die Farben seiner ältcUjj
Bilder noch hart und blechern, so lockert ® .
unter dem Einfluß des französischen *ies
pressionismus, der ihn die Erfassung
atmosphärischen Charakters der Landsc*1^
lehrt, seine Malerei. Doch erst Ägypten»
er seit 1874 Jahr für Jahr auf suchte, jeji
Müller zu dem Freiluftmaler gemacht, als
wir ihm heute vor allem unsere Bewunde1.^,
zollen. Und da sind es nicht so sehr
wenn auch meisterlich beherrschten,
figurigen Volksszenen (die ihn i’e’Pgjli®
machten), welche uns fesseln, sondern
kleinen Landschaftsstudien und Innenra
Wie Müller ein Haus im sengenden ®01gjii®*
glast des Orients malt, wie er das Inner®
Araberhütte vor uns optisch erstehen laß ’
hat ihm seither niemand nachgemacht. p
Dr. St. Poglayen-N®u"
DIE WELTKUNST
Jahrg. VI, Nr. 14 vom 3. April
drucke und Schweizerischer Ansichten
fällt ein wenig aus dem Rahmen des Katalogs,
zeichnet sich aber durch unberührte Frische
aus. Als Ersatz für die Sammlung Massaloff,
die, wie bereits gemeldet, nicht wie voraus-
gesehen in diesem Frühjahr versteigert wird,
bringt Borner ausgewählte Rembrandt -
Radierungen und weitere Dürer-Stiche aus
einer alten Sammlung zum Ausgebot, über die
ein separater Katalog unterrichtet.
Die Handzeichnungen aus den alten
Beständen der Eremitage umfassen dies-
mal nur etwa 150 Blatt, die aber noch ge-
wählter sind als die entsprechenden, die die
Boernersche Versteigerung im Frühjahr 1931
brachte. Die sachkundige Katalogisierung lag
wiederum in den Händen von M. Dobroklonsky,
dem die Leningrader Sammlung seit über
einem Jahrzehnt an vertraut ist.
Wenngleich der Hauptteil der kostbaren
Bestände auf die französischen Zeichner des
18. Jahrhunderts entfällt, so sind doch in
erster Linie einige bedeutsame deutsche Blätter
anzuführen.
Zunächst das bekannte Dürer sehe Selbst-
porträt, eine große Figur des Heller-Altars,
von dem lange Zeit eine Berliner Variante als
Original galt, bis die Winklersche Dürer-
Publikation, die das Leningrader Blatt zum
erstenmal originalgetreu wiedergab, Klarheit
darüber schaffte, daß ohne Zweifel die Ere-
mitage-Zeichnung als Original betrachtet wer-
den muß, während das Berliner Blatt sich als
eine geringere Kopie erweist. Merkwürdiger-
weise sind beide Blätter nicht gut erhalten.
Dazu kommt eine schöne Anna selbstdritt auf
bräunlichem Papier von Altdorfer, eine
große, ausführliche, mit der Feder gezeichnete
heilige Familie von Urs Graf, eine Taufe
Christi von Cranach, die entzückende
niederländische Silberstift-Zeichnung einer Ma-
donna des 15. Jahrhunderts, die anonyme,
wahrscheinlich schweizerische Zeichnung eines
Liebespaares in einem Hofe, die dem Kreis
des Manuel Deutsch nahesteht.
Das schönste Blatt der französischen Kol-
lektion, Gabriel de Saint-Aubins wahrschein-
lich 1761 entstandene aquarellierte Federzeich-
nung „Armide dans l’ancienne Salle de
l’Opera“, gleich bedeutend als Theaterdokument
wie als höchster Ausdruck zeichnerischen
Könnens, haben wir in Nr. 12 der „Weltkunst“
bereits abgebildet. Es fällt schwer, unter den
übrigen Blättern eine Auswahl zu treffen.
Eine Reihe von Zeichnungen Bouchers zeigt
alle Spielarten des virtuosen Zeichners und
Improvisators; Clerisseau ist mit zwei aqua-
rellierten Ruinenkompositionen von großer
Schönheit, Fragonard mit einer römischen
Parklandschaft, Greuze mit einer Reihe char-
manter Skizzen und einem großen ausgeführ-
ten Blatte „L’enfant donne en nourrice“,
Moreau mit zwei Gouachen, Parkszenen dar-
stellend, vertreten. Von den übrigen Meistern
fehlt kaum ein Name, der nicht mit wenigstens
einem charakteristischen Blatt hervortritt:
Hubert Robert, Pernet, Lavreince, Lancret,
Leprince, Huet, Carriera u. a.
Die beiden Sammlungen werden vor der Ver-
steigerung in Zürich (2.—10. April), Berlin
(13.—14. April), Amsterdam (16.—17. April)
und Leipzig (30. April bis 1. Mai) ausgestellt
sein.
Murillo zum 250. Todestag
Von Dr. Alfred Kuhn
Am 3. April sind es 250 Jahre, daß Murillo
in Sevilla an den Folgen eines Sturzes von
einem Gerüst im 64. Jahre seines Lebens ge-
storben. Die Schätzung seiner Kunst hat
vielerlei Wandlungen
erfahren. Im Laufe
seines Lebens von mehr
lokal-andalusischer Be-
rühmtheit, wuchs sein
Ruhm in Spanien
während des 18. Jahr¬
hunderts, nachdem die
Königin Isabella Far¬
nese, die Gemahlin
Philipps V., zwanzig
seiner Hauptwerke für
Madrid angekauft. Im
Anfang des 19. Jahr¬
hunderts stürzten sich
die Engländer auf
seine Produktion, und
hier waren es be¬
sonders die Schilde¬
rungen des Volkslebens,
denen man den Vorzug
gab, die Melonen
essenden und würfeln-
den Bettlerjungen.
Als dann um die Mitte
des 19. Jahrhunderts
das große Ansteigen der
Kurve Raffaels kam, da
wurde auch Murillo mit
emporgehoben, man
wandte sichseineniwohl-
ausgeglichenen kirch¬
lichen Kompositionen
zu und bewunderte in
ihnen die Sicherheit des
Aufbaues und die klas-
lische Ruhe der Linien¬
führung. N och Karl Justi
konnte 1892 eine kleine
Biographie über den
Meister schreiben und
sich mit der ganzen
Schwere seiner Persön¬
lichkeit für ihn ein-
setzen.
Dann änderte sich
alles. In dem Maße, in
dem die Kunst Manets
und seiner Freunde in
Paris sich durchsetzte,
überschattete der Ruhm
eines Velasquez den des Sevillaners. Was man
eben noch als lieblich angesehen, das verur-
teilte man jetzt als süßlich, was man als gran-
dios und kompositionell bedeutend empfunden,
Inhalt Nr. 14
Graphik und Handzeichnungen in Leipzig . . . 1/2
Ein neues Giorgione-Bildnis (m. Abb.) .... 1
Dr. Alfred Kuhn:
Murillo zum 250. Todestag (m. Abb.) .... 2
Dr. St. Poglayen-Neuwall:
Wiener Ausstellungen. 2
Auktionsvorberichte (m. Abb.).3,5
Auktionskalender. 3
Ausstellungen der Woche. 4
Preisberichte—Rundfunk. 4
Auktionsnachberichte. 5
Ausstellungen (m. Abb.). . 5
Goethe im Berliner Kupferstich-Kabinett —
Goethe in der Albertina — Die Juryfreien in
München.
Neuordnung des Musee Guimet . .. 5
Nachrichten von überall (m. Abb.) 6
Unter Kollegen. . - 6
das erschien jetzt kalt und ausgeklügelt. Bei
Murillo fand man nicht die breite Pinselkunst
des Velasquez, die Schönheit seiner Valeurs
und auch nicht das Europäische, Kultivierte
seiner geistigen Haltung. Man drängte sich
vor der Übergabe von Breda, vor den Spinne-
rinnen im Prado, selten aber warf man einen
Blick auf die religiösen Darstellungen seines
Zeitgenossen, die in den Museen von Madrid
und Sevilla hingen. Man darf nicht vergessen,
daß es sich um die Epoche handelte, in der in
ganz Europa der Liberalismus sich ausbreitete,
die Naturwissenschaften den Kampf mit der
Religion erfolgreich aufnahmen.
Als dann die neue Welle des Religiösen kurz
vor dem Krieg über die Welt ging, da be-
rührte sie Murillo nicht, sondern sie trug
einen anderen Spanier, Greco, empor, der
den Bedürfnissen der Zeit nach Ekstatik weit
mehr entgegenkam, dessen Gestalten von inne-
rem Feuer ausgezehrt zu sein schienen, die
Himmelssehnsucht emporgereckt und ausge-
weitet.
Im Grunde hat sich daran bis heute nicht
viel geändert. Die Schilderungen aus dem spa-
nischen Volksleben, die zerlumpten Straßen-
jungen, für die man sich vor hundert Jahren
in den germanischen und angelsächsischen
Ländern begeisterte, erscheinen uns heute
atelierhaft aufgeputzt, bewußt „patiniert“.
Unter den Porträts der Zeit hat man eine
ganze Reihe dem Murillo zugewiesen, ohne ihn
aber zum bedeutenden Porträtmaler machen zu
können. Vieles in seinem Opus ist heute eben-
Murillo, Unbefleckte Empfängnis Mariae
Madrid, Prado
sowenig für uns genießbar, wie es für unsere
Vorfahren gewesen.
Trotzdem hat man seine Stellung zu Mu-
rillo geändert. Man hat das Spanische in ihm
erkannt, das sich bei ihm in einem Maße aus-
drückt, wie es weder bei Velasquez noch bei
Greco geschehen. Nicht mit Unrecht hat Phi-
lipp II. Greco nicht gemocht, aus dessen Kunst
ihm etwas Fremdes, Aufrührerisches entgegen-
stieg, und die ihn an jene Mystiker gemahnte,
die oft so hart am Scheiterhaufen vorbeige-
glitten sind.
Was Velasquez betrifft, so ist seine Kunst
international. Sie holt die Renaissance nach,
die in Spanien nie recht Wurzel fassen konnte.
Die Werke Murillos sind aus dem naiven
Empfinden des spanisches Volkes geboren.
Wohl stellen sie auch wunderhafte Dinge dar,
wie die des Greco, aber sie rücken sie nicht
in die weite Ferne des Übersinnlichen, sondern
sie holen sie auf die Erde herab und bieten sie
dem Verständnis des einfachen Mannes dar.
Wie bei den Osterprozessionen in Sevilla die
Figuren der Passion in natürlicher Größe sich
unter der andächtigen Menge bewegen, so sind
die Gestalten des Murillo Angehörige des spa-
nischen Volkes, der andalusischen Landschaft,
die eine überirdische Gnade verklärt zu haben
scheint. Zwischen dem Menschlichen und dem
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündigung*1
in den vorhergehenden Nummern tuerd^i*
wir, Ihr Einverständnis voraussetzend»
uns erlauben, die Abonnementsgebühr '**
den nächsten Tagen durch Nachnahme ztI
erheben. Wir richten an diejenigen unser2*
Leser, die ihr Abonnement noch nic^
bezahlt haben, die Bitte, nunmehr für
Nachnahme den Quartals-Betrag von 4,90M'
(bzu). 5,90 M.) für den Briefträger Se'
fäUigst bereitzulegen.
WELTKUNST-VERLAG
G.m. b. H.
Augenmerk auf sich. Immerhin hätte hier ei'*
Weniger mehr bedeutet. Daß manchen KünS*'
lern ganze Wände eingeräumt wurden, e*j
scheint durch die Qualität des Gezeigten r111
in den seltensten Fällen gerechtfertigt.
Zu wünschen wäre auch gewesen, man hat**
zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit de*
künstlerischen Leistungen der einzeln®’’
Washington-Plakette
Biskuit-Porzellan, H. 16,7 cm
Modell: Prof. Rich. Scheibe, Frankfurt a. M.
Ausführung: Staat 1. Porzellanmanufaktur, Berlin
Göttlichen ist eine natürliche Verbindung ge-
schaffen, daß der durch den Alltag bedrückte
Bürger den Glauben an die Realität des Gött-
lichen bewahren darf, jenes Göttlichen, das
ihm in vertrauter Form vor Augen steht.
Wiener
Ausstellungen
Wie die ersten Ausstellungstage zeigten,
hat die internationale Karikaturen- Aus-
stellung im Künstlerhaus in der
Öffentlichkeit einen besonders starken Wider-
hall gefunden, der natürlich in erster Linie
dem Gegenständlichen zugute zu halten ist.
Die Ausstellung wird durch eine historische
Sonderschau aus Wiener Sammlungsbeständen
eingeleitet, die einen Überblick über die Ent-
wicklung der Karikatur im Rahmen des
Sittenbildes bietet. So können wir ihre Ent-
stehung und Entfaltung in England an Hand
der Stiche von Hogarth, Rowlandson, Gillray
und Cruikshank verfolgen. Wir sehen ihr ver-
einzeltes Auftauchen in Spanien im Werke
Goyas, der an die Tradition der Velasquez-
Schule und Murillos anknüpft, die er im Geiste
der englischen Sittenschilderer umformt. Wir
beobachten ihr Emporblühen im zweiten
Kaiserreich an den Lithographien Daumiers
für den „Charivari“, den Blättern von Cham
und Gavarni, und ihre Weiterbildung bei
Toulouse-Lautrec, Caran d’Ache, Willette und
Steinlen, Veber und Valloton. Wir überblicken
das deutsche Sittenbild von Ramberg und
Hosemann bis Menzel und Busch und lernen
die österreichischen Sittenstudien des vorigen
Jahrhunderts näher kennen, die durch die
„Zerrbilder menschlicher Torheiten“ des
Matthäus Loder (wo Hogarth ins Wienerisch-
Milde übertragen wird), durch Lithos von Dan-
hauser und Schwind vertreten sind.
Neben dieser Schau fällt, was von modernen
Künstlern gezeigt wird, merklich ab. Dazu
trägt nicht nur der Umstand bei, daß die Aus-
stellung fühlbare Lücken aufweist, da eine
Reihe von Staaten, wie Frankreich und Belgien,
Italien, Norwegen, Rußland und Jugoslawien
der ergangenen Einladung keine Folge ge-
leistet hat. Nicht zu leugnen ist auch, daß
unter den neuen Karikaturenzeichnern solche
von dem Format der großen Karikaturisten
des 18. und 19. Jahrhunderts fehlen. Am besten
kommt wohl das stammverwandte Deutschland
mit Arbeiten von George Grosz, dem Simpli-
zissimus-Kreis und dem Berliner Kreis um
Emil Orlik zur Geltung. Doch findet sich auch
unter der Auswahl der übrigen Ländergruppen
genug Beachtenswertes. Unter den Arbeiten
der österreichischen Abteilung lenken einzelne
Karikaturen von Gerstenbrand, Harta, Hlawa,
Hollitzer, Danilowatz und Puchinger das
Staaten bei der Zusammenstellung der EinSeI*
düngen weniger den Wohnort der Künstle*'
als ihre nationale Zugehörigkeit berücksichtig
So verschiebt sich das Bild mancher Grupp®!1
Haben doch beispielsweise die Österreicher *'
bewundernswerter Selbstentäußerung ihr®1
Besten, Kubin, den Deutschen überlass®11'
während sie anderseits Barta und den amüsa*1'
ten Tibor Gergely (die den ungarisch®,
Emigrantenkreisen angehören), für sich in A”|
spruch nahmen. Das aber ist nur ein Beisp’1
von vielen. —
Bundespräsident Miklas, der die Ausstell11'!*
hätte eröffnen sollen, hatte in letzter Stüh®,
abgesagt; angeblich aus sittlicher Entrüstu'1*
über das (inzwischen von der Polizei v®
botene) Ausstellungsplakat des Mal®*,
Borschke, das in witziger und künstlerisch ei’*
wandfreier Weise ein nacktes Spießerehep3^
von lanzengleich gezückten Bleistiften bedr®’’
zeigt. *
Sehr eindrucksvoll ist die gleichfalls
den Geschmack eines breiteren Publikums *’ s
rechnete Ausstellung des Lebenswerkes ® „
hauptsächlich als Orientmaler bekannten Öst® (
reichers L. C. Müller (1834—1892) in
Galerie Neumann & Salzer. Die auß®*j
ordentliche Begabung des Künstlers Z® ,,
schon sein Selbstbildnis, das er im Alter- 'L
zwanzig Jahren malte. Als eindringliche
Porträtist hat er sich auch später, freilich i'.’jj,
ausschließlich auf dem Gebiet des Frauenb’1^
nisses, betätigt. Seine Stärke lag vor
in der Schilderung von Volk und Landsch#;
Venedig (1857 und 1870) und Paris (18S
w^ei^s^woMüllerzumKoloristenreifte^^
Die ganze Welt der Kunst liest
WELTKUNSj
- d®**
auch ihm der Keim zu seiner Vorliebe für
farbenprächtigen, motivenreichen Orient
legt wurde. Wirken die Farben seiner ältcUjj
Bilder noch hart und blechern, so lockert ® .
unter dem Einfluß des französischen *ies
pressionismus, der ihn die Erfassung
atmosphärischen Charakters der Landsc*1^
lehrt, seine Malerei. Doch erst Ägypten»
er seit 1874 Jahr für Jahr auf suchte, jeji
Müller zu dem Freiluftmaler gemacht, als
wir ihm heute vor allem unsere Bewunde1.^,
zollen. Und da sind es nicht so sehr
wenn auch meisterlich beherrschten,
figurigen Volksszenen (die ihn i’e’Pgjli®
machten), welche uns fesseln, sondern
kleinen Landschaftsstudien und Innenra
Wie Müller ein Haus im sengenden ®01gjii®*
glast des Orients malt, wie er das Inner®
Araberhütte vor uns optisch erstehen laß ’
hat ihm seither niemand nachgemacht. p
Dr. St. Poglayen-N®u"