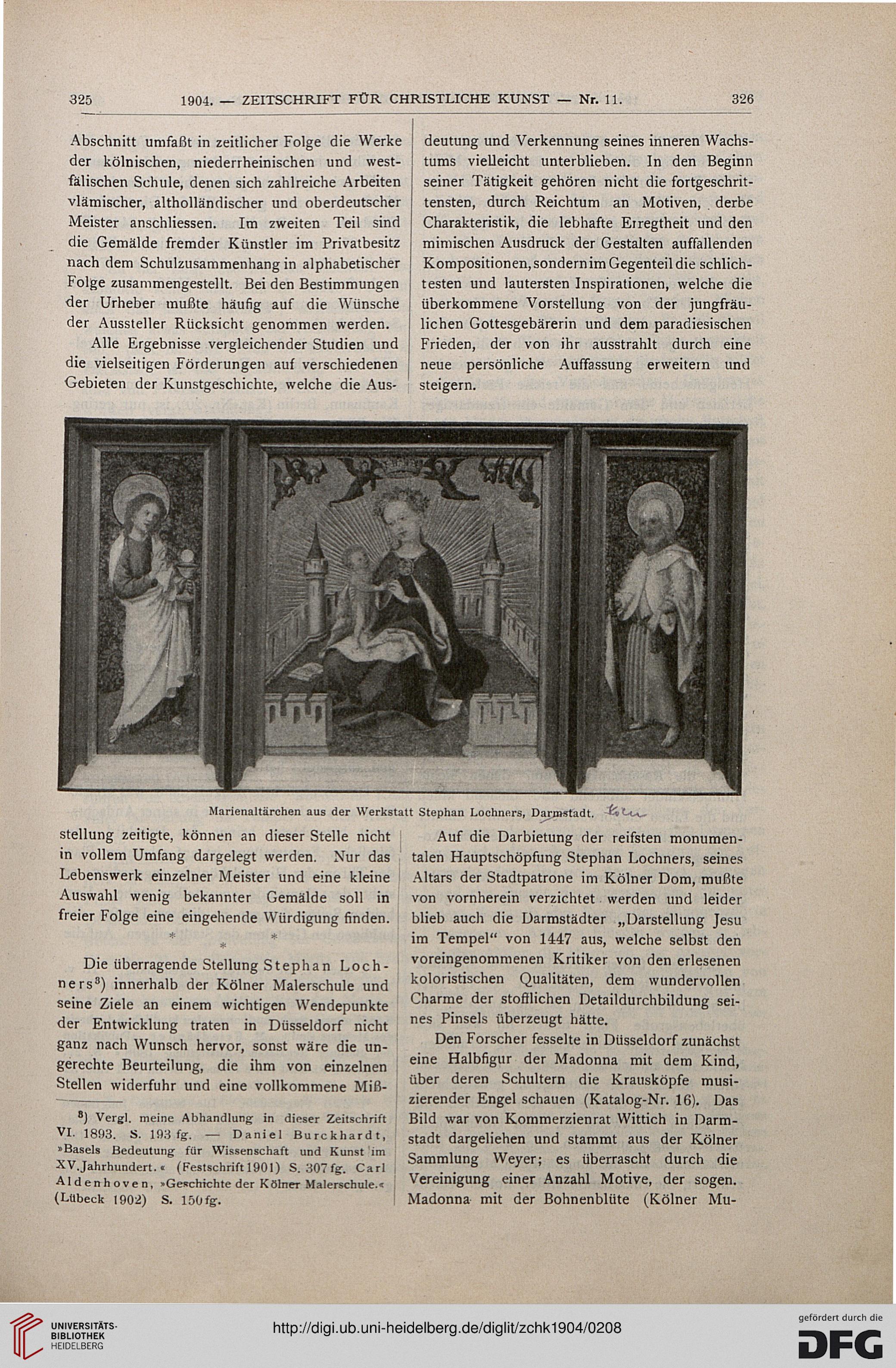325
1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
326
Abschnitt umfaßt in zeitlicher Folge die Werke
der kölnischen, niederrheinischen und west-
fälischen Schule, denen sich zahlreiche Arbeiten
vlämischer, altholländischer und oberdeutscher
Meister anschliessen. Im zweiten Teil sind
die Gemälde fremder Künstler im Privatbesitz
nach dem Schulzusammenhang in alphabetischer
Folge zusammengestellt. Bei den Bestimmungen
der Urheber mußte häufig auf die Wünsche
der Aussteller Rücksicht genommen werden.
Alle Ergebnisse vergleichender Studien und
die vielseitigen Förderungen auf verschiedenen
Gebieten der Kunstgeschichte, welche die Aus-
deutung und Verkennung seines inneren Wachs-
tums vielleicht unterblieben. In den Beginn
seiner Tätigkeit gehören nicht die fortgeschrit-
tensten, durch Reichtum an Motiven, derbe
Charakteristik, die lebhafte Erregtheit und den
mimischen Ausdruck der Gestalten auffallenden
Kompositionen, sondern im Gegenteil die schlich-
testen und lautersten Inspirationen, welche die
überkommene Vorstellung von der jungfräu-
lichen Gottesgebärerin und dem paradiesischen
Frieden, der von ihr ausstrahlt durch eine
neue persönliche Auffassung erweitern und
steigern.
Marienaltärchen aus der Werkstatt Stephan Lochners, Darmstadt. ^*>U^,
Stellung zeitigte, können an dieser Stelle nicht
in vollem Umfang dargelegt werden. Nur das
Lebenswerk einzelner Meister und eine kleine
Auswahl wenig bekannter Gemälde soll in
freier Folge eine eingehende Würdigung finden.
Die überragende Stellung Stephan Loch-
ners8) innerhalb der Kölner Malerschule und
seine Ziele an einem wichtigen Wendepunkte
der Entwicklung traten in Düsseldorf nicht
ganz nach Wunsch hervor, sonst wäre die un-
gerechte Beurteilung, die ihm von einzelnen
Stellen widerfuhr und eine vollkommene Miß-
8) Vergl. meine Abhandlung in dieser Zeitschrift
VI. 1893. S. 193 fg. — Daniel Burckhardt,
»Basels Bedeutung für Wissenschaft und Kunst im
XVJahrhundert.« (Festschrift 1901) S. 307fg. Carl
Aldenhoven, »Geschichte der Kölner Malerschule.«
(Lübeck 1902) S. 150 fg.
Auf die Darbietung der reifsten monumen-
talen Hauptschöpfung Stephan Lochners, seines
Altars der Stadtpatrone im Kölner Dom, mußte
von vornherein verzichtet werden und leider
blieb auch die Darmstädter „Darstellung Jesu
im Tempel" von 1447 aus, welche selbst den
voreingenommenen Kritiker von den erlesenen
koloristischen Qualitäten, dem wundervollen
Charme der stofflichen Detaildurchbildung sei-
nes Pinsels überzeugt hätte.
Den Forscher fesselte in Düsseldorf zunächst
eine Halbfigur der Madonna mit dem Kind,
über deren Schultern die Krausköpfe musi-
zierender Engel schauen (Katalog-Nr. 16). Das
Bild war von Kommerzienrat Wittich in Darm-
stadt dargeliehen und stammt aus der Kölner
Sammlung Weyer; es überrascht durch die
Vereinigung einer Anzahl Motive, der sogen.
Madonna mit der Bohnenblüte (Kölner Mu-
1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
326
Abschnitt umfaßt in zeitlicher Folge die Werke
der kölnischen, niederrheinischen und west-
fälischen Schule, denen sich zahlreiche Arbeiten
vlämischer, altholländischer und oberdeutscher
Meister anschliessen. Im zweiten Teil sind
die Gemälde fremder Künstler im Privatbesitz
nach dem Schulzusammenhang in alphabetischer
Folge zusammengestellt. Bei den Bestimmungen
der Urheber mußte häufig auf die Wünsche
der Aussteller Rücksicht genommen werden.
Alle Ergebnisse vergleichender Studien und
die vielseitigen Förderungen auf verschiedenen
Gebieten der Kunstgeschichte, welche die Aus-
deutung und Verkennung seines inneren Wachs-
tums vielleicht unterblieben. In den Beginn
seiner Tätigkeit gehören nicht die fortgeschrit-
tensten, durch Reichtum an Motiven, derbe
Charakteristik, die lebhafte Erregtheit und den
mimischen Ausdruck der Gestalten auffallenden
Kompositionen, sondern im Gegenteil die schlich-
testen und lautersten Inspirationen, welche die
überkommene Vorstellung von der jungfräu-
lichen Gottesgebärerin und dem paradiesischen
Frieden, der von ihr ausstrahlt durch eine
neue persönliche Auffassung erweitern und
steigern.
Marienaltärchen aus der Werkstatt Stephan Lochners, Darmstadt. ^*>U^,
Stellung zeitigte, können an dieser Stelle nicht
in vollem Umfang dargelegt werden. Nur das
Lebenswerk einzelner Meister und eine kleine
Auswahl wenig bekannter Gemälde soll in
freier Folge eine eingehende Würdigung finden.
Die überragende Stellung Stephan Loch-
ners8) innerhalb der Kölner Malerschule und
seine Ziele an einem wichtigen Wendepunkte
der Entwicklung traten in Düsseldorf nicht
ganz nach Wunsch hervor, sonst wäre die un-
gerechte Beurteilung, die ihm von einzelnen
Stellen widerfuhr und eine vollkommene Miß-
8) Vergl. meine Abhandlung in dieser Zeitschrift
VI. 1893. S. 193 fg. — Daniel Burckhardt,
»Basels Bedeutung für Wissenschaft und Kunst im
XVJahrhundert.« (Festschrift 1901) S. 307fg. Carl
Aldenhoven, »Geschichte der Kölner Malerschule.«
(Lübeck 1902) S. 150 fg.
Auf die Darbietung der reifsten monumen-
talen Hauptschöpfung Stephan Lochners, seines
Altars der Stadtpatrone im Kölner Dom, mußte
von vornherein verzichtet werden und leider
blieb auch die Darmstädter „Darstellung Jesu
im Tempel" von 1447 aus, welche selbst den
voreingenommenen Kritiker von den erlesenen
koloristischen Qualitäten, dem wundervollen
Charme der stofflichen Detaildurchbildung sei-
nes Pinsels überzeugt hätte.
Den Forscher fesselte in Düsseldorf zunächst
eine Halbfigur der Madonna mit dem Kind,
über deren Schultern die Krausköpfe musi-
zierender Engel schauen (Katalog-Nr. 16). Das
Bild war von Kommerzienrat Wittich in Darm-
stadt dargeliehen und stammt aus der Kölner
Sammlung Weyer; es überrascht durch die
Vereinigung einer Anzahl Motive, der sogen.
Madonna mit der Bohnenblüte (Kölner Mu-