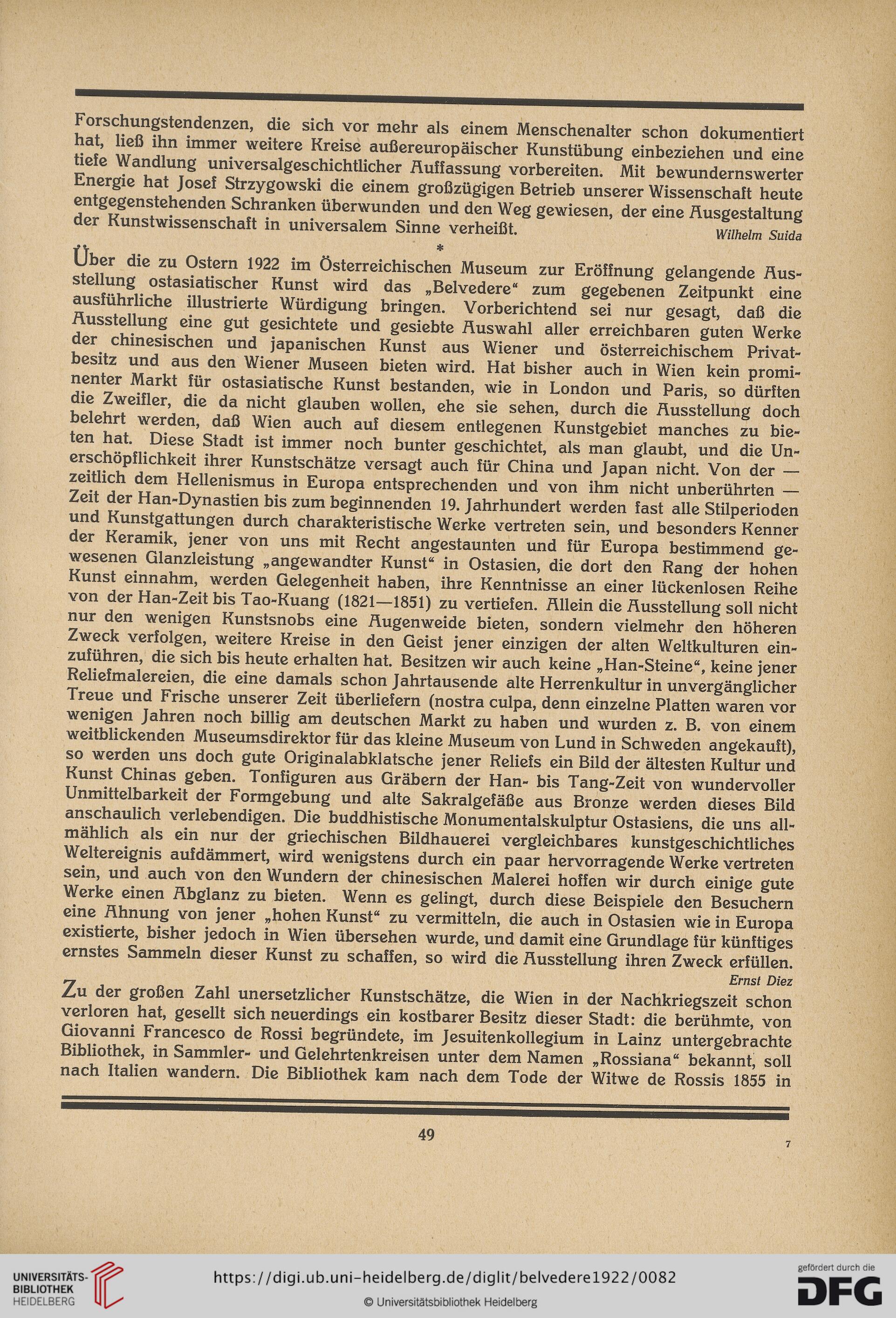Forschungstendenzen, die sich vor mehr als einem Menschenalter schon dokumentiert
hat, ließ ihn immer weitere Kreise außereuropäischer Kunstübung einbeziehen und eine
tiefe Wandlung universalgeschichtlicher Auffassung vorbereiten. Mit bewundernswerter
Energie hat Josef Strzygowski die einem großzügigen Betrieb unserer Wissenschaft heute
entgegenstehenden Schranken überwunden und den Weg gewiesen, der eine Ausgestaltung
der Kunstwissenschaft in universalem Sinne verheißt. Wilhelm Suida
*
Über die zu Ostern 1922 im Österreichischen Museum zur Eröffnung gelangende Aus-
stellung ostasiatischer Kunst wird das „Belvedere“ zum gegebenen Zeitpunkt eine
ausführliche illustrierte Würdigung bringen. Vorberichtend sei nur gesagt, daß die
Ausstellung eine gut gesichtete und gesiebte Auswahl aller erreichbaren guten Werke
der chinesischen und japanischen Kunst aus Wiener und österreichischem Privat-
besitz und aus den Wiener Museen bieten wird. Hat bisher auch in Wien kein promi-
nenter Markt für ostasiatische Kunst bestanden, wie in London und Paris, so dürften
die Zweifler, die da nicht glauben wollen, ehe sie sehen, durch die Ausstellung doch
belehrt werden, daß Wien auch auf diesem entlegenen Kunstgebiet manches zu bie-
ten hat. Diese Stadt ist immer noch bunter geschichtet, als man glaubt, und die Un-
erschöpflichkeit ihrer Kunstschätze versagt auch für China und Japan nicht Von der —
zeitlich dem Hellenismus in Europa entsprechenden und von ihm nicht unberührten —
Zeit der Han-Dynastien bis zum beginnenden 19. Jahrhundert werden fast alle Stilperioden
und Kunstgattungen durch charakteristische Werke vertreten sein, und besonders Kenner
der Keramik, jener von uns mit Recht angestaunten und für Europa bestimmend ge-
wesenen Glanzleistung „angewandter Kunst“ in Ostasien, die dort den Rang der hohen
Kunst einnahm, werden Gelegenheit haben, ihre Kenntnisse an einer lückenlosen Reihe
von der Han-Zeit bis Tao-Kuang (1821—1851) zu vertiefen. Allein die Ausstellung soll nicht
nur den wenigen Kunstsnobs eine Augenweide bieten, sondern vielmehr den höheren
Zweck verfolgen, weitere Kreise in den Geist jener einzigen der alten Weltkulturen ein-
zuführen, die sich bis heute erhalten hat. Besitzen wir auch keine „Han-Steine“, keine jener
Reliefmalereien, die eine damals schon Jahrtausende alte Herrenkultur in unvergänglicher
Treue und Frische unserer Zeit überliefern (nostra culpa, denn einzelne Platten waren vor
wenigen Jahren noch billig am deutschen Markt zu haben und wurden z. B. von einem
weitblickenden Museumsdirektor für das kleine Museum von Lund in Schweden angekauft),
so werden uns doch gute Originalabklatsche jener Reliefs ein Bild der ältesten Kultur und
Kunst Chinas geben. Tonfiguren aus Gräbern der Han- bis Tang-Zeit von wundervoller
Unmittelbarkeit der Formgebung und alte Sakralgefäße aus Bronze werden dieses Bild
anschaulich verlebendigen. Die buddhistische Monumentalskulptur Ostasiens, die uns all-
mählich als ein nur der griechischen Bildhauerei vergleichbares kunstgeschichtliches
Weltereignis aufdämmert, wird wenigstens durch ein paar hervorragende Werke vertreten
sein, und auch von den Wundern der chinesischen Malerei hoffen wir durch einige gute
Werke einen Abglanz zu bieten. Wenn es gelingt, durch diese Beispiele den Besuchern
eine Ahnung von jener „hohen Kunst“ zu vermitteln, die auch in Ostasien wie in Europa
existierte, bisher jedoch in Wien übersehen wurde, und damit eine Grundlage für künftiges
ernstes Sammeln dieser Kunst zu schaffen, so wird die Ausstellung ihren Zweck erfüllen.
Ernst Diez
Zu der großen Zahl unersetzlicher Kunstschätze, die Wien in der Nachkriegszeit schon
verloren hat, gesellt sich neuerdings ein kostbarer Besitz dieser Stadt: die berühmte, von
Giovanni Francesco de Rossi begründete, im Jesuitenkollegium in Lainz untergebrachte
Bibliothek, in Sammler- und Gelehrtenkreisen unter dem Namen „Rossiana“ bekannt, soll
nach Italien wandern. Die Bibliothek kam nach dem Tode der Witwe de Rossis 1855 in
49
7
hat, ließ ihn immer weitere Kreise außereuropäischer Kunstübung einbeziehen und eine
tiefe Wandlung universalgeschichtlicher Auffassung vorbereiten. Mit bewundernswerter
Energie hat Josef Strzygowski die einem großzügigen Betrieb unserer Wissenschaft heute
entgegenstehenden Schranken überwunden und den Weg gewiesen, der eine Ausgestaltung
der Kunstwissenschaft in universalem Sinne verheißt. Wilhelm Suida
*
Über die zu Ostern 1922 im Österreichischen Museum zur Eröffnung gelangende Aus-
stellung ostasiatischer Kunst wird das „Belvedere“ zum gegebenen Zeitpunkt eine
ausführliche illustrierte Würdigung bringen. Vorberichtend sei nur gesagt, daß die
Ausstellung eine gut gesichtete und gesiebte Auswahl aller erreichbaren guten Werke
der chinesischen und japanischen Kunst aus Wiener und österreichischem Privat-
besitz und aus den Wiener Museen bieten wird. Hat bisher auch in Wien kein promi-
nenter Markt für ostasiatische Kunst bestanden, wie in London und Paris, so dürften
die Zweifler, die da nicht glauben wollen, ehe sie sehen, durch die Ausstellung doch
belehrt werden, daß Wien auch auf diesem entlegenen Kunstgebiet manches zu bie-
ten hat. Diese Stadt ist immer noch bunter geschichtet, als man glaubt, und die Un-
erschöpflichkeit ihrer Kunstschätze versagt auch für China und Japan nicht Von der —
zeitlich dem Hellenismus in Europa entsprechenden und von ihm nicht unberührten —
Zeit der Han-Dynastien bis zum beginnenden 19. Jahrhundert werden fast alle Stilperioden
und Kunstgattungen durch charakteristische Werke vertreten sein, und besonders Kenner
der Keramik, jener von uns mit Recht angestaunten und für Europa bestimmend ge-
wesenen Glanzleistung „angewandter Kunst“ in Ostasien, die dort den Rang der hohen
Kunst einnahm, werden Gelegenheit haben, ihre Kenntnisse an einer lückenlosen Reihe
von der Han-Zeit bis Tao-Kuang (1821—1851) zu vertiefen. Allein die Ausstellung soll nicht
nur den wenigen Kunstsnobs eine Augenweide bieten, sondern vielmehr den höheren
Zweck verfolgen, weitere Kreise in den Geist jener einzigen der alten Weltkulturen ein-
zuführen, die sich bis heute erhalten hat. Besitzen wir auch keine „Han-Steine“, keine jener
Reliefmalereien, die eine damals schon Jahrtausende alte Herrenkultur in unvergänglicher
Treue und Frische unserer Zeit überliefern (nostra culpa, denn einzelne Platten waren vor
wenigen Jahren noch billig am deutschen Markt zu haben und wurden z. B. von einem
weitblickenden Museumsdirektor für das kleine Museum von Lund in Schweden angekauft),
so werden uns doch gute Originalabklatsche jener Reliefs ein Bild der ältesten Kultur und
Kunst Chinas geben. Tonfiguren aus Gräbern der Han- bis Tang-Zeit von wundervoller
Unmittelbarkeit der Formgebung und alte Sakralgefäße aus Bronze werden dieses Bild
anschaulich verlebendigen. Die buddhistische Monumentalskulptur Ostasiens, die uns all-
mählich als ein nur der griechischen Bildhauerei vergleichbares kunstgeschichtliches
Weltereignis aufdämmert, wird wenigstens durch ein paar hervorragende Werke vertreten
sein, und auch von den Wundern der chinesischen Malerei hoffen wir durch einige gute
Werke einen Abglanz zu bieten. Wenn es gelingt, durch diese Beispiele den Besuchern
eine Ahnung von jener „hohen Kunst“ zu vermitteln, die auch in Ostasien wie in Europa
existierte, bisher jedoch in Wien übersehen wurde, und damit eine Grundlage für künftiges
ernstes Sammeln dieser Kunst zu schaffen, so wird die Ausstellung ihren Zweck erfüllen.
Ernst Diez
Zu der großen Zahl unersetzlicher Kunstschätze, die Wien in der Nachkriegszeit schon
verloren hat, gesellt sich neuerdings ein kostbarer Besitz dieser Stadt: die berühmte, von
Giovanni Francesco de Rossi begründete, im Jesuitenkollegium in Lainz untergebrachte
Bibliothek, in Sammler- und Gelehrtenkreisen unter dem Namen „Rossiana“ bekannt, soll
nach Italien wandern. Die Bibliothek kam nach dem Tode der Witwe de Rossis 1855 in
49
7