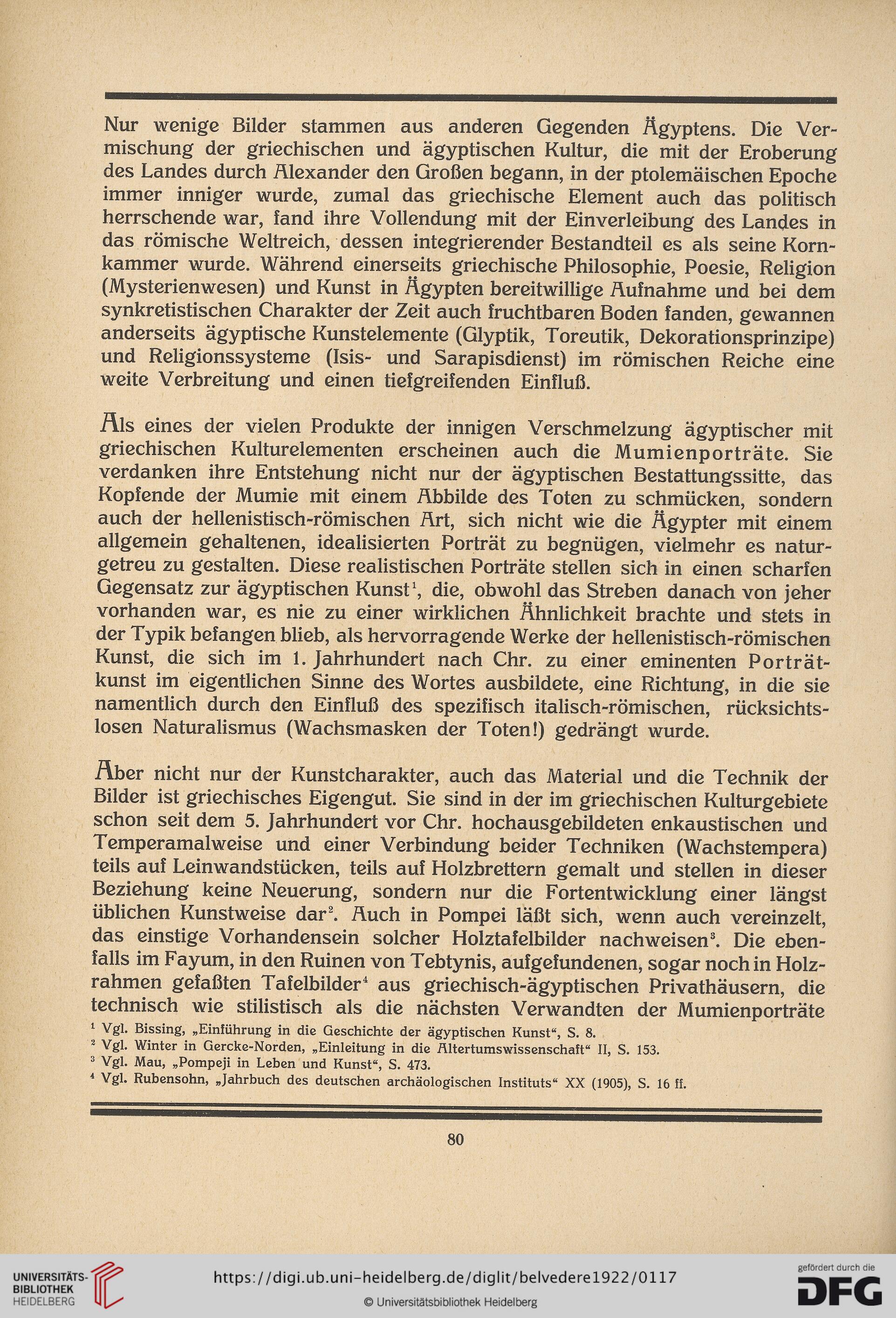Nur wenige Bilder stammen aus anderen Gegenden Ägyptens. Die Ver-
mischung der griechischen und ägyptischen Kultur, die mit der Eroberung
des Landes durch Alexander den Großen begann, in der ptolemäischen Epoche
immer inniger wurde, zumal das griechische Element auch das politisch
herrschende war, fand ihre Vollendung mit der Einverleibung des Landes in
das römische Weltreich, dessen integrierender Bestandteil cs als seine Korn-
kammer wurde. Während einerseits griechische Philosophie, Poesie, Religion
(Mysterienwesen) und Kunst in Ägypten bereitwillige Aufnahme und bei dem
synkretistischen Charakter der Zeit auch fruchtbaren Boden fanden, gewannen
anderseits ägyptische Kunstelemente (Glyptik, Toreutik, Dekorationsprinzipe)
und Religionssysteme (Isis- und Sarapisdienst) im römischen Reiche eine
weite Verbreitung und einen tiefgreifenden Einfluß.
Als eines der vielen Produkte der innigen Verschmelzung ägyptischer mit
griechischen Kulturelementen erscheinen auch die Mumienporträte. Sie
verdanken ihre Entstehung nicht nur der ägyptischen Bestattungssitte, das
Kopfende der Mumie mit einem Abbilde des Toten zu schmücken, sondern
auch der hellenistisch-römischen Art, sich nicht wie die Ägypter mit einem
allgemein gehaltenen, idealisierten Porträt zu begnügen, vielmehr es natur-
getreu zu gestalten. Diese realistischen Porträte stellen sich in einen scharfen
Gegensatz zur ägyptischen Kunst1, die, obwohl das Streben danach von jeher
vorhanden war, es nie zu einer wirklichen Ähnlichkeit brachte und stets in
der Typik befangen blieb, als hervorragende Werke der hellenistisch-römischen
Kunst, die sich im 1. Jahrhundert nach Chr. zu einer eminenten Porträt-
kunst im eigentlichen Sinne des Wortes ausbildete, eine Richtung, in die sie
namentlich durch den Einfluß des spezifisch italisch-römischen, rücksichts-
losen Naturalismus (Wachsmasken der Toten!) gedrängt wurde.
Aber nicht nur der Kunstcharakter, auch das Material und die Technik der
Bilder ist griechisches Eigengut. Sie sind in der im griechischen Kulturgebiete
schon seit dem 5. Jahrhundert vor Chr. hochausgebildeten enkaustischen und
Temperamalweise und einer Verbindung beider Techniken (Wachstempera)
teils auf Leinwandstücken, teils auf Holzbrettern gemalt und stellen in dieser
Beziehung keine Neuerung, sondern nur die Fortentwicklung einer längst
üblichen Kunstweise dar2. Auch in Pompei läßt sich, wenn auch vereinzelt,
das einstige Vorhandensein solcher Holztafelbilder nachweisen3. Die eben-
falls im Fayum, in den Ruinen von Tebtynis, aufgefundenen, sogar noch in Holz-
rahmen gefaßten Tafelbilder4 aus griechisch-ägyptischen Privathäusern, die
technisch wie stilistisch als die nächsten Verwandten der Mumienporträte
1 Vgl. Bissing, „Einführung in die Geschichte der ägyptischen Kunst“, S. 8.
2 Vgl. Winter in Gercke-Norden, „Einleitung in die Altertumswissenschaft“ II, S. 153.
3 Vgl. Mau, „Pompeji in Leben und Kunst“, S. 473.
4 Vgl. Rubensohn, „Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts“ XX (1905), S. 16 ff.
80
mischung der griechischen und ägyptischen Kultur, die mit der Eroberung
des Landes durch Alexander den Großen begann, in der ptolemäischen Epoche
immer inniger wurde, zumal das griechische Element auch das politisch
herrschende war, fand ihre Vollendung mit der Einverleibung des Landes in
das römische Weltreich, dessen integrierender Bestandteil cs als seine Korn-
kammer wurde. Während einerseits griechische Philosophie, Poesie, Religion
(Mysterienwesen) und Kunst in Ägypten bereitwillige Aufnahme und bei dem
synkretistischen Charakter der Zeit auch fruchtbaren Boden fanden, gewannen
anderseits ägyptische Kunstelemente (Glyptik, Toreutik, Dekorationsprinzipe)
und Religionssysteme (Isis- und Sarapisdienst) im römischen Reiche eine
weite Verbreitung und einen tiefgreifenden Einfluß.
Als eines der vielen Produkte der innigen Verschmelzung ägyptischer mit
griechischen Kulturelementen erscheinen auch die Mumienporträte. Sie
verdanken ihre Entstehung nicht nur der ägyptischen Bestattungssitte, das
Kopfende der Mumie mit einem Abbilde des Toten zu schmücken, sondern
auch der hellenistisch-römischen Art, sich nicht wie die Ägypter mit einem
allgemein gehaltenen, idealisierten Porträt zu begnügen, vielmehr es natur-
getreu zu gestalten. Diese realistischen Porträte stellen sich in einen scharfen
Gegensatz zur ägyptischen Kunst1, die, obwohl das Streben danach von jeher
vorhanden war, es nie zu einer wirklichen Ähnlichkeit brachte und stets in
der Typik befangen blieb, als hervorragende Werke der hellenistisch-römischen
Kunst, die sich im 1. Jahrhundert nach Chr. zu einer eminenten Porträt-
kunst im eigentlichen Sinne des Wortes ausbildete, eine Richtung, in die sie
namentlich durch den Einfluß des spezifisch italisch-römischen, rücksichts-
losen Naturalismus (Wachsmasken der Toten!) gedrängt wurde.
Aber nicht nur der Kunstcharakter, auch das Material und die Technik der
Bilder ist griechisches Eigengut. Sie sind in der im griechischen Kulturgebiete
schon seit dem 5. Jahrhundert vor Chr. hochausgebildeten enkaustischen und
Temperamalweise und einer Verbindung beider Techniken (Wachstempera)
teils auf Leinwandstücken, teils auf Holzbrettern gemalt und stellen in dieser
Beziehung keine Neuerung, sondern nur die Fortentwicklung einer längst
üblichen Kunstweise dar2. Auch in Pompei läßt sich, wenn auch vereinzelt,
das einstige Vorhandensein solcher Holztafelbilder nachweisen3. Die eben-
falls im Fayum, in den Ruinen von Tebtynis, aufgefundenen, sogar noch in Holz-
rahmen gefaßten Tafelbilder4 aus griechisch-ägyptischen Privathäusern, die
technisch wie stilistisch als die nächsten Verwandten der Mumienporträte
1 Vgl. Bissing, „Einführung in die Geschichte der ägyptischen Kunst“, S. 8.
2 Vgl. Winter in Gercke-Norden, „Einleitung in die Altertumswissenschaft“ II, S. 153.
3 Vgl. Mau, „Pompeji in Leben und Kunst“, S. 473.
4 Vgl. Rubensohn, „Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts“ XX (1905), S. 16 ff.
80