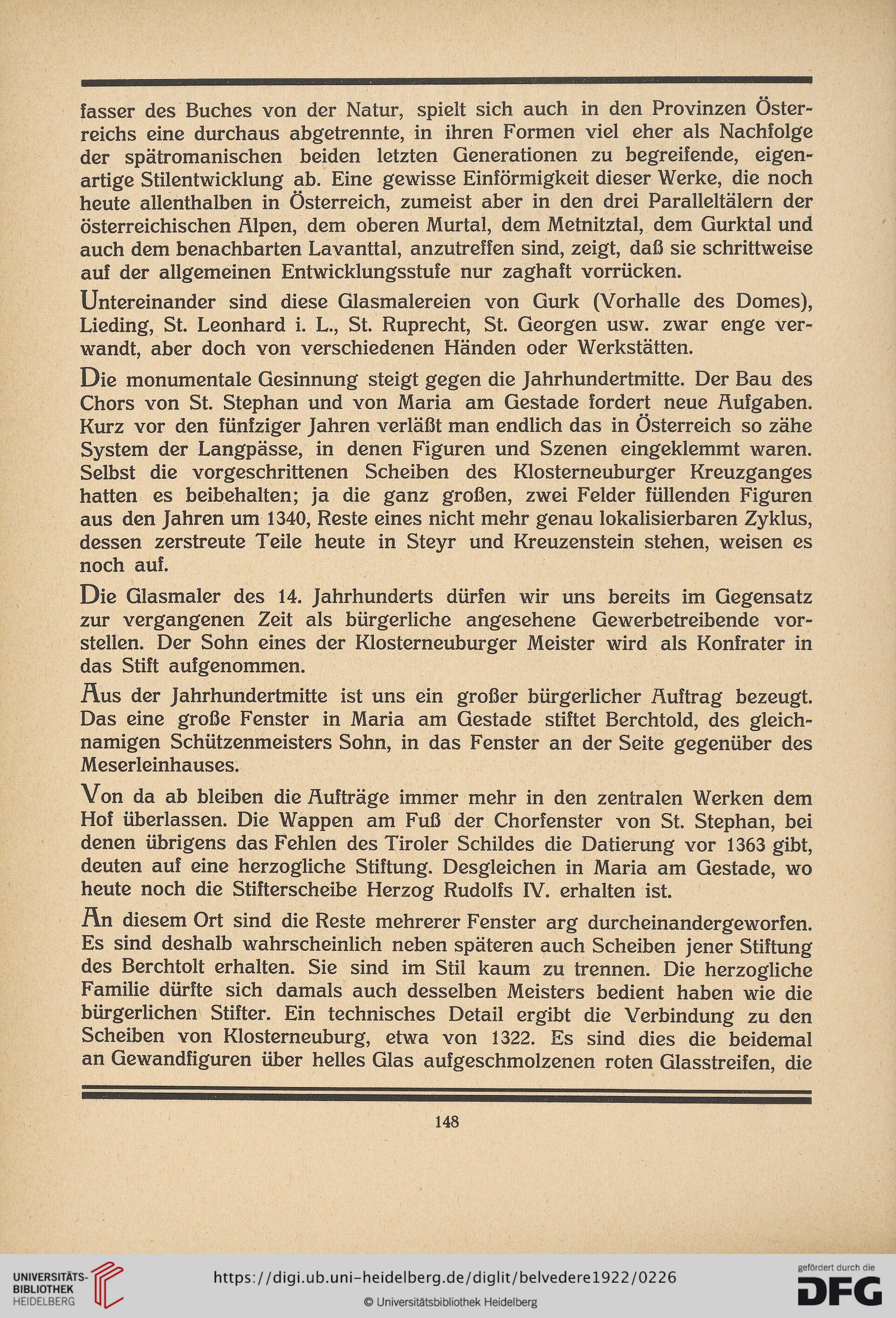fasser des Buches von der Natur, spielt sich auch in den Provinzen Öster-
reichs eine durchaus abgetrennte, in ihren Formen viel eher als Nachfolge
der spätromanischen beiden letzten Generationen zu begreifende, eigen-
artige Stilentwicklung ab. Eine gewisse Einförmigkeit dieser Werke, die noch
heute allenthalben in Österreich, zumeist aber in den drei Paralleltälern der
österreichischen Alpen, dem oberen Murtal, dem Metnitztal, dem Gurktal und
auch dem benachbarten Lavanttal, anzutreffen sind, zeigt, daß sie schrittweise
auf der allgemeinen Entwicklungsstufe nur zaghaft vorrücken.
Untereinander sind diese Glasmalereien von Gurk (Vorhalle des Domes),
Lieding, St. Leonhard i. L., St. Ruprecht, St. Georgen usw. zwar enge ver-
wandt, aber doch von verschiedenen Händen oder Werkstätten.
Die monumentale Gesinnung steigt gegen die Jahrhundertmitte. Der Bau des
Chors von St. Stephan und von Maria am Gestade fordert neue Aufgaben.
Kurz vor den fünfziger Jahren verläßt man endlich das in Österreich so zähe
System der Langpässe, in denen Figuren und Szenen eingeklemmt waren.
Selbst die vorgeschrittenen Scheiben des Klosterneuburger Kreuzganges
hatten es beibehalten; ja die ganz großen, zwei Felder füllenden Figuren
aus den Jahren um 1340, Reste eines nicht mehr genau lokalisierbaren Zyklus,
dessen zerstreute Teile heute in Steyr und Kreuzenstein stehen, weisen es
noch auf.
Die Glasmaler des 14. Jahrhunderts dürfen wir uns bereits im Gegensatz
zur vergangenen Zeit als bürgerliche angesehene Gewerbetreibende vor-
stellen. Der Sohn eines der Klosterneuburger Meister wird als Konfrater in
das Stift aufgenommen.
Aus der Jahrhundertmitte ist uns ein großer bürgerlicher Auftrag bezeugt.
Das eine große Fenster in Maria am Gestade stiftet Berchtold, des gleich-
namigen Schützenmeisters Sohn, in das Fenster an der Seite gegenüber des
Meserleinhauses.
Von da ab bleiben die Aufträge immer mehr in den zentralen Werken dem
Hof überlassen. Die Wappen am Fuß der Chorfenster von St. Stephan, bei
denen übrigens das Fehlen des Tiroler Schildes die Datierung vor 1363 gibt,
deuten auf eine herzogliche Stiftung. Desgleichen in Maria am Gestade, wo
heute noch die Stifterscheibe Herzog Rudolfs IV. erhalten ist.
An diesem Ort sind die Reste mehrerer Fenster arg durcheinandergeworfen.
Es sind deshalb wahrscheinlich neben späteren auch Scheiben jener Stiftung
des Berchtolt erhalten. Sie sind im Stil kaum zu trennen. Die herzogliche
Familie dürfte sich damals auch desselben Meisters bedient haben wie die
bürgerlichen Stifter. Ein technisches Detail ergibt die Verbindung zu den
Scheiben von Klosterneuburg, etwa von 1322. Es sind dies die beidemal
an Gewandfiguren über helles Glas aufgeschmolzenen roten Glasstreifen, die
148
reichs eine durchaus abgetrennte, in ihren Formen viel eher als Nachfolge
der spätromanischen beiden letzten Generationen zu begreifende, eigen-
artige Stilentwicklung ab. Eine gewisse Einförmigkeit dieser Werke, die noch
heute allenthalben in Österreich, zumeist aber in den drei Paralleltälern der
österreichischen Alpen, dem oberen Murtal, dem Metnitztal, dem Gurktal und
auch dem benachbarten Lavanttal, anzutreffen sind, zeigt, daß sie schrittweise
auf der allgemeinen Entwicklungsstufe nur zaghaft vorrücken.
Untereinander sind diese Glasmalereien von Gurk (Vorhalle des Domes),
Lieding, St. Leonhard i. L., St. Ruprecht, St. Georgen usw. zwar enge ver-
wandt, aber doch von verschiedenen Händen oder Werkstätten.
Die monumentale Gesinnung steigt gegen die Jahrhundertmitte. Der Bau des
Chors von St. Stephan und von Maria am Gestade fordert neue Aufgaben.
Kurz vor den fünfziger Jahren verläßt man endlich das in Österreich so zähe
System der Langpässe, in denen Figuren und Szenen eingeklemmt waren.
Selbst die vorgeschrittenen Scheiben des Klosterneuburger Kreuzganges
hatten es beibehalten; ja die ganz großen, zwei Felder füllenden Figuren
aus den Jahren um 1340, Reste eines nicht mehr genau lokalisierbaren Zyklus,
dessen zerstreute Teile heute in Steyr und Kreuzenstein stehen, weisen es
noch auf.
Die Glasmaler des 14. Jahrhunderts dürfen wir uns bereits im Gegensatz
zur vergangenen Zeit als bürgerliche angesehene Gewerbetreibende vor-
stellen. Der Sohn eines der Klosterneuburger Meister wird als Konfrater in
das Stift aufgenommen.
Aus der Jahrhundertmitte ist uns ein großer bürgerlicher Auftrag bezeugt.
Das eine große Fenster in Maria am Gestade stiftet Berchtold, des gleich-
namigen Schützenmeisters Sohn, in das Fenster an der Seite gegenüber des
Meserleinhauses.
Von da ab bleiben die Aufträge immer mehr in den zentralen Werken dem
Hof überlassen. Die Wappen am Fuß der Chorfenster von St. Stephan, bei
denen übrigens das Fehlen des Tiroler Schildes die Datierung vor 1363 gibt,
deuten auf eine herzogliche Stiftung. Desgleichen in Maria am Gestade, wo
heute noch die Stifterscheibe Herzog Rudolfs IV. erhalten ist.
An diesem Ort sind die Reste mehrerer Fenster arg durcheinandergeworfen.
Es sind deshalb wahrscheinlich neben späteren auch Scheiben jener Stiftung
des Berchtolt erhalten. Sie sind im Stil kaum zu trennen. Die herzogliche
Familie dürfte sich damals auch desselben Meisters bedient haben wie die
bürgerlichen Stifter. Ein technisches Detail ergibt die Verbindung zu den
Scheiben von Klosterneuburg, etwa von 1322. Es sind dies die beidemal
an Gewandfiguren über helles Glas aufgeschmolzenen roten Glasstreifen, die
148