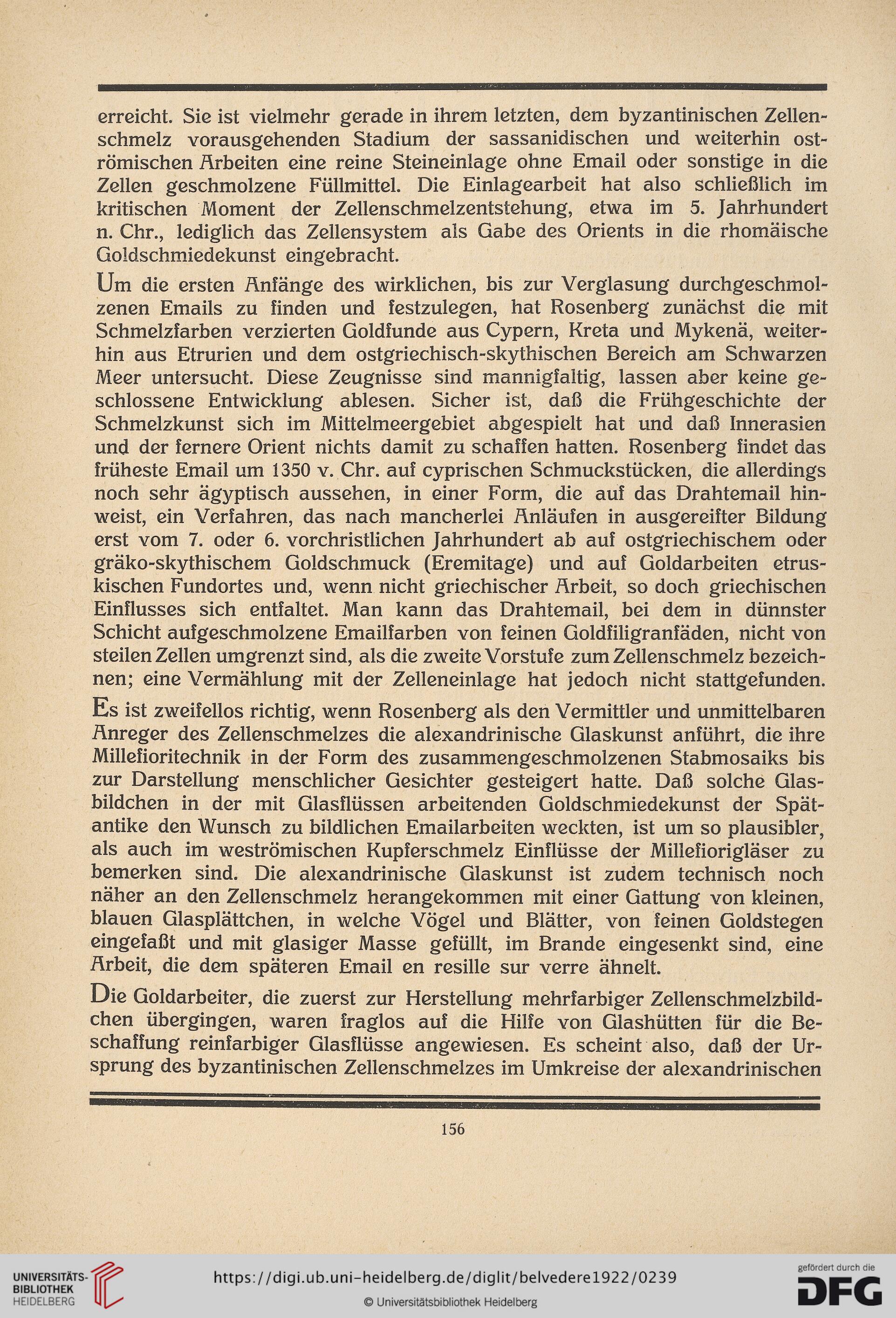erreicht. Sie ist vielmehr gerade in ihrem letzten, dem byzantinischen Zellen-
schmelz vorausgehenden Stadium der sassanidischen und weiterhin ost-
römischen Arbeiten eine reine Steineinlage ohne Email oder sonstige in die
Zellen geschmolzene Füllmittel. Die Einlagearbeit hat also schließlich im
kritischen Moment der Zellenschmelzentstehung, etwa im 5. Jahrhundert
n. Chr., lediglich das Zellensystem als Gabe des Orients in die rhomäische
Goldschmiedekunst eingebracht.
Um die ersten Anfänge des wirklichen, bis zur Verglasung durchgeschmol-
zenen Emails zu finden und festzulegen, hat Rosenberg zunächst die mit
Schmelzfarben verzierten Goldfunde aus Cypern, Kreta und Mykenä, weiter-
hin aus Etrurien und dem ostgriechisch-skythischen Bereich am Schwarzen
Meer untersucht. Diese Zeugnisse sind mannigfaltig, lassen aber keine ge-
schlossene Entwicklung ablesen. Sicher ist, daß die Frühgeschichte der
Schmelzkunst sich im Mittelmeergebiet abgespielt hat und daß Innerasien
und der fernere Orient nichts damit zu schaffen hatten. Rosenberg findet das
früheste Email um 1350 v. Chr. auf cyprischen Schmuckstücken, die allerdings
noch sehr ägyptisch aussehen, in einer Form, die auf das Drahtemail hin-
weist, ein Verfahren, das nach mancherlei Anläufen in ausgereifter Bildung
erst vom 7. oder 6. vorchristlichen Jahrhundert ab auf ostgriechischem oder
gräko-skythischem Goldschmuck (Eremitage) und auf Goldarbeiten etrus-
kischen Fundortes und, wenn nicht griechischer Arbeit, so doch griechischen
Einflusses sich entfaltet. Man kann das Drahtemail, bei dem in dünnster
Schicht aufgeschmolzene Emailfarben von feinen Goldfiligranfäden, nicht von
steilen Zellen umgrenzt sind, als die zweite Vorstufe zum Zellenschmelz bezeich-
nen; eine Vermählung mit der Zelleneinlage hat jedoch nicht stattgefunden.
Es ist zweifellos richtig, wenn Rosenberg als den Vermittler und unmittelbaren
Anreger des Zellenschmelzes die alexandrinische Glaskunst anführt, die ihre
Millefioritechnik in der Form des zusammengeschmolzenen Stabmosaiks bis
zur Darstellung menschlicher Gesichter gesteigert hatte. Daß solche Glas-
bildchen in der mit Glasflüssen arbeitenden Goldschmiedekunst der Spät-
antike den Wunsch zu bildlichen Emailarbeiten weckten, ist um so plausibler,
als auch im weströmischen Kupferschmelz Einflüsse der Millefiorigläser zu
bemerken sind. Die alexandrinische Glaskunst ist zudem technisch noch
näher an den Zellenschmelz herangekommen mit einer Gattung von kleinen,
blauen Glasplättchen, in welche Vögel und Blätter, von feinen Goldstegen
eingefaßt und mit glasiger Masse gefüllt, im Brande eingesenkt sind, eine
Arbeit, die dem späteren Email en resille sur verre ähnelt.
Die Goldarbeiter, die zuerst zur Herstellung mehrfarbiger Zellenschmelzbild-
chen übergingen, waren fraglos auf die Hilfe von Glashütten für die Be-
schaffung reinfarbiger Glasflüsse angewiesen. Es scheint also, daß der Ur-
sprung des byzantinischen Zellenschmelzes im Umkreise der alexandrinischen
156
schmelz vorausgehenden Stadium der sassanidischen und weiterhin ost-
römischen Arbeiten eine reine Steineinlage ohne Email oder sonstige in die
Zellen geschmolzene Füllmittel. Die Einlagearbeit hat also schließlich im
kritischen Moment der Zellenschmelzentstehung, etwa im 5. Jahrhundert
n. Chr., lediglich das Zellensystem als Gabe des Orients in die rhomäische
Goldschmiedekunst eingebracht.
Um die ersten Anfänge des wirklichen, bis zur Verglasung durchgeschmol-
zenen Emails zu finden und festzulegen, hat Rosenberg zunächst die mit
Schmelzfarben verzierten Goldfunde aus Cypern, Kreta und Mykenä, weiter-
hin aus Etrurien und dem ostgriechisch-skythischen Bereich am Schwarzen
Meer untersucht. Diese Zeugnisse sind mannigfaltig, lassen aber keine ge-
schlossene Entwicklung ablesen. Sicher ist, daß die Frühgeschichte der
Schmelzkunst sich im Mittelmeergebiet abgespielt hat und daß Innerasien
und der fernere Orient nichts damit zu schaffen hatten. Rosenberg findet das
früheste Email um 1350 v. Chr. auf cyprischen Schmuckstücken, die allerdings
noch sehr ägyptisch aussehen, in einer Form, die auf das Drahtemail hin-
weist, ein Verfahren, das nach mancherlei Anläufen in ausgereifter Bildung
erst vom 7. oder 6. vorchristlichen Jahrhundert ab auf ostgriechischem oder
gräko-skythischem Goldschmuck (Eremitage) und auf Goldarbeiten etrus-
kischen Fundortes und, wenn nicht griechischer Arbeit, so doch griechischen
Einflusses sich entfaltet. Man kann das Drahtemail, bei dem in dünnster
Schicht aufgeschmolzene Emailfarben von feinen Goldfiligranfäden, nicht von
steilen Zellen umgrenzt sind, als die zweite Vorstufe zum Zellenschmelz bezeich-
nen; eine Vermählung mit der Zelleneinlage hat jedoch nicht stattgefunden.
Es ist zweifellos richtig, wenn Rosenberg als den Vermittler und unmittelbaren
Anreger des Zellenschmelzes die alexandrinische Glaskunst anführt, die ihre
Millefioritechnik in der Form des zusammengeschmolzenen Stabmosaiks bis
zur Darstellung menschlicher Gesichter gesteigert hatte. Daß solche Glas-
bildchen in der mit Glasflüssen arbeitenden Goldschmiedekunst der Spät-
antike den Wunsch zu bildlichen Emailarbeiten weckten, ist um so plausibler,
als auch im weströmischen Kupferschmelz Einflüsse der Millefiorigläser zu
bemerken sind. Die alexandrinische Glaskunst ist zudem technisch noch
näher an den Zellenschmelz herangekommen mit einer Gattung von kleinen,
blauen Glasplättchen, in welche Vögel und Blätter, von feinen Goldstegen
eingefaßt und mit glasiger Masse gefüllt, im Brande eingesenkt sind, eine
Arbeit, die dem späteren Email en resille sur verre ähnelt.
Die Goldarbeiter, die zuerst zur Herstellung mehrfarbiger Zellenschmelzbild-
chen übergingen, waren fraglos auf die Hilfe von Glashütten für die Be-
schaffung reinfarbiger Glasflüsse angewiesen. Es scheint also, daß der Ur-
sprung des byzantinischen Zellenschmelzes im Umkreise der alexandrinischen
156