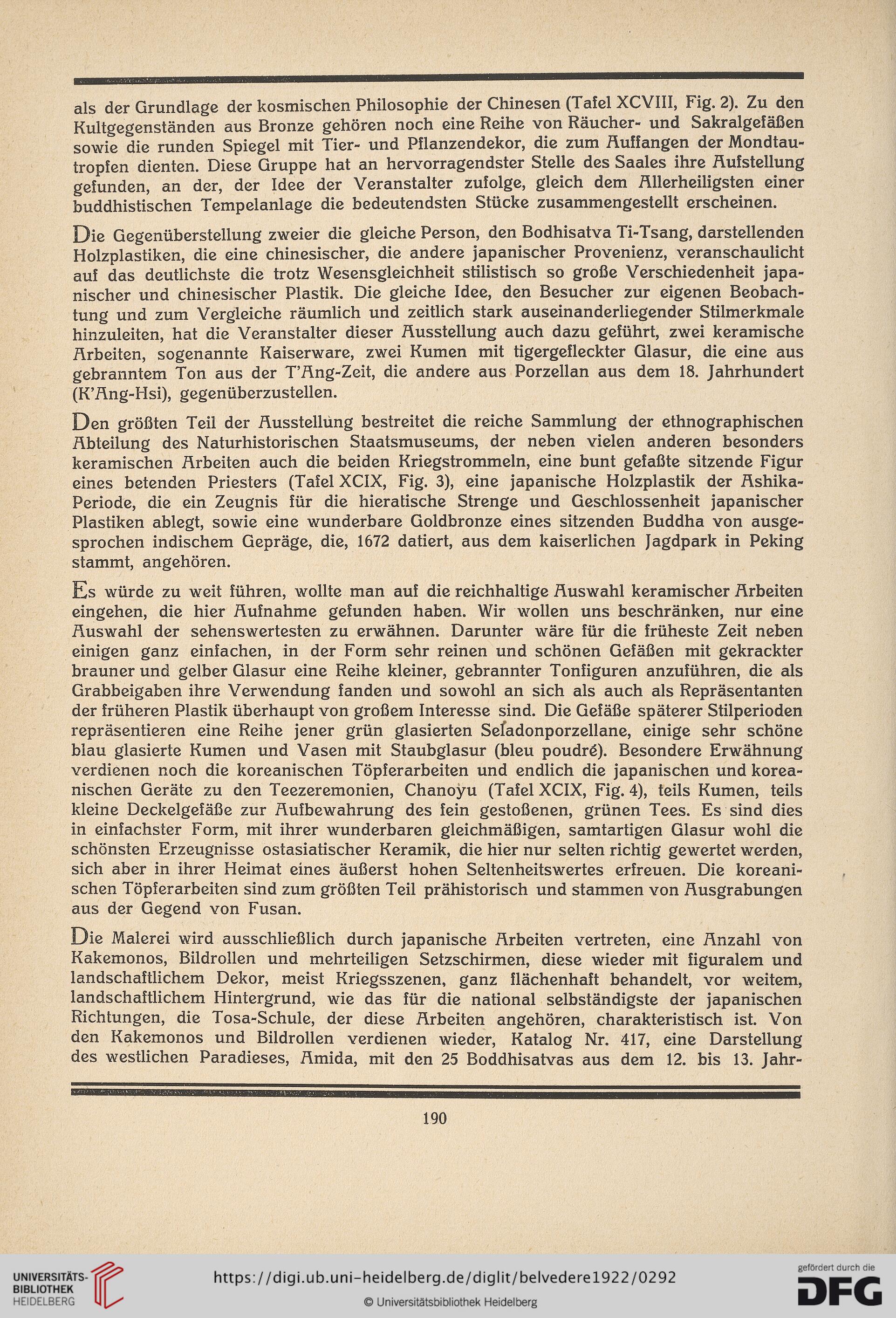als der Grundlage der kosmischen Philosophie der Chinesen (Tafel XCVIII, Fig. 2). Zu den
Kultgegenständen aus Bronze gehören noch eine Reihe von Räucher- und Sakralgefäßen
sowie die runden Spiegel mit Tier- und Pflanzen dckor, die zum Auffangen der Mondtau-
tropfen dienten. Diese Gruppe hat an hervorragendster Stelle des Saales ihre Aufstellung
gefunden, an der, der Idee der Veranstalter zufolge, gleich dem Allerheiligsten einer
buddhistischen Tempelanlage die bedeutendsten Stücke zusammengestellt erscheinen.
Die Gegenüberstellung zweier die gleiche Person, den Bodhisatva Ti-Tsang, darstellenden
Holzplastiken, die eine chinesischer, die andere japanischer Provenienz, veranschaulicht
auf das deutlichste die trotz Wesensgleichheit stilistisch so große Verschiedenheit japa-
nischer und chinesischer Plastik. Die gleiche Idee, den Besucher zur eigenen Beobach-
tung und zum Vergleiche räumlich und zeitlich stark auseinanderliegender Stilmerkmale
hinzuleiten, hat die Veranstalter dieser Ausstellung auch dazu geführt, zwei keramische
Arbeiten, sogenannte Kaiserware, zwei Kumen mit tigergefleckter Glasur, die eine aus
gebranntem Ton aus der T’Ang-Zeit, die andere aus Porzellan aus dem 18. Jahrhundert
(K’Ang-Hsi), gegenüberzustellen.
Den größten Teil der Ausstellung bestreitet die reiche Sammlung der ethnographischen
Abteilung des Naturhistorischen Staatsmuseums, der neben vielen anderen besonders
keramischen Arbeiten auch die beiden Kriegstrommeln, eine bunt gefaßte sitzende Figur
eines betenden Priesters (Tafel XCIX, Fig. 3), eine japanische Holzplastik der Ashika-
Periode, die ein Zeugnis für die hieratische Strenge und Geschlossenheit japanischer
Plastiken ablegt, sowie eine wunderbare Goldbronze eines sitzenden Buddha von ausge-
sprochen indischem Gepräge, die, 1672 datiert, aus dem kaiserlichen Jagdpark in Peking
stammt, angehören.
Es würde zu weit führen, wollte man auf die reichhaltige Auswahl keramischer Arbeiten
eingehen, die hier Aufnahme gefunden haben. Wir wollen uns beschränken, nur eine
Auswahl der sehenswertesten zu erwähnen. Darunter wäre für die früheste Zeit neben
einigen ganz einfachen, in der Form sehr reinen und schönen Gefäßen mit gekrackter
brauner und gelber Glasur eine Reihe kleiner, gebrannter Tonfiguren anzuführen, die als
Grabbeigaben ihre Verwendung fanden und sowohl an sich als auch als Repräsentanten
der früheren Plastik überhaupt von großem Interesse sind. Die Gefäße späterer Stilperioden
repräsentieren eine Reihe jener grün glasierten Sefadonporzellane, einige sehr schöne
blau glasierte Kumen und Vasen mit Staubglasur (bleu poudrä). Besondere Erwähnung
verdienen noch die koreanischen Töpferarbeiten und endlich die japanischen und korea-
nischen Geräte zu den Teezeremonien, Chanoyu (Tafel XCIX, Fig. 4), teils Kumen, teils
kleine Deckelgefäße zur Aufbewahrung des fein gestoßenen, grünen Tees. Es sind dies
in einfachster Form, mit ihrer wunderbaren gleichmäßigen, samtartigen Glasur wohl die
schönsten Erzeugnisse ostasiatischer Keramik, die hier nur selten richtig gewertet werden,
sich aber in ihrer Heimat eines äußerst hohen Seltenheitswertes erfreuen. Die koreani-
schen Töpferarbeiten sind zum größten Teil prähistorisch und stammen von Ausgrabungen
aus der Gegend von Fusan.
Die Malerei wird ausschließlich durch japanische Arbeiten vertreten, eine Anzahl von
Kakemonos, Bildrollen und mehrteiligen Setzschirmen, diese wieder mit figuralem und
landschaftlichem Dekor, meist Kriegsszenen, ganz flächenhaft behandelt, vor weitem,
landschaftlichem Hintergrund, wie das für die national selbständigste der japanischen
Richtungen, die Tosa-Schule, der diese Arbeiten angehören, charakteristisch ist Von
den Kakemonos und Bildrollen verdienen wieder, Katalog Nr. 417, eine Darstellung
des westlichen Paradieses, Amida, mit den 25 Boddhisatvas aus dem 12. bis 13. Jahr-
a —ir-waT
190
Kultgegenständen aus Bronze gehören noch eine Reihe von Räucher- und Sakralgefäßen
sowie die runden Spiegel mit Tier- und Pflanzen dckor, die zum Auffangen der Mondtau-
tropfen dienten. Diese Gruppe hat an hervorragendster Stelle des Saales ihre Aufstellung
gefunden, an der, der Idee der Veranstalter zufolge, gleich dem Allerheiligsten einer
buddhistischen Tempelanlage die bedeutendsten Stücke zusammengestellt erscheinen.
Die Gegenüberstellung zweier die gleiche Person, den Bodhisatva Ti-Tsang, darstellenden
Holzplastiken, die eine chinesischer, die andere japanischer Provenienz, veranschaulicht
auf das deutlichste die trotz Wesensgleichheit stilistisch so große Verschiedenheit japa-
nischer und chinesischer Plastik. Die gleiche Idee, den Besucher zur eigenen Beobach-
tung und zum Vergleiche räumlich und zeitlich stark auseinanderliegender Stilmerkmale
hinzuleiten, hat die Veranstalter dieser Ausstellung auch dazu geführt, zwei keramische
Arbeiten, sogenannte Kaiserware, zwei Kumen mit tigergefleckter Glasur, die eine aus
gebranntem Ton aus der T’Ang-Zeit, die andere aus Porzellan aus dem 18. Jahrhundert
(K’Ang-Hsi), gegenüberzustellen.
Den größten Teil der Ausstellung bestreitet die reiche Sammlung der ethnographischen
Abteilung des Naturhistorischen Staatsmuseums, der neben vielen anderen besonders
keramischen Arbeiten auch die beiden Kriegstrommeln, eine bunt gefaßte sitzende Figur
eines betenden Priesters (Tafel XCIX, Fig. 3), eine japanische Holzplastik der Ashika-
Periode, die ein Zeugnis für die hieratische Strenge und Geschlossenheit japanischer
Plastiken ablegt, sowie eine wunderbare Goldbronze eines sitzenden Buddha von ausge-
sprochen indischem Gepräge, die, 1672 datiert, aus dem kaiserlichen Jagdpark in Peking
stammt, angehören.
Es würde zu weit führen, wollte man auf die reichhaltige Auswahl keramischer Arbeiten
eingehen, die hier Aufnahme gefunden haben. Wir wollen uns beschränken, nur eine
Auswahl der sehenswertesten zu erwähnen. Darunter wäre für die früheste Zeit neben
einigen ganz einfachen, in der Form sehr reinen und schönen Gefäßen mit gekrackter
brauner und gelber Glasur eine Reihe kleiner, gebrannter Tonfiguren anzuführen, die als
Grabbeigaben ihre Verwendung fanden und sowohl an sich als auch als Repräsentanten
der früheren Plastik überhaupt von großem Interesse sind. Die Gefäße späterer Stilperioden
repräsentieren eine Reihe jener grün glasierten Sefadonporzellane, einige sehr schöne
blau glasierte Kumen und Vasen mit Staubglasur (bleu poudrä). Besondere Erwähnung
verdienen noch die koreanischen Töpferarbeiten und endlich die japanischen und korea-
nischen Geräte zu den Teezeremonien, Chanoyu (Tafel XCIX, Fig. 4), teils Kumen, teils
kleine Deckelgefäße zur Aufbewahrung des fein gestoßenen, grünen Tees. Es sind dies
in einfachster Form, mit ihrer wunderbaren gleichmäßigen, samtartigen Glasur wohl die
schönsten Erzeugnisse ostasiatischer Keramik, die hier nur selten richtig gewertet werden,
sich aber in ihrer Heimat eines äußerst hohen Seltenheitswertes erfreuen. Die koreani-
schen Töpferarbeiten sind zum größten Teil prähistorisch und stammen von Ausgrabungen
aus der Gegend von Fusan.
Die Malerei wird ausschließlich durch japanische Arbeiten vertreten, eine Anzahl von
Kakemonos, Bildrollen und mehrteiligen Setzschirmen, diese wieder mit figuralem und
landschaftlichem Dekor, meist Kriegsszenen, ganz flächenhaft behandelt, vor weitem,
landschaftlichem Hintergrund, wie das für die national selbständigste der japanischen
Richtungen, die Tosa-Schule, der diese Arbeiten angehören, charakteristisch ist Von
den Kakemonos und Bildrollen verdienen wieder, Katalog Nr. 417, eine Darstellung
des westlichen Paradieses, Amida, mit den 25 Boddhisatvas aus dem 12. bis 13. Jahr-
a —ir-waT
190