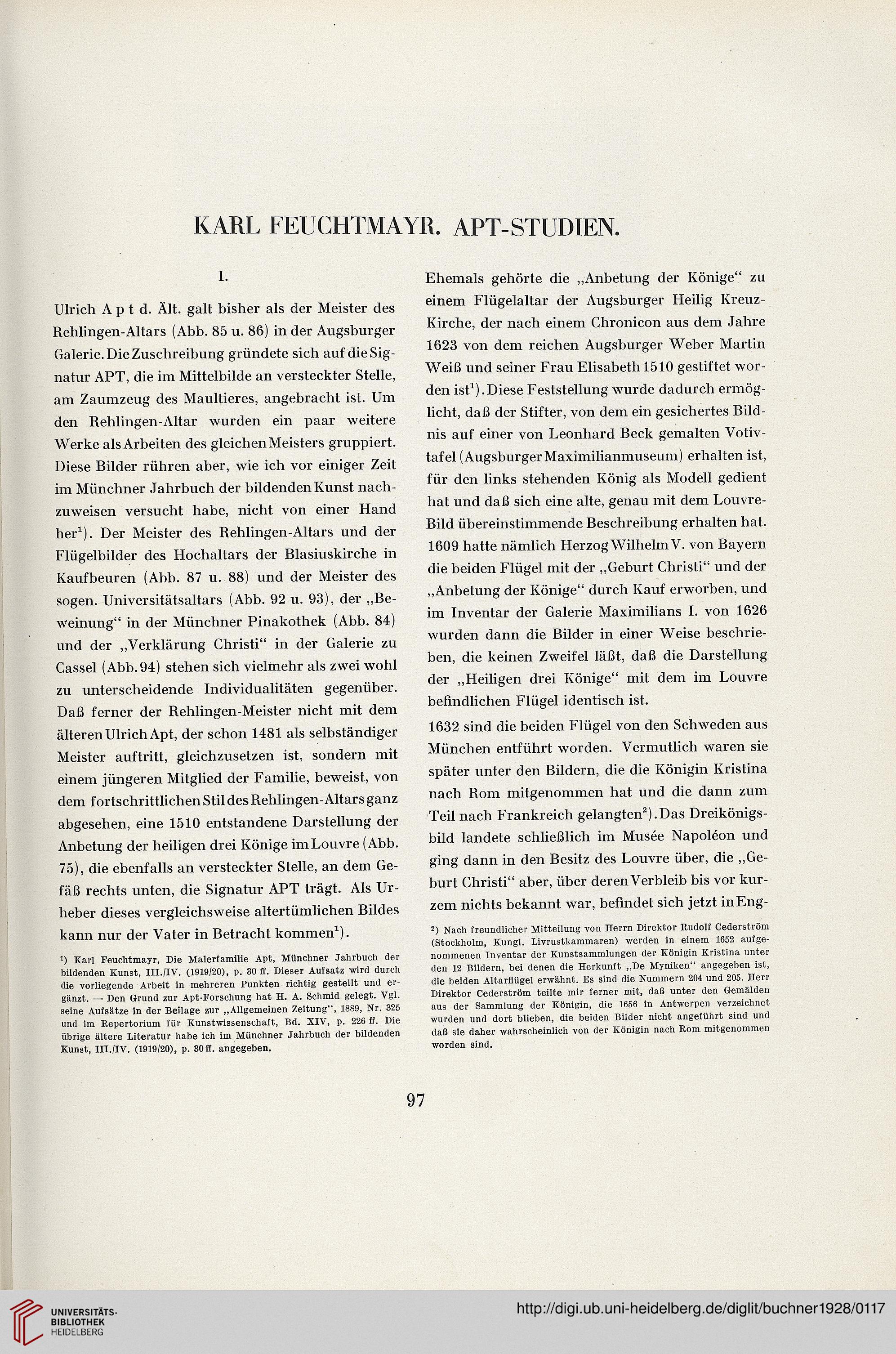KARL FEUCHTMAYR. APT-STUDIEN
I.
Ulrich A p t d. Alt. galt bisher als der Meister des
Rehlingen-Altars (Abb. 85 u. 86) in der Augsburger
Galerie. Die Zuschreibung gründete sich auf die Sig-
natur APT, die im Mittelbilde an versteckter Stelle,
am Zaumzeug des Maultieres, angebracht ist. Um
den Rehlingen-Altar wurden ein paar weitere
Werke als Arbeiten des gleichen Meisters gruppiert.
Diese Bilder rühren aber, wie ich vor einiger Zeit
im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst nach-
zuweisen versucht habe, nicht von einer Hand
her*). Der Meister des Rehlingen-Altars und der
Flügelbilder des Hochaltars der Blasiuskirche in
Kaufbeuren (Abb. 87 u. 88) und der Meister des
sogen. Universitätsaltars (Abb. 92 u. 93), der ,Be-
weinung" in der Münchner Pinakothek (Abb. 84)
und der ,Verklärung Christi" in der Galerie zu
Cassel (Abb. 94) stehen sich vielmehr als zwei wohl
zu unterscheidende Individualitäten gegenüber.
Daß ferner der Rehlingen-Meister nicht mit dem
älteren Ulrich Apt, der schon 1481 als selbständiger
Meister auftritt, gleichzusetzen ist, sondern mit
einem jüngeren Mitglied der Familie, beweist, von
dem fortschrittlichen Stil des Rehlingen-Altars ganz
abgesehen, eine 1510 entstandene Darstellung der
Anbetung der heiligen drei Könige im Louvre (Abb.
75), die ebenfalls an versteckter Stelle, an dem Ge-
fäß rechts unten, die Signatur APT trägt. Als Ur-
heber dieses vergleichsweise altertümlichen Bildes
kann nur der Vater in Betracht kommen*).
i) Karl Feuchtmayr, Die Malerfamiiie Apt, Münchner Jahrbuch der
bildenden Kunst, III.TV. (1919/20), p. 30 fr. Dieser Aufsatz wird durch
die vorliegende Arbeit in mehreren Punkten richtig gestellt und er-
gänzt. — Den Grund zur Apt-Forschung hat H. A. Schmid gelegt. Vgl.
seine Aufsätze in der Beilage zur ,,Allgemeinen Zeitung", 1889, Nr. 325
und im Repertorium für Kunstwissenschaft, Bd. XIV, p. 226 ff. Die
übrige ältere Literatur habe ich im Münchner Jahrbuch der bildenden
Kunst, III./IV. (1919/20), p. 30 ff. angegeben.
Ehemals gehörte die ,,Anbetung der Könige" zu
einem Flügelaltar der Augsburger Heilig Kreuz-
Kirche, der nach einem Ghronicon aus dem Jahre
1623 von dem reichen Augsburger Weber Martin
Weiß und seiner Frau Elisabeth 1510 gestiftet wor-
den ist*).Diese Feststellung wurde dadurch ermög-
licht, daß der Stifter, von dem ein gesichertes Bild-
nis auf einer von Leonhard Beck gemalten Votiv-
tafel (AugsburgerMaximilianmuseum) erhalten ist,
für den links stehenden König als Modell gedient
hat und daß sich eine alte, genau mit dem Louvre-
Bild übereinstimmende Beschreibung erhalten hat.
1609 hatte nämlich Herzog Wilhelm V. von Bayern
die beiden Flügel mit der ,,Geburt Christi" und der
,,Anbetung der Könige" durch Kauf erworben, und
im Inventar der Galerie Maximilians I. von 1626
wurden dann die Bilder in einer Weise beschrie-
ben, die keinen Zweifel läßt, daß die Darstellung
der ,,Heiligen drei Könige" mit dem im Louvre
befindlichen Flügel identisch ist.
1632 sind die beiden Flügel von den Schweden aus
München entführt worden. Vermutlich waren sie
später unter den Bildern, die die Königin Kristina
nach Rom mitgenommen hat und die dann zum
Teil nach Frankreich gelangten^).Das Dreikönigs-
bild landete schließlich im Musee Napoleon und
ging dann in den Besitz des Louvre über, die „Ge-
burt Christi" aber, über deren Verbleib bis vor kur-
zem nichts bekannt war, befindet sich jetzt inEng-
2) Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Direktor Rudolf Cederström
(Stockholm, Kungl. Livrustkammaren) werden in einem 1652 aufge-
nommenen Inventar der Kunstsammlungen der Königin Kristina unter
den 12 Bildern, bei denen die Herkunft „De Myniken" angegeben ist,
die beiden Altarflügel erwähnt. Es sind die Nummern 204 und 205. Herr
Direktor Cederström teilte mir ferner mit, daß unter den Gemälden
aus der Sammlung der Königin, die 1656 in Antwerpen verzeichnet
wurden und dort blieben, die beiden Bilder nicht angeführt sind und
daß sie daher wahrscheinlich von der Königin nach Rom mitgenommen
97
I.
Ulrich A p t d. Alt. galt bisher als der Meister des
Rehlingen-Altars (Abb. 85 u. 86) in der Augsburger
Galerie. Die Zuschreibung gründete sich auf die Sig-
natur APT, die im Mittelbilde an versteckter Stelle,
am Zaumzeug des Maultieres, angebracht ist. Um
den Rehlingen-Altar wurden ein paar weitere
Werke als Arbeiten des gleichen Meisters gruppiert.
Diese Bilder rühren aber, wie ich vor einiger Zeit
im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst nach-
zuweisen versucht habe, nicht von einer Hand
her*). Der Meister des Rehlingen-Altars und der
Flügelbilder des Hochaltars der Blasiuskirche in
Kaufbeuren (Abb. 87 u. 88) und der Meister des
sogen. Universitätsaltars (Abb. 92 u. 93), der ,Be-
weinung" in der Münchner Pinakothek (Abb. 84)
und der ,Verklärung Christi" in der Galerie zu
Cassel (Abb. 94) stehen sich vielmehr als zwei wohl
zu unterscheidende Individualitäten gegenüber.
Daß ferner der Rehlingen-Meister nicht mit dem
älteren Ulrich Apt, der schon 1481 als selbständiger
Meister auftritt, gleichzusetzen ist, sondern mit
einem jüngeren Mitglied der Familie, beweist, von
dem fortschrittlichen Stil des Rehlingen-Altars ganz
abgesehen, eine 1510 entstandene Darstellung der
Anbetung der heiligen drei Könige im Louvre (Abb.
75), die ebenfalls an versteckter Stelle, an dem Ge-
fäß rechts unten, die Signatur APT trägt. Als Ur-
heber dieses vergleichsweise altertümlichen Bildes
kann nur der Vater in Betracht kommen*).
i) Karl Feuchtmayr, Die Malerfamiiie Apt, Münchner Jahrbuch der
bildenden Kunst, III.TV. (1919/20), p. 30 fr. Dieser Aufsatz wird durch
die vorliegende Arbeit in mehreren Punkten richtig gestellt und er-
gänzt. — Den Grund zur Apt-Forschung hat H. A. Schmid gelegt. Vgl.
seine Aufsätze in der Beilage zur ,,Allgemeinen Zeitung", 1889, Nr. 325
und im Repertorium für Kunstwissenschaft, Bd. XIV, p. 226 ff. Die
übrige ältere Literatur habe ich im Münchner Jahrbuch der bildenden
Kunst, III./IV. (1919/20), p. 30 ff. angegeben.
Ehemals gehörte die ,,Anbetung der Könige" zu
einem Flügelaltar der Augsburger Heilig Kreuz-
Kirche, der nach einem Ghronicon aus dem Jahre
1623 von dem reichen Augsburger Weber Martin
Weiß und seiner Frau Elisabeth 1510 gestiftet wor-
den ist*).Diese Feststellung wurde dadurch ermög-
licht, daß der Stifter, von dem ein gesichertes Bild-
nis auf einer von Leonhard Beck gemalten Votiv-
tafel (AugsburgerMaximilianmuseum) erhalten ist,
für den links stehenden König als Modell gedient
hat und daß sich eine alte, genau mit dem Louvre-
Bild übereinstimmende Beschreibung erhalten hat.
1609 hatte nämlich Herzog Wilhelm V. von Bayern
die beiden Flügel mit der ,,Geburt Christi" und der
,,Anbetung der Könige" durch Kauf erworben, und
im Inventar der Galerie Maximilians I. von 1626
wurden dann die Bilder in einer Weise beschrie-
ben, die keinen Zweifel läßt, daß die Darstellung
der ,,Heiligen drei Könige" mit dem im Louvre
befindlichen Flügel identisch ist.
1632 sind die beiden Flügel von den Schweden aus
München entführt worden. Vermutlich waren sie
später unter den Bildern, die die Königin Kristina
nach Rom mitgenommen hat und die dann zum
Teil nach Frankreich gelangten^).Das Dreikönigs-
bild landete schließlich im Musee Napoleon und
ging dann in den Besitz des Louvre über, die „Ge-
burt Christi" aber, über deren Verbleib bis vor kur-
zem nichts bekannt war, befindet sich jetzt inEng-
2) Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Direktor Rudolf Cederström
(Stockholm, Kungl. Livrustkammaren) werden in einem 1652 aufge-
nommenen Inventar der Kunstsammlungen der Königin Kristina unter
den 12 Bildern, bei denen die Herkunft „De Myniken" angegeben ist,
die beiden Altarflügel erwähnt. Es sind die Nummern 204 und 205. Herr
Direktor Cederström teilte mir ferner mit, daß unter den Gemälden
aus der Sammlung der Königin, die 1656 in Antwerpen verzeichnet
wurden und dort blieben, die beiden Bilder nicht angeführt sind und
daß sie daher wahrscheinlich von der Königin nach Rom mitgenommen
97