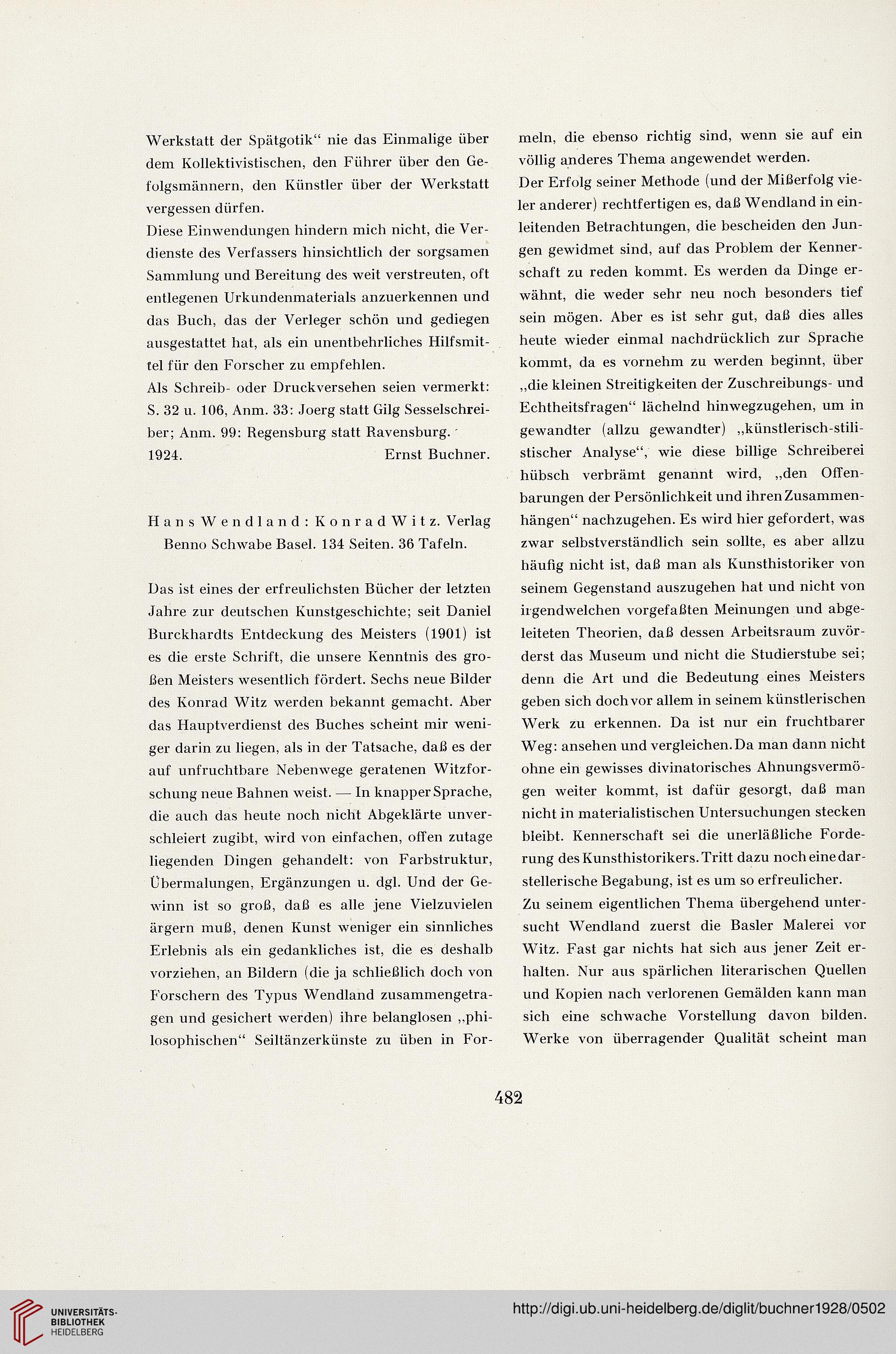Werkstatt der Spätgotik" nie das Einmalige über
dem Kollektivistischen, den Führer über den Ge-
folgsmännern, den Künstler über der Werkstatt
vergessen dürfen.
Diese Einwendungen hindern mich nicht, die Ver-
dienste des Verfassers hinsichtlich der sorgsamen
Sammlung und Bereitung des weit verstreuten, oft
entlegenen Urkundenmaterials anzuerkennen und
das Buch, das der Verleger schön und gediegen
ausgestattet hat, als ein unentbehrliches Hilfsmit-
tel für den Forscher zu empfehlen.
Als Schrei!)- oder Druckversehen seien vermerkt:
S. 32 u. 106, Anm. 33: Joerg statt Gilg Sesselschrei-
ber; Anm. 90: Regensburg statt Ravensburg.
1924. Ernst Büchner.
H a n s W e n d 1 a n d : K o n r a d W i t z. Verlag
Benno Schwabe Basel. 134 Seiten. 36 Tafeln.
Das ist eines der erfreulichsten Bücher der letzten
Jahre zur deutschen Kunstgeschichte; seit Daniel
Burckhardts Entdeckung des Meisters (1901) ist
es die erste Schrift, die unsere Kenntnis des gro-
llen Meisters wesentlich fördert. Sechs neue Bilder
des Konrad Witz werden bekannt gemacht. Aber
das Hauptverdienst des Buches scheint mir weni-
ger darin zu liegen, als in der Tatsache, daß es der
auf unfruchtbare Nebenwege geratenen Witzfor-
schung neue Bahnen weist. — In knapper Sprache,
die auch das heute noch nicht Abgeklärte unver-
schleiert zugibt, wird von einfachen, offen zutage
liegenden Dingen gehandelt: von Farbstruktur,
Übermalungen, Ergänzungen u. dgl. Und der Ge-
winn ist so groß, daß es alle jene Vielzuvielen
ärgern muß, denen Kunst weniger ein sinnliches
Erlebnis als ein gedankliches ist, die es deshalb
vorziehen, an Bildern (die ja schließlich doch von
Forschern des Typus Wendland zusammengetra-
gen und gesichert werden) ihre belanglosen ^phi-
losophischen" Seiltänzerkünste zu üben in For-
meln, die ebenso richtig sind, wenn sie auf ein
völlig anderes Thema angewendet werden.
Der Erfolg seiner Methode (und der Mißerfolg vie-
ler anderer) rechtfertigen es, daß Wendland in ein-
leitenden Betrachtungen, die bescheiden den Jun-
gen gewidmet sind, auf das Problem der Kenner-
schaft zu reden kommt. Es werden da Dinge er-
wähnt, die weder sehr neu noch besonders tief
sein mögen. Aber es ist sehr gut, daß dies alles
heute wieder einmal nachdrücklich zur Sprache
kommt, da es vornehm zu werden beginnt, über
,,die kleinen Streitigkeiten der Xuschreibungs- und
Echtheitsfragen" lächelnd hinwegzugehen, um in
gewandter (allzu gewandter) ^künstlerisch-stili-
stischer Analyse", wie diese billige Schreiberei
hübsch verbrämt genannt wird, ,,den Olfen-
barungen der Persönlichkeit und ihren Zusammen-
hängen" nachzugehen. Es wird hier gefordert, was
zwar selbstverständlich sein sollte, es aber allzu
häutig nicht ist, daß man als Kunsthistoriker von
seinem Gegenstand auszugehen hat und nicht von
irgendwelchen vorgefaßten Meinungen und abge-
leiteten Theorien, daß dessen Arbeitsraum zuvör-
derst das Museum und nicht die Studierstube sei;
denn die Art und die Bedeutung eines Meisters
gehen sich doch vor allem in seinem künstlerischen
Werk zu erkennen. Da ist nur ein fruchtbarer
Weg: ansehen und vergleichen.Da man dann nicht
ohne ein gewisses divinatorisches Ahnungsvermö-
gen weiter kommt, ist dafür gesorgt, daß man
nicht in materialistischen Untersuchungen stecken
bleibt. Kennerschaft sei die unerläßliche Forde-
rung des Kunsthistorikers. Tritt dazu noch eine dar-
stellerische Begabung, ist es um so erfreulicher.
Zu seinem eigentlichen Thema übergehend unter-
sucht Wendland zuerst die Basler Malerei vor
Witz. Fast gar nichts hat sich aus jener Zeit er-
halten. Nur aus spärlichen literarischen Quellen
und Kopien nach verlorenen Gemälden kann man
sich eine schwache Vorstellung davon bilden.
Werke von überragender Qualität scheint man
482
dem Kollektivistischen, den Führer über den Ge-
folgsmännern, den Künstler über der Werkstatt
vergessen dürfen.
Diese Einwendungen hindern mich nicht, die Ver-
dienste des Verfassers hinsichtlich der sorgsamen
Sammlung und Bereitung des weit verstreuten, oft
entlegenen Urkundenmaterials anzuerkennen und
das Buch, das der Verleger schön und gediegen
ausgestattet hat, als ein unentbehrliches Hilfsmit-
tel für den Forscher zu empfehlen.
Als Schrei!)- oder Druckversehen seien vermerkt:
S. 32 u. 106, Anm. 33: Joerg statt Gilg Sesselschrei-
ber; Anm. 90: Regensburg statt Ravensburg.
1924. Ernst Büchner.
H a n s W e n d 1 a n d : K o n r a d W i t z. Verlag
Benno Schwabe Basel. 134 Seiten. 36 Tafeln.
Das ist eines der erfreulichsten Bücher der letzten
Jahre zur deutschen Kunstgeschichte; seit Daniel
Burckhardts Entdeckung des Meisters (1901) ist
es die erste Schrift, die unsere Kenntnis des gro-
llen Meisters wesentlich fördert. Sechs neue Bilder
des Konrad Witz werden bekannt gemacht. Aber
das Hauptverdienst des Buches scheint mir weni-
ger darin zu liegen, als in der Tatsache, daß es der
auf unfruchtbare Nebenwege geratenen Witzfor-
schung neue Bahnen weist. — In knapper Sprache,
die auch das heute noch nicht Abgeklärte unver-
schleiert zugibt, wird von einfachen, offen zutage
liegenden Dingen gehandelt: von Farbstruktur,
Übermalungen, Ergänzungen u. dgl. Und der Ge-
winn ist so groß, daß es alle jene Vielzuvielen
ärgern muß, denen Kunst weniger ein sinnliches
Erlebnis als ein gedankliches ist, die es deshalb
vorziehen, an Bildern (die ja schließlich doch von
Forschern des Typus Wendland zusammengetra-
gen und gesichert werden) ihre belanglosen ^phi-
losophischen" Seiltänzerkünste zu üben in For-
meln, die ebenso richtig sind, wenn sie auf ein
völlig anderes Thema angewendet werden.
Der Erfolg seiner Methode (und der Mißerfolg vie-
ler anderer) rechtfertigen es, daß Wendland in ein-
leitenden Betrachtungen, die bescheiden den Jun-
gen gewidmet sind, auf das Problem der Kenner-
schaft zu reden kommt. Es werden da Dinge er-
wähnt, die weder sehr neu noch besonders tief
sein mögen. Aber es ist sehr gut, daß dies alles
heute wieder einmal nachdrücklich zur Sprache
kommt, da es vornehm zu werden beginnt, über
,,die kleinen Streitigkeiten der Xuschreibungs- und
Echtheitsfragen" lächelnd hinwegzugehen, um in
gewandter (allzu gewandter) ^künstlerisch-stili-
stischer Analyse", wie diese billige Schreiberei
hübsch verbrämt genannt wird, ,,den Olfen-
barungen der Persönlichkeit und ihren Zusammen-
hängen" nachzugehen. Es wird hier gefordert, was
zwar selbstverständlich sein sollte, es aber allzu
häutig nicht ist, daß man als Kunsthistoriker von
seinem Gegenstand auszugehen hat und nicht von
irgendwelchen vorgefaßten Meinungen und abge-
leiteten Theorien, daß dessen Arbeitsraum zuvör-
derst das Museum und nicht die Studierstube sei;
denn die Art und die Bedeutung eines Meisters
gehen sich doch vor allem in seinem künstlerischen
Werk zu erkennen. Da ist nur ein fruchtbarer
Weg: ansehen und vergleichen.Da man dann nicht
ohne ein gewisses divinatorisches Ahnungsvermö-
gen weiter kommt, ist dafür gesorgt, daß man
nicht in materialistischen Untersuchungen stecken
bleibt. Kennerschaft sei die unerläßliche Forde-
rung des Kunsthistorikers. Tritt dazu noch eine dar-
stellerische Begabung, ist es um so erfreulicher.
Zu seinem eigentlichen Thema übergehend unter-
sucht Wendland zuerst die Basler Malerei vor
Witz. Fast gar nichts hat sich aus jener Zeit er-
halten. Nur aus spärlichen literarischen Quellen
und Kopien nach verlorenen Gemälden kann man
sich eine schwache Vorstellung davon bilden.
Werke von überragender Qualität scheint man
482