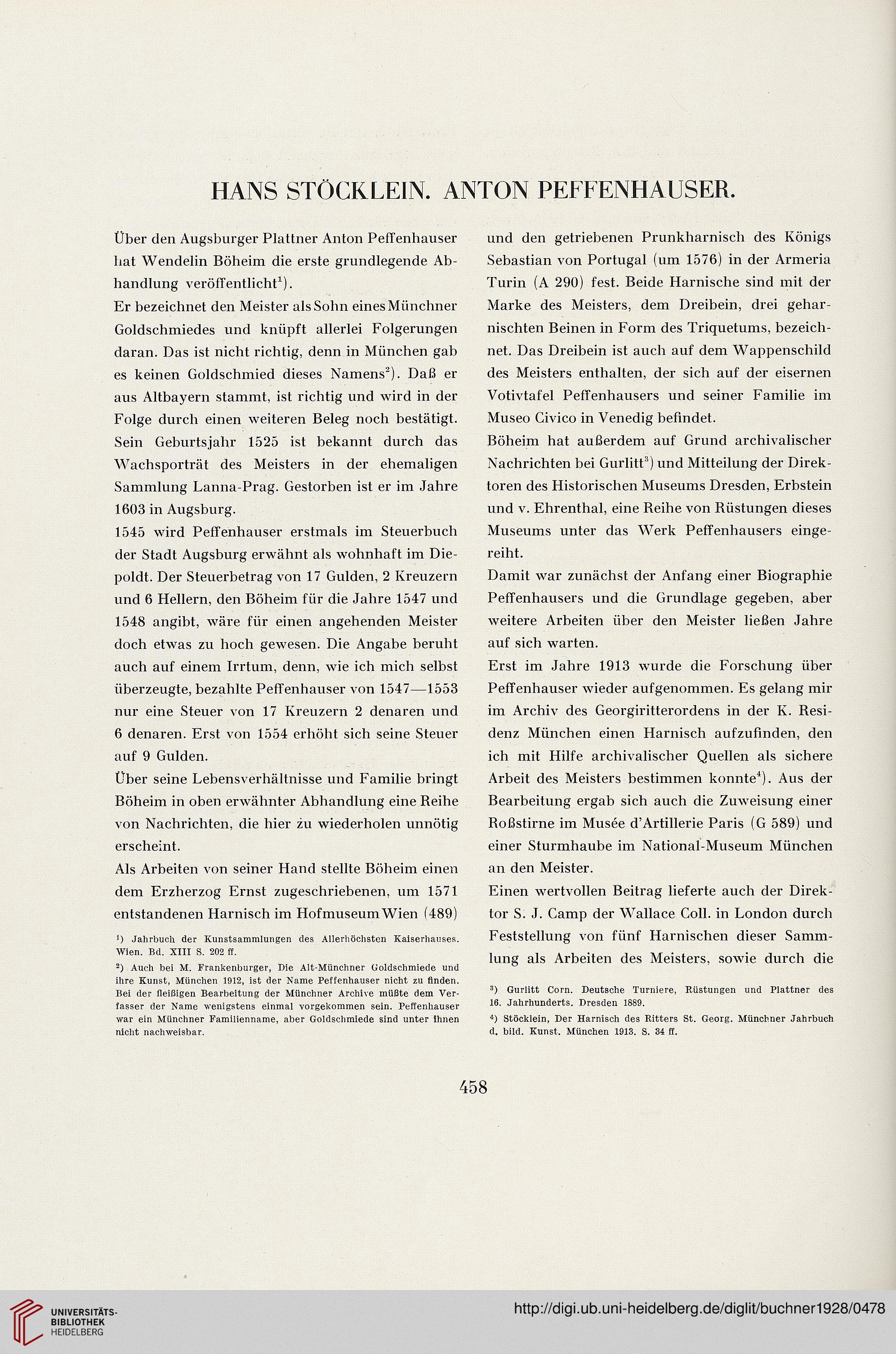HANS STÖEKEEtN. ANTON PEFFENHAUSER.
Über den Augsburger Plattner Anton Peffenhauser
hat Wendelin Böheim die erste grundlegende Ab-
handlung veröffentlicht^).
Er bezeichnet den Meister als Sohn eines Münchner
Goldschmiedes und knüpft allerlei Folgerungen
daran. Das ist nicht richtig, denn in München gab
es keinen Goldschmied dieses Namens'). Daß er
aus Altbayern stammt, ist richtig und wird in der
Folge durch einen weiteren Beleg noch bestätigt.
Sein Geburtsjahr 1525 ist bekannt durch das
Wachsporträt des Meisters in der ehemaligen
Sammlung Lanna-Prag. Gestorben ist er im Jahre
1603 in Augsburg.
1545 wird Pelfenhauser erstmals im Steuerbuch
der Stadt Augsburg erwähnt als wohnhaft im Die-
poldt. Der Steuerbetrag von 17 Gulden, 2 Kreuzern
und 6 Hellern, den Böheim für die Jahre 1547 und
1548 angibt, wäre für einen angehenden Meister
doch etwas zu hoch gewesen. Die Angabe beruht
auch auf einem Irrtum, denn, wie ich mich selbst
überzeugte, bezahlte Peffenhauser von 1547—1553
nur eine Steuer von 17 Kreuzern 2 denaren und
6 denaren. Erst von 1554 erhöbt sich seine Steuer
auf 9 Gulden.
Über seine Lebensverhältnisse und Familie bringt
Böheim in oben erwähnter Abhandlung eine Reihe
von Nachrichten, die hier zu wiederholen unnötig
erscheint.
Als Arbeiten von seiner Hand stellte Böheim einen
dem Erzherzog Ernst zugeschriebenen, um 1571
entstandenen Harnisch im HofmuseumWien (489)
Wien. Bti. XIII S. 202 ff.
und den getriebenen Prunkharnisch des Königs
Sebastian von Portugal (um 1576) in der Armeria
Turin (A 290) fest. Beide Harnische sind mit der
Marke des Meisters, dem Dreibein, drei gehar-
nischten Beinen in Form des Triquetums, bezeich-
net. Das Dreibein ist auch auf dem Wappenschild
des Meisters enthalten, der sich auf der eisernen
Votivtafel Peffenhausers und seiner Familie im
Museo Civico in Venedig befindet.
Böheim hat außerdem auf Grund archivaliscber
Nachrichten bei Gurlitt') und Mitteilung der Direk-
toren des Historischen Museums Dresden, Erbstein
und v. Ehrenthal, eine Reibe von Rüstungen dieses
Museums unter das Werk Peffenhausers einge-
reiht.
Damit war zunächst der Anfang einer Biographie
Peffenhausers und die Grundlage gegeben, aber
weitere Arbeiten über den Meister ließen Jahre
auf sich warten.
Erst im Jahre 1913 wurde die Forschung über
Peffenhauser wieder aufgenommen. Es gelang mir
im Archiv des Georgiritterordens in der K. Resi-
denz München einen Harnisch aufzufinden, den
ich mit Hilfe archivalischer Quellen als sichere
Arbeit des Meisters bestimmen konnte^). Aus der
Bearbeitung ergab sich auch die Zuweisung einer
Roßstirne im Musee d'Artillerie Paris (G 589) und
einer Sturmhaube im National-Museum München
an den Meister.
Einen wertvollen Beitrag lieferte auch der Direk-
tor S. J. Gamp der Wallace Coli, in London durch
Feststellung von fünf Harnischen dieser Samm-
lung als Arbeiten des Meisters, sowie durch die
3) Guriitt Com. Deutsche Turniere, Rüstungen und I'lattner des
16. Jahrhunderts. Dresden 1889.
d. biid. Kunst, München 1913. S. 34 ff.
458
Über den Augsburger Plattner Anton Peffenhauser
hat Wendelin Böheim die erste grundlegende Ab-
handlung veröffentlicht^).
Er bezeichnet den Meister als Sohn eines Münchner
Goldschmiedes und knüpft allerlei Folgerungen
daran. Das ist nicht richtig, denn in München gab
es keinen Goldschmied dieses Namens'). Daß er
aus Altbayern stammt, ist richtig und wird in der
Folge durch einen weiteren Beleg noch bestätigt.
Sein Geburtsjahr 1525 ist bekannt durch das
Wachsporträt des Meisters in der ehemaligen
Sammlung Lanna-Prag. Gestorben ist er im Jahre
1603 in Augsburg.
1545 wird Pelfenhauser erstmals im Steuerbuch
der Stadt Augsburg erwähnt als wohnhaft im Die-
poldt. Der Steuerbetrag von 17 Gulden, 2 Kreuzern
und 6 Hellern, den Böheim für die Jahre 1547 und
1548 angibt, wäre für einen angehenden Meister
doch etwas zu hoch gewesen. Die Angabe beruht
auch auf einem Irrtum, denn, wie ich mich selbst
überzeugte, bezahlte Peffenhauser von 1547—1553
nur eine Steuer von 17 Kreuzern 2 denaren und
6 denaren. Erst von 1554 erhöbt sich seine Steuer
auf 9 Gulden.
Über seine Lebensverhältnisse und Familie bringt
Böheim in oben erwähnter Abhandlung eine Reihe
von Nachrichten, die hier zu wiederholen unnötig
erscheint.
Als Arbeiten von seiner Hand stellte Böheim einen
dem Erzherzog Ernst zugeschriebenen, um 1571
entstandenen Harnisch im HofmuseumWien (489)
Wien. Bti. XIII S. 202 ff.
und den getriebenen Prunkharnisch des Königs
Sebastian von Portugal (um 1576) in der Armeria
Turin (A 290) fest. Beide Harnische sind mit der
Marke des Meisters, dem Dreibein, drei gehar-
nischten Beinen in Form des Triquetums, bezeich-
net. Das Dreibein ist auch auf dem Wappenschild
des Meisters enthalten, der sich auf der eisernen
Votivtafel Peffenhausers und seiner Familie im
Museo Civico in Venedig befindet.
Böheim hat außerdem auf Grund archivaliscber
Nachrichten bei Gurlitt') und Mitteilung der Direk-
toren des Historischen Museums Dresden, Erbstein
und v. Ehrenthal, eine Reibe von Rüstungen dieses
Museums unter das Werk Peffenhausers einge-
reiht.
Damit war zunächst der Anfang einer Biographie
Peffenhausers und die Grundlage gegeben, aber
weitere Arbeiten über den Meister ließen Jahre
auf sich warten.
Erst im Jahre 1913 wurde die Forschung über
Peffenhauser wieder aufgenommen. Es gelang mir
im Archiv des Georgiritterordens in der K. Resi-
denz München einen Harnisch aufzufinden, den
ich mit Hilfe archivalischer Quellen als sichere
Arbeit des Meisters bestimmen konnte^). Aus der
Bearbeitung ergab sich auch die Zuweisung einer
Roßstirne im Musee d'Artillerie Paris (G 589) und
einer Sturmhaube im National-Museum München
an den Meister.
Einen wertvollen Beitrag lieferte auch der Direk-
tor S. J. Gamp der Wallace Coli, in London durch
Feststellung von fünf Harnischen dieser Samm-
lung als Arbeiten des Meisters, sowie durch die
3) Guriitt Com. Deutsche Turniere, Rüstungen und I'lattner des
16. Jahrhunderts. Dresden 1889.
d. biid. Kunst, München 1913. S. 34 ff.
458