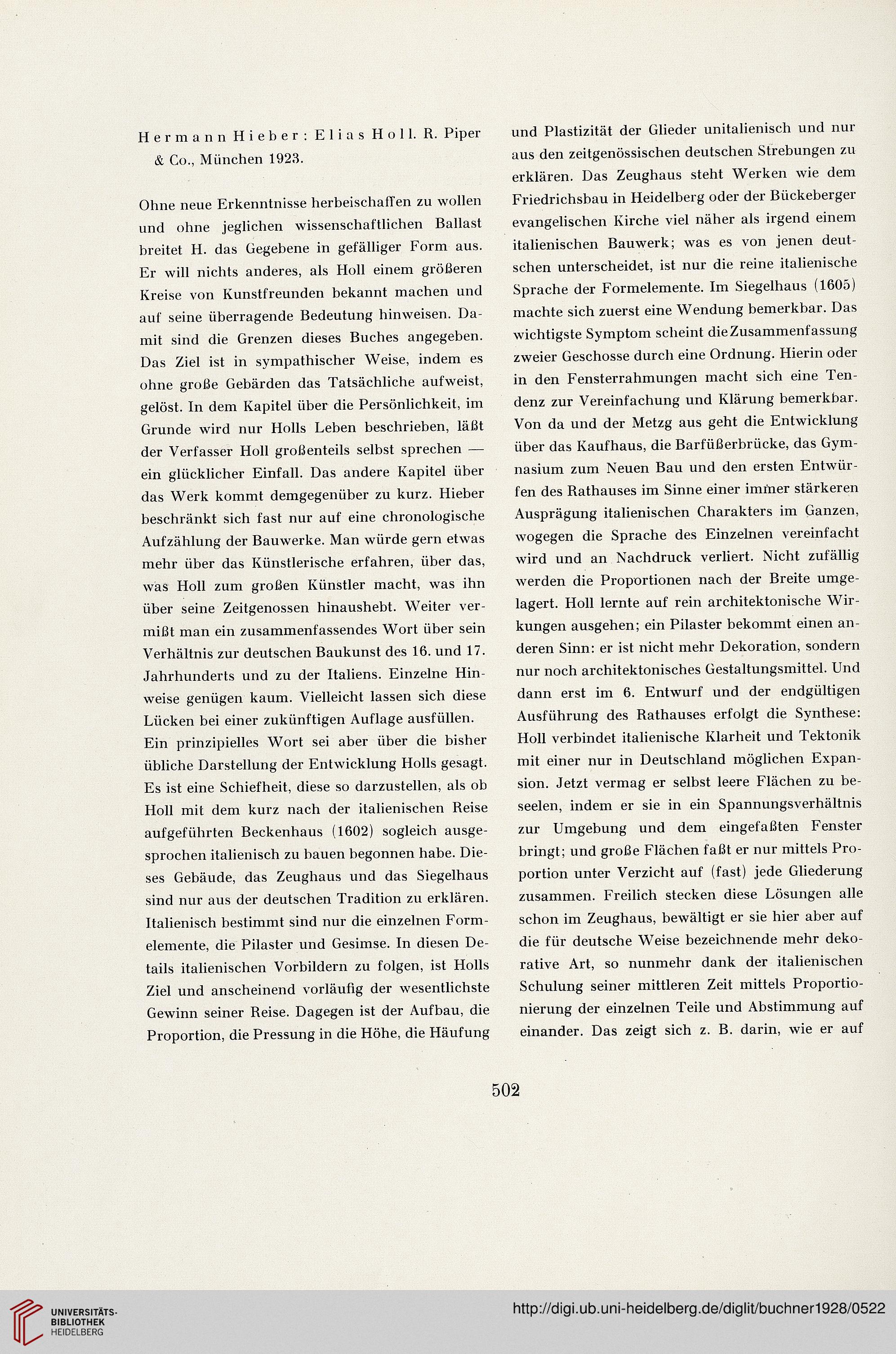HermannHieber:EliasHoll.R. Piper
& Go., München 1923.
Oime neue Erkenntnisse herbeischalfen zu woben
und ohne jegbchen wissenschaftlichen Ballast
breitet H. das Gegebene in gefälliger Form aus.
Er will nichts anderes, als Hob einem größeren
Kreise von Kunstfreunden bekannt machen und
auf seine überragende Bedeutung hinweisen. Da-
mit sind die Grenzen dieses Buches angegeben.
Das Ziel ist in sympathischer Weise, indem es
ohne große Gebärden das Tatsächliche aufweist,
gelöst. In dem Kapitel über die Persönlichkeit, im
Grunde wird nur Holls Leben beschrieben, läßt
der Verfasser Holl großenteils selbst sprechen —
ein glücklicher Einfall. Das andere Kapitel über
das Werk kommt demgegenüber zu kurz. Hieber
beschränkt sich fast nur auf eine chronologische
Aufzählung der Bauwerke. Man würde gern etwas
mehr über das Künstlerische erfahren, über das,
was Holl zum großen Künstler macht, was ihn
über seine Zeitgenossen hinaushebt. Weiter ver-
mißt man ein zusammenfassendes Wort über sein
Verhältnis zur deutschen Baukunst des 16. und 17.
Jahrhunderts und zu der Italiens. Einzelne Hin-
weise genügen kaum. Vielleicht lassen sich diese
Lücken bei einer zukünftigen Auflage ausfüllen.
Ein prinzipielles Wort sei aber über die bisher
übliche Darstellung der Entwicklung Holls gesagt.
Es ist eine Schiefheit, diese so darzustellen, als ob
Holl mit dem kurz nach der italienischen Reise
aufgeführten Beckenhaus (1602) sogleich ausge-
sprochen italienisch zu bauen begonnen habe. Die-
ses Gebäude, das Zeughaus und das Siegelhaus
sind nur aus der deutschen Tradition zu erklären.
Italienisch bestimmt sind nur die einzelnen Form-
elemente, die Pilaster und Gesimse. In diesen De-
tails italienischen Vorbildern zu folgen, ist Holls
Ziel und anscheinend vorläufig der wesentlichste
Gewinn seiner Reise. Dagegen ist der Aufbau, die
Proportion, die Pressung in die Höhe, die Häufung
und Plastizität der Glieder unitalienisch und nur
aus den zeitgenössischen deutschen Strebungen zu
erklären. Das Zeughaus steht Werken wie dem
Friedrichshau in Heidelberg oder der Bückeberger
evangelischen Kirche viel näher als irgend einem
italienischen Bauwerk; was es von jenen deut-
schen unterscheidet, ist nur die reine italienische
Sprache der Formelemente. Im Siegelhaus (1605)
machte sich zuerst eine Wendung bemerkbar. Das
wichtigste Symptom scheint die Zusammenfassung
zweier Geschosse durch eine Ordnung. Hierin oder
in den Fensterrahmungen macht sich eine Ten-
denz zur Vereinfachung und Klärung bemerkbar.
Von da und der Metzg aus geht die Entwicklung
über das Kaufhaus, die Barfüßerbrücke, das Gym-
nasium zum Neuen Bau und den ersten Entwür
fen des Rathauses im Sinne einer immer stärkeren
Ausprägung italienischen Charakters im Ganzen,
wogegen die Sprache des Einzelnen vereinfacht
wird und an Nachdruck verliert. Nicht zufällig
werden die Proportionen nach der Breite umge-
lagert. Holl lernte auf rein architektonische Wir-
kungen ausgehen; ein Pilaster bekommt einen an-
deren Sinn: er ist nicht mehr Dekoration, sondern
nur noch architektonisches Gestaltungsmittel. Und
dann erst im 6. Entwurf und der endgültigen
Ausführung des Rathauses erfolgt die Synthese:
Holl verbindet italienische Klarheit und Tektonik
mit einer nur in Deutschland möglichen Expan-
sion. Jetzt vermag er selbst leere Flächen zu be-
seelen, indem er sie in ein Spannungsverhältnis
zur Umgebung und dem eingefaßten Fenster
bringt; und große Flächen faßt er nur mittels Pro-
portion unter Verzicht auf (fast) jede Gliederung
zusammen. Freilich stecken diese Lösungen alle
schon im Zeughaus, bewältigt er sie hier aber auf
die für deutsche Weise bezeichnende mehr deko-
rative Art, so nunmehr dank der italienischen
Schulung seiner mittleren Zeit mittels Proportio-
nierung der einzelnen Teile und Abstimmung auf
einander. Das zeigt sich z. B. darin, wie er auf
502
& Go., München 1923.
Oime neue Erkenntnisse herbeischalfen zu woben
und ohne jegbchen wissenschaftlichen Ballast
breitet H. das Gegebene in gefälliger Form aus.
Er will nichts anderes, als Hob einem größeren
Kreise von Kunstfreunden bekannt machen und
auf seine überragende Bedeutung hinweisen. Da-
mit sind die Grenzen dieses Buches angegeben.
Das Ziel ist in sympathischer Weise, indem es
ohne große Gebärden das Tatsächliche aufweist,
gelöst. In dem Kapitel über die Persönlichkeit, im
Grunde wird nur Holls Leben beschrieben, läßt
der Verfasser Holl großenteils selbst sprechen —
ein glücklicher Einfall. Das andere Kapitel über
das Werk kommt demgegenüber zu kurz. Hieber
beschränkt sich fast nur auf eine chronologische
Aufzählung der Bauwerke. Man würde gern etwas
mehr über das Künstlerische erfahren, über das,
was Holl zum großen Künstler macht, was ihn
über seine Zeitgenossen hinaushebt. Weiter ver-
mißt man ein zusammenfassendes Wort über sein
Verhältnis zur deutschen Baukunst des 16. und 17.
Jahrhunderts und zu der Italiens. Einzelne Hin-
weise genügen kaum. Vielleicht lassen sich diese
Lücken bei einer zukünftigen Auflage ausfüllen.
Ein prinzipielles Wort sei aber über die bisher
übliche Darstellung der Entwicklung Holls gesagt.
Es ist eine Schiefheit, diese so darzustellen, als ob
Holl mit dem kurz nach der italienischen Reise
aufgeführten Beckenhaus (1602) sogleich ausge-
sprochen italienisch zu bauen begonnen habe. Die-
ses Gebäude, das Zeughaus und das Siegelhaus
sind nur aus der deutschen Tradition zu erklären.
Italienisch bestimmt sind nur die einzelnen Form-
elemente, die Pilaster und Gesimse. In diesen De-
tails italienischen Vorbildern zu folgen, ist Holls
Ziel und anscheinend vorläufig der wesentlichste
Gewinn seiner Reise. Dagegen ist der Aufbau, die
Proportion, die Pressung in die Höhe, die Häufung
und Plastizität der Glieder unitalienisch und nur
aus den zeitgenössischen deutschen Strebungen zu
erklären. Das Zeughaus steht Werken wie dem
Friedrichshau in Heidelberg oder der Bückeberger
evangelischen Kirche viel näher als irgend einem
italienischen Bauwerk; was es von jenen deut-
schen unterscheidet, ist nur die reine italienische
Sprache der Formelemente. Im Siegelhaus (1605)
machte sich zuerst eine Wendung bemerkbar. Das
wichtigste Symptom scheint die Zusammenfassung
zweier Geschosse durch eine Ordnung. Hierin oder
in den Fensterrahmungen macht sich eine Ten-
denz zur Vereinfachung und Klärung bemerkbar.
Von da und der Metzg aus geht die Entwicklung
über das Kaufhaus, die Barfüßerbrücke, das Gym-
nasium zum Neuen Bau und den ersten Entwür
fen des Rathauses im Sinne einer immer stärkeren
Ausprägung italienischen Charakters im Ganzen,
wogegen die Sprache des Einzelnen vereinfacht
wird und an Nachdruck verliert. Nicht zufällig
werden die Proportionen nach der Breite umge-
lagert. Holl lernte auf rein architektonische Wir-
kungen ausgehen; ein Pilaster bekommt einen an-
deren Sinn: er ist nicht mehr Dekoration, sondern
nur noch architektonisches Gestaltungsmittel. Und
dann erst im 6. Entwurf und der endgültigen
Ausführung des Rathauses erfolgt die Synthese:
Holl verbindet italienische Klarheit und Tektonik
mit einer nur in Deutschland möglichen Expan-
sion. Jetzt vermag er selbst leere Flächen zu be-
seelen, indem er sie in ein Spannungsverhältnis
zur Umgebung und dem eingefaßten Fenster
bringt; und große Flächen faßt er nur mittels Pro-
portion unter Verzicht auf (fast) jede Gliederung
zusammen. Freilich stecken diese Lösungen alle
schon im Zeughaus, bewältigt er sie hier aber auf
die für deutsche Weise bezeichnende mehr deko-
rative Art, so nunmehr dank der italienischen
Schulung seiner mittleren Zeit mittels Proportio-
nierung der einzelnen Teile und Abstimmung auf
einander. Das zeigt sich z. B. darin, wie er auf
502