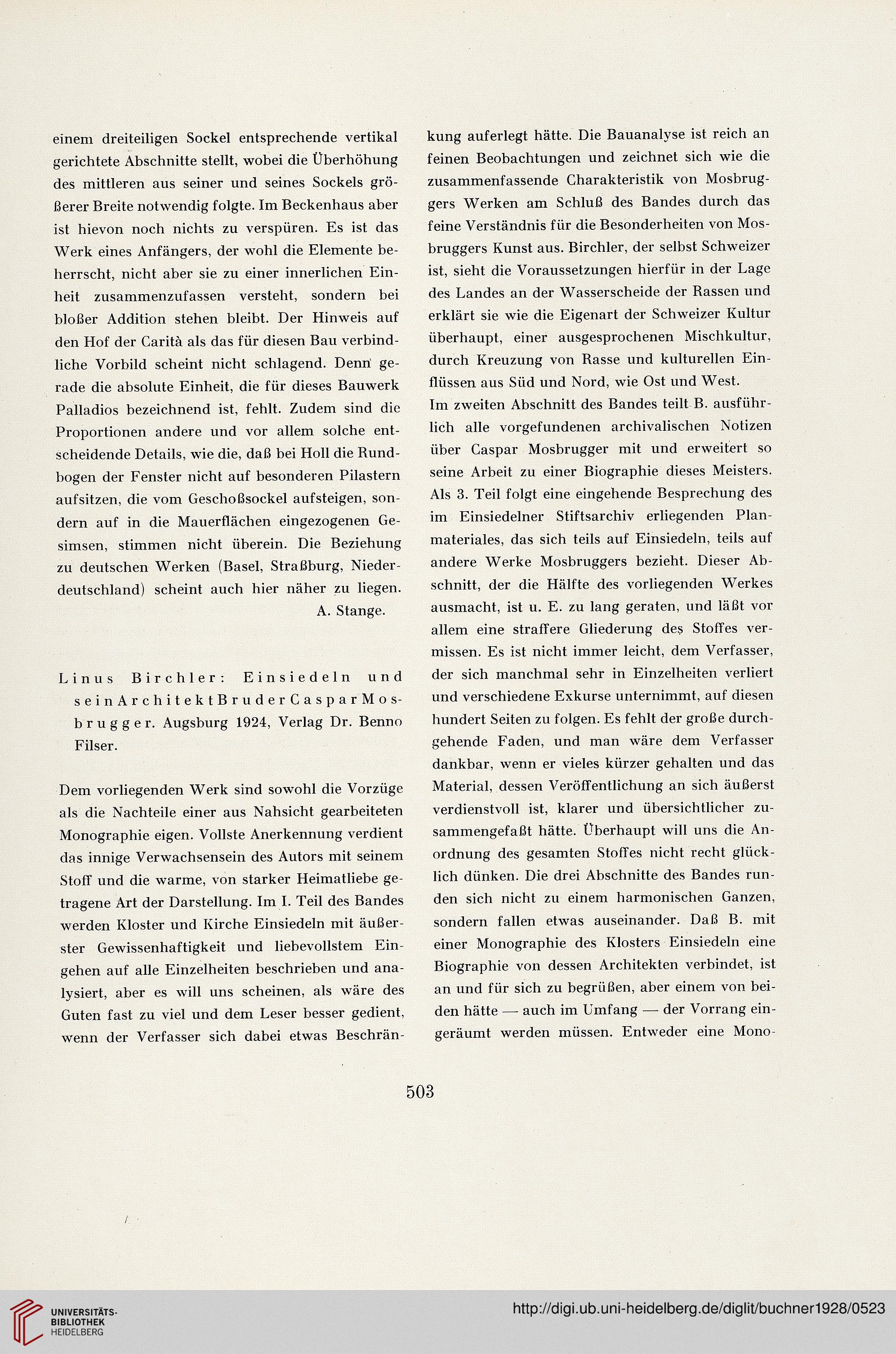einem dreiteiligen Sockel entsprechende vertikal
gerichtete Abschnitte stellt, wobei die Überhöhung
des mittleren aus seiner und seines Sockels grö-
ßerer Breite notwendig folgte. Im Beckenhaus aber
ist hievon noch nichts zu verspüren. Es ist das
Werk eines Anfängers, der wohl die Elemente be-
herrscht, nicht aber sie zu einer innerlichen Ein-
heit zusammenzufassen versteht, sondern bei
bloßer Addition stehen bleibt. Der Hinweis auf
den Hof der Garitä als das für diesen Bau verbind-
liche Vorbild scheint nicht schlagend. Denn ge-
rade die absolute Einheit, die für dieses Bauwerk
Palladios bezeichnend ist, fehlt. Zudem sind die
Proportionen andere und vor allem solche ent-
scheidende Details, wie die, daß hei Holl die Rund-
bogen der Fenster nicht auf besonderen Pilastern
aufsitzen, die vom Geschoßsockel aufsteigen, son-
dern auf in die Mauerflächen eingezogenen Ge-
simsen, stimmen nicht überein. Die Beziehung
zu deutschen Werken (Basel, Straßburg, Nieder-
deutschland) scheint auch hier näher zu liegen.
A. Stange.
Linus Birchler: Einsiedeln und
seinArchitektBruderCasparMos-
b r u g g e r. Augsburg 1924, Verlag Dr. Benno
Filser.
Dem vorliegenden Werk sind sowohl die Vorzüge
als die Nachteile einer aus Nahsicht gearbeiteten
Monographie eigen. Vollste Anerkennung verdient
das innige Verwachsensein des Autors mit seinem
Stoff und die warme, von starker Heimatliehe ge-
tragene Art der Darstellung. Im I. Teil des Bandes
werden Kloster und Kirche Einsiedeln mit äußer-
ster Gewissenhaftigkeit und liebevollstem Ein-
gehen auf alle Einzelheiten beschrieben und ana-
lysiert, aber es will uns scheinen, als wäre des
Guten fast zu viel und dem Leser besser gedient,
wenn der Verfasser sich dabei etwas Beschrän-
kung auferlegt hätte. Die Bauanalyse ist reich an
feinen Beobachtungen und zeichnet sich wie die
zusammenfassende Charakteristik von Mosbrug-
gers Werken am Schluß des Bandes durch das
feine Verständnis für die Besonderheiten von Mos-
bruggers Kunst aus. Birchler, der selbst Schweizer
ist, sieht die Voraussetzungen hierfür in der Lage
des Landes an der Wasserscheide der Rassen und
erklärt sie wie die Eigenart der Schweizer Kultur
überhaupt, einer ausgesprochenen Mischkultur,
durch Kreuzung von Rasse und kulturellen Ein-
flüssen aus Süd und Nord, wie Ost und West.
Im zweiten Abschnitt des Bandes teilt B. ausführ-
lich alle Vorgefundenen archivalischen Notizen
über Caspar Mosbrugger mit und erweitert so
seine Arbeit zu einer Biographie dieses Meisters.
Als 3. Teil folgt eine eingehende Besprechung des
im Einsiedelner Stiftsarchiv erliegenden Plan-
materiales, das sich teils auf Einsiedeln, teils auf
andere Werke Mosbruggers bezieht. Dieser Ab-
schnitt, der die Hälfte des vorliegenden Werkes
ausmacht, ist u. E. zu lang geraten, und läßt vor
allem eine straffere Gliederung des Stoffes ver-
missen. Es ist nicht immer leicht, dem Verfasser,
der sich manchmal sehr in Einzelheiten verliert
und verschiedene Exkurse unternimmt, auf diesen
hundert Seiten zu folgen. Es fehlt der große durch
gehende Faden, und man wäre dem Verfasser
dankbar, wenn er vieles kürzer gehalten und das
Material, dessen Veröffentlichung an sich äußerst
verdienstvoll ist, klarer und übersichtlicher zu-
sammengefaßt hätte. Überhaupt will uns die An-
ordnung des gesamten Stoffes nicht recht glück-
lich dünken. Die drei Abschnitte des Bandes run-
den sich nicht zu einem harmonischen Ganzen,
sondern fallen etwas auseinander. Daß B. mit
einer Monographie des Klosters Einsiedeln eine
Biographie von dessen Architekten verbindet, ist
an und für sich zu begrüßen, aber einem von bei-
den hätte — auch im Umfang — der Vorrang ein-
geräumt werden müssen. Entweder eine Mono-
503
/
gerichtete Abschnitte stellt, wobei die Überhöhung
des mittleren aus seiner und seines Sockels grö-
ßerer Breite notwendig folgte. Im Beckenhaus aber
ist hievon noch nichts zu verspüren. Es ist das
Werk eines Anfängers, der wohl die Elemente be-
herrscht, nicht aber sie zu einer innerlichen Ein-
heit zusammenzufassen versteht, sondern bei
bloßer Addition stehen bleibt. Der Hinweis auf
den Hof der Garitä als das für diesen Bau verbind-
liche Vorbild scheint nicht schlagend. Denn ge-
rade die absolute Einheit, die für dieses Bauwerk
Palladios bezeichnend ist, fehlt. Zudem sind die
Proportionen andere und vor allem solche ent-
scheidende Details, wie die, daß hei Holl die Rund-
bogen der Fenster nicht auf besonderen Pilastern
aufsitzen, die vom Geschoßsockel aufsteigen, son-
dern auf in die Mauerflächen eingezogenen Ge-
simsen, stimmen nicht überein. Die Beziehung
zu deutschen Werken (Basel, Straßburg, Nieder-
deutschland) scheint auch hier näher zu liegen.
A. Stange.
Linus Birchler: Einsiedeln und
seinArchitektBruderCasparMos-
b r u g g e r. Augsburg 1924, Verlag Dr. Benno
Filser.
Dem vorliegenden Werk sind sowohl die Vorzüge
als die Nachteile einer aus Nahsicht gearbeiteten
Monographie eigen. Vollste Anerkennung verdient
das innige Verwachsensein des Autors mit seinem
Stoff und die warme, von starker Heimatliehe ge-
tragene Art der Darstellung. Im I. Teil des Bandes
werden Kloster und Kirche Einsiedeln mit äußer-
ster Gewissenhaftigkeit und liebevollstem Ein-
gehen auf alle Einzelheiten beschrieben und ana-
lysiert, aber es will uns scheinen, als wäre des
Guten fast zu viel und dem Leser besser gedient,
wenn der Verfasser sich dabei etwas Beschrän-
kung auferlegt hätte. Die Bauanalyse ist reich an
feinen Beobachtungen und zeichnet sich wie die
zusammenfassende Charakteristik von Mosbrug-
gers Werken am Schluß des Bandes durch das
feine Verständnis für die Besonderheiten von Mos-
bruggers Kunst aus. Birchler, der selbst Schweizer
ist, sieht die Voraussetzungen hierfür in der Lage
des Landes an der Wasserscheide der Rassen und
erklärt sie wie die Eigenart der Schweizer Kultur
überhaupt, einer ausgesprochenen Mischkultur,
durch Kreuzung von Rasse und kulturellen Ein-
flüssen aus Süd und Nord, wie Ost und West.
Im zweiten Abschnitt des Bandes teilt B. ausführ-
lich alle Vorgefundenen archivalischen Notizen
über Caspar Mosbrugger mit und erweitert so
seine Arbeit zu einer Biographie dieses Meisters.
Als 3. Teil folgt eine eingehende Besprechung des
im Einsiedelner Stiftsarchiv erliegenden Plan-
materiales, das sich teils auf Einsiedeln, teils auf
andere Werke Mosbruggers bezieht. Dieser Ab-
schnitt, der die Hälfte des vorliegenden Werkes
ausmacht, ist u. E. zu lang geraten, und läßt vor
allem eine straffere Gliederung des Stoffes ver-
missen. Es ist nicht immer leicht, dem Verfasser,
der sich manchmal sehr in Einzelheiten verliert
und verschiedene Exkurse unternimmt, auf diesen
hundert Seiten zu folgen. Es fehlt der große durch
gehende Faden, und man wäre dem Verfasser
dankbar, wenn er vieles kürzer gehalten und das
Material, dessen Veröffentlichung an sich äußerst
verdienstvoll ist, klarer und übersichtlicher zu-
sammengefaßt hätte. Überhaupt will uns die An-
ordnung des gesamten Stoffes nicht recht glück-
lich dünken. Die drei Abschnitte des Bandes run-
den sich nicht zu einem harmonischen Ganzen,
sondern fallen etwas auseinander. Daß B. mit
einer Monographie des Klosters Einsiedeln eine
Biographie von dessen Architekten verbindet, ist
an und für sich zu begrüßen, aber einem von bei-
den hätte — auch im Umfang — der Vorrang ein-
geräumt werden müssen. Entweder eine Mono-
503
/