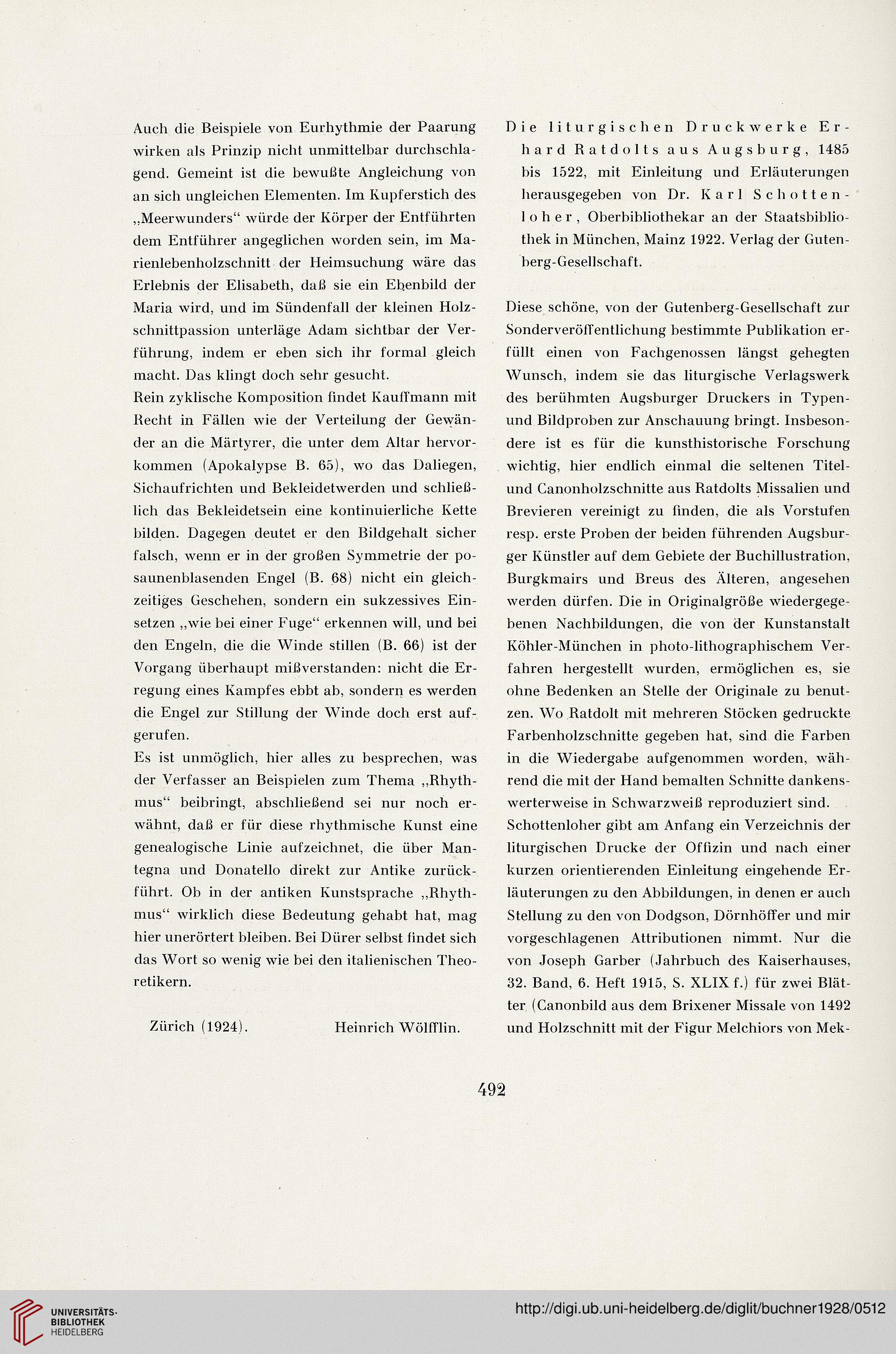Auch die Beispiele von Eurhythmie der Paarung
wirken als Prinzip nicht unmittelbar durchschla-
gend. Gemeint ist die bewußte Angleichung von
an sich ungleichen Elementen. Im Kupf erstich des
,,Meerwunders" würde der Körper der Entführten
dem Entführer angeglichen worden sein, im Ma-
rienlebenholzschnitt der Heimsuchung wäre das
Erlebnis der Elisabeth, daß sie ein Ebenbild der
Maria wird, und im Sündenfall der kleinen Holz-
schnittpassion unterläge Adam sichtbar der Ver-
führung, indem er eben sich ihr formal gleich
macht. Das klingt doch sehr gesucht.
Bein zyklische Komposition findet Kaufl'mann mit
Recht in Fällen wie der Verteilung der Gewän-
der an die Märtyrer, die unter dem Altar hervor-
kommen (Apokalypse B. 65), wo das Daliegen,
Sichaufrichten und Bekleidetwerden und schließ-
lich das Bekleidetsein eine kontinuierliche Kette
bilden. Dagegen deutet er den Bildgehalt sicher
falsch, wenn er in der großen Symmetrie der po-
saunenblasenden Engel (B. 68) nicht ein gleich-
zeitiges Geschehen, sondern ein sukzessives Ein-
setzen ,,wie bei einer Fuge" erkennen will, und bei
den Engeln, die die Winde stillen (B. 66) ist der
Vorgang überhaupt mißverstanden: nicht die Er-
regung eines Kampfes ebbt ab, sondern es werden
die Engel zur Stillung der Winde doch erst auf-
gerufen.
Es ist unmöglich, hier alles zu besprechen, was
der Verfasser an Beispielen zum Thema ,.Bhyth-
mus" beibringt, abschließend sei nur noch er-
wähnt, daß er für diese rhythmische Kunst eine
genealogische Linie aufzeichnet, die über Man-
tegna und Donatello direkt zur Antike zurück-
führt. Ob in der antiken Kunstsprache ,,Khyth-
mus" wirklich diese Bedeutung gehabt hat, mag
hier unerörtert bleiben. Bei Dürer selbst findet sich
das Wort so wenig wie bei den italienischen Theo-
retikern.
Zürich (1924). Heinrich WölfHin.
Die liturgischen Druckwerke Er-
hard B a t d o 1 t s aus Augsburg, 1485
bis 1522, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben von Dr. Karl Schotten-
1 o her, Oberbibliothekar an der Staatsbiblio-
thek in München, Mainz 1922. Verlag der Guten-
berg-Gesellschaft.
Diese schöne, von der Gutenherg-Gesellschaft zur
Sonderverölfentlichung bestimmte Publikation er-
füllt einen von Fachgenossen längst gehegten
Wunsch, indem sie das liturgische Verlagswerk
des berühmten Augsburger Druckers in Typen-
und Bildproben zur Anschauung bringt. Insbeson-
dere ist es für die kunsthistorische Forschung
wichtig, hier endlich einmal die seltenen Titel-
und Ganonholzschnitte aus Batdolts Missalien und
Brevieren vereinigt zu finden, die als Vorstufen
resp. erste Proben der beiden führenden Augsbur-
ger Künstler auf dem Gebiete der Buchillustration,
Burgkmairs und Breus des Älteren, angesehen
werden dürfen. Die in Originalgröße wiedergege-
henen Nachbildungen, die von der Kunstanstalt
Köhler-München in photo-lithographischem Ver-
fahren hergestellt wurden, ermöglichen es, sie
ohne Bedenken an Stelle der Originale zu benut-
zen. Wo Batdolt mit mehreren Stöcken gedruckte
Farbenholzschnitte gegeben hat, sind die Farben
in die Wiedergabe aufgenommen worden, wäh-
rend die mit der Hand bemalten Schnitte dankens-
werterweise in Schwarzweiß reproduziert sind.
Schottenloher gibt am Anfang ein Verzeichnis der
liturgischen Drucke der Offizin und nach einer
kurzen orientierenden Einleitung eingehende Er-
läuterungen zu den Abbildungen, in denen er auch
Stellung zu den von Dodgson, DörnhöfTer und mir
vorgeschlagenen Attributionen nimmt. Nur die
von Joseph Garber (Jahrbuch des Kaiserhauses,
32. Band, 6. Heft 1915, S. XLIX f.) für zwei Blät-
ter (Ganonbild aus dem Brixener Missale von 1492
und Holzschnitt mit der Figur Melchiors von Mek-
492
wirken als Prinzip nicht unmittelbar durchschla-
gend. Gemeint ist die bewußte Angleichung von
an sich ungleichen Elementen. Im Kupf erstich des
,,Meerwunders" würde der Körper der Entführten
dem Entführer angeglichen worden sein, im Ma-
rienlebenholzschnitt der Heimsuchung wäre das
Erlebnis der Elisabeth, daß sie ein Ebenbild der
Maria wird, und im Sündenfall der kleinen Holz-
schnittpassion unterläge Adam sichtbar der Ver-
führung, indem er eben sich ihr formal gleich
macht. Das klingt doch sehr gesucht.
Bein zyklische Komposition findet Kaufl'mann mit
Recht in Fällen wie der Verteilung der Gewän-
der an die Märtyrer, die unter dem Altar hervor-
kommen (Apokalypse B. 65), wo das Daliegen,
Sichaufrichten und Bekleidetwerden und schließ-
lich das Bekleidetsein eine kontinuierliche Kette
bilden. Dagegen deutet er den Bildgehalt sicher
falsch, wenn er in der großen Symmetrie der po-
saunenblasenden Engel (B. 68) nicht ein gleich-
zeitiges Geschehen, sondern ein sukzessives Ein-
setzen ,,wie bei einer Fuge" erkennen will, und bei
den Engeln, die die Winde stillen (B. 66) ist der
Vorgang überhaupt mißverstanden: nicht die Er-
regung eines Kampfes ebbt ab, sondern es werden
die Engel zur Stillung der Winde doch erst auf-
gerufen.
Es ist unmöglich, hier alles zu besprechen, was
der Verfasser an Beispielen zum Thema ,.Bhyth-
mus" beibringt, abschließend sei nur noch er-
wähnt, daß er für diese rhythmische Kunst eine
genealogische Linie aufzeichnet, die über Man-
tegna und Donatello direkt zur Antike zurück-
führt. Ob in der antiken Kunstsprache ,,Khyth-
mus" wirklich diese Bedeutung gehabt hat, mag
hier unerörtert bleiben. Bei Dürer selbst findet sich
das Wort so wenig wie bei den italienischen Theo-
retikern.
Zürich (1924). Heinrich WölfHin.
Die liturgischen Druckwerke Er-
hard B a t d o 1 t s aus Augsburg, 1485
bis 1522, mit Einleitung und Erläuterungen
herausgegeben von Dr. Karl Schotten-
1 o her, Oberbibliothekar an der Staatsbiblio-
thek in München, Mainz 1922. Verlag der Guten-
berg-Gesellschaft.
Diese schöne, von der Gutenherg-Gesellschaft zur
Sonderverölfentlichung bestimmte Publikation er-
füllt einen von Fachgenossen längst gehegten
Wunsch, indem sie das liturgische Verlagswerk
des berühmten Augsburger Druckers in Typen-
und Bildproben zur Anschauung bringt. Insbeson-
dere ist es für die kunsthistorische Forschung
wichtig, hier endlich einmal die seltenen Titel-
und Ganonholzschnitte aus Batdolts Missalien und
Brevieren vereinigt zu finden, die als Vorstufen
resp. erste Proben der beiden führenden Augsbur-
ger Künstler auf dem Gebiete der Buchillustration,
Burgkmairs und Breus des Älteren, angesehen
werden dürfen. Die in Originalgröße wiedergege-
henen Nachbildungen, die von der Kunstanstalt
Köhler-München in photo-lithographischem Ver-
fahren hergestellt wurden, ermöglichen es, sie
ohne Bedenken an Stelle der Originale zu benut-
zen. Wo Batdolt mit mehreren Stöcken gedruckte
Farbenholzschnitte gegeben hat, sind die Farben
in die Wiedergabe aufgenommen worden, wäh-
rend die mit der Hand bemalten Schnitte dankens-
werterweise in Schwarzweiß reproduziert sind.
Schottenloher gibt am Anfang ein Verzeichnis der
liturgischen Drucke der Offizin und nach einer
kurzen orientierenden Einleitung eingehende Er-
läuterungen zu den Abbildungen, in denen er auch
Stellung zu den von Dodgson, DörnhöfTer und mir
vorgeschlagenen Attributionen nimmt. Nur die
von Joseph Garber (Jahrbuch des Kaiserhauses,
32. Band, 6. Heft 1915, S. XLIX f.) für zwei Blät-
ter (Ganonbild aus dem Brixener Missale von 1492
und Holzschnitt mit der Figur Melchiors von Mek-
492