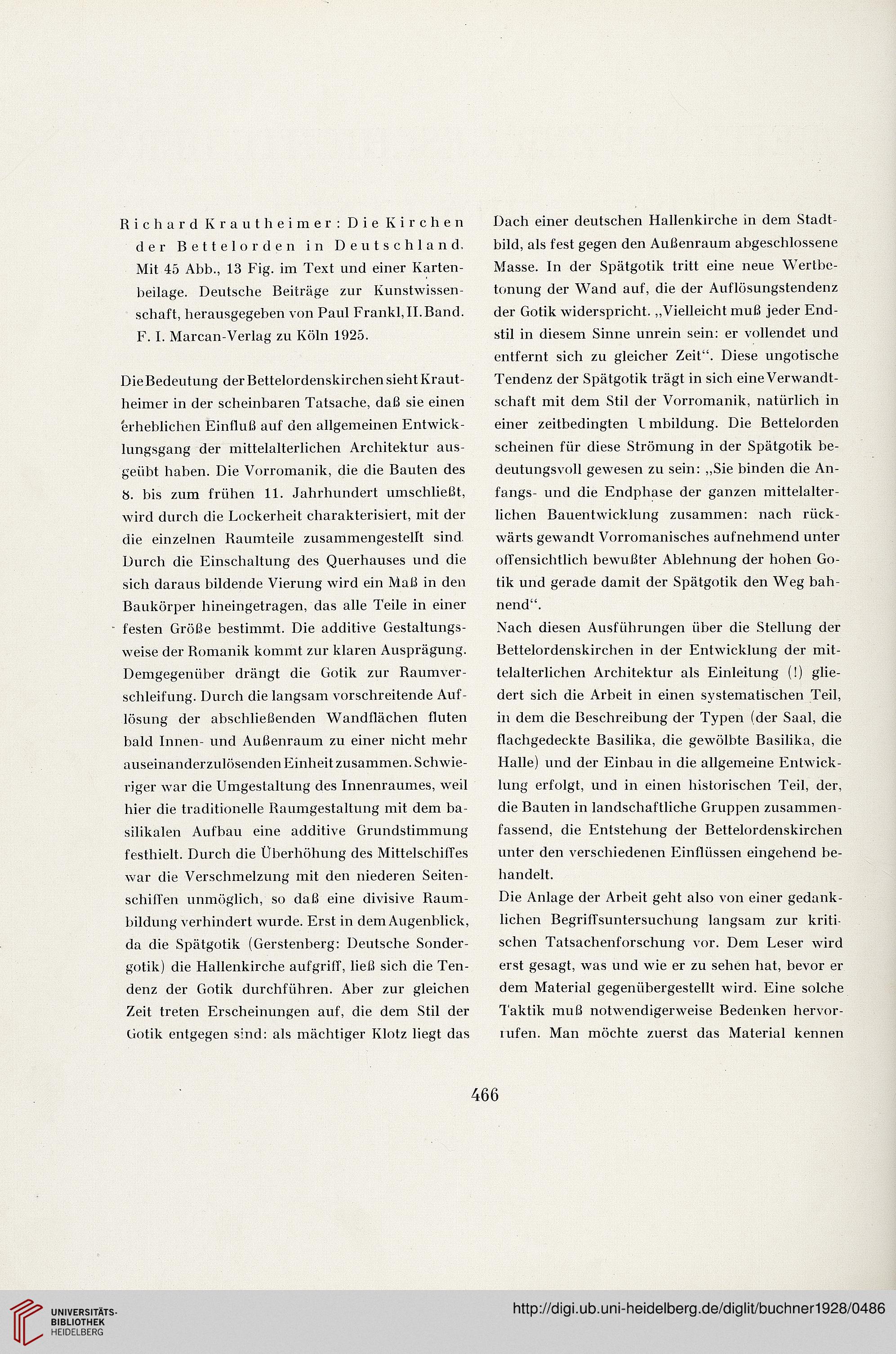Richard Krautheimer: Die Kirchen
der Betteiorden in Deutschland.
Mit 45 Abb., 13 Fig. im Text und einer Karten-
heiiage. Deutsche Beiträge zur Kunstwissen-
schaft, herausgegeben von Paul Frankl,II.Band.
F. I. Marcan-Veriag zu Köln 1925.
Die Bedeutung der Bettelordenskirchen sieht Kraut-
heimer in der scheinbaren Tatsache, daß sie einen
erheblichen Einfluß auf den allgemeinen Entwick-
lungsgang der mittelalterlichen Architektur aus-
geüht haben. Die Vorromanik, die die Bauten des
3. bis zum frühen 11. Jahrhundert umschließt,
wird durch die Lockerheit charakterisiert, mit der
die einzelnen Raumteile zusammengestellt sind
Durch die Einschaltung des Querhauses und die
sich daraus bildende Vierung wird ein Maß in den
Baukörper hineingetragen, das alle Teile in einer
festen Größe bestimmt. Die additive Gestaltungs-
weise der Romanik kommt zur klaren Ausprägung.
Demgegenüber drängt die Gotik zur Raumver-
schleifung. Durch die langsam vorschreitende Auf-
lösung der abschließenden Wandflächen fluten
bald Innen- und Außenraum zu einer nicht mehr
auseinanderzulüsenden Einheit zusammen. Schwie-
riger war die Umgestaltung des Innenraumes, weil
hier die traditionelle Raumgestaltung mit dem ba-
silikalen Aufbau eine additive Grundstimmung
festhielt. Durch die Überhöhung des Alittelschilfes
war die Verschmelzung mit den niederen Seiten-
schiffen unmöglich, so daß eine divisive Raum-
bildung verhindert wurde. Erst in demAugenblick,
da die Spätgotik (Gerstenberg: Deutsche Sonder-
gotik) die Hallenkirche aufgrilf, ließ sich die Ten-
denz der Gotik durchführen. Aber zur gleichen
Zeit treten Erscheinungen auf, die dem Stil der
Gotik entgegen sind: als mächtiger Klotz liegt das
Dach einer deutschen Hallenkirche in dem Stadt-
bild, als fest gegen den Außenraum abgeschlossene
Masse. In der Spätgotik tritt eine neue Werthc-
tonung der Wand auf, die der Auflösungstendenz
der Gotik widerspricht. ,,Vielleicht muß jeder End-
stil in diesem Sinne unrein sein: er vollendet und
entfernt sich zu gleicher Zeit". Diese ungotische
Tendenz der Spätgotik trägt in sich eine Verwandt-
schaft mit dem Stil der Vorromanik, natürlich in
einer zeitbedingten Lmhildung. Die Bettelorden
scheinen für diese Strömung in der Spätgotik be-
deutungsvoll gewesen zu sein: ,,Sie binden die An-
fangs- und die Endphase der ganzen mittelalter-
lichen Bauentwicklung zusammen: nach rück-
wärts gewandt Vorromanisches aufnehmend unter
olfensichtlich bewußter Ablehnung der hohen Go-
tik und gerade damit der Spätgotik den Weg bah-
nend".
Nach diesen Ausführungen über die Stellung der
Bettelordenskirchen in der Entwicklung der mit-
telalterlichen Architektur als Einleitung (!) glie-
dert sich die Arbeit in einen systematischen Teil,
in dem die Beschreibung der Typen (der Saal, die
flachgedeckte Basilika, die gewölbte Basilika, die
Halle) und der Einhau in die allgemeine Entwick-
lung erfolgt, und in einen historischen Teil, der,
die Bauten in landschaftliche Gruppen zusammen-
fassend, die Entstehung der Bettelordenskirchen
unter den verschiedenen Einflüssen eingehend be-
handelt.
Die Anlage der Arbeit geht also von einer gedank-
lichen Begrilfsuntersuclmng langsam zur kriti
sehen Tatsachenforschung vor. Dem Leser wird
erst gesagt, was und wie er zu sehen hat, bevor er
dem Material gegenühergestellt wird. Eine solche
Taktik muß notwendigerweise Bedenken hervor-
iufen. Man möchte zuerst das Material kennen
466
der Betteiorden in Deutschland.
Mit 45 Abb., 13 Fig. im Text und einer Karten-
heiiage. Deutsche Beiträge zur Kunstwissen-
schaft, herausgegeben von Paul Frankl,II.Band.
F. I. Marcan-Veriag zu Köln 1925.
Die Bedeutung der Bettelordenskirchen sieht Kraut-
heimer in der scheinbaren Tatsache, daß sie einen
erheblichen Einfluß auf den allgemeinen Entwick-
lungsgang der mittelalterlichen Architektur aus-
geüht haben. Die Vorromanik, die die Bauten des
3. bis zum frühen 11. Jahrhundert umschließt,
wird durch die Lockerheit charakterisiert, mit der
die einzelnen Raumteile zusammengestellt sind
Durch die Einschaltung des Querhauses und die
sich daraus bildende Vierung wird ein Maß in den
Baukörper hineingetragen, das alle Teile in einer
festen Größe bestimmt. Die additive Gestaltungs-
weise der Romanik kommt zur klaren Ausprägung.
Demgegenüber drängt die Gotik zur Raumver-
schleifung. Durch die langsam vorschreitende Auf-
lösung der abschließenden Wandflächen fluten
bald Innen- und Außenraum zu einer nicht mehr
auseinanderzulüsenden Einheit zusammen. Schwie-
riger war die Umgestaltung des Innenraumes, weil
hier die traditionelle Raumgestaltung mit dem ba-
silikalen Aufbau eine additive Grundstimmung
festhielt. Durch die Überhöhung des Alittelschilfes
war die Verschmelzung mit den niederen Seiten-
schiffen unmöglich, so daß eine divisive Raum-
bildung verhindert wurde. Erst in demAugenblick,
da die Spätgotik (Gerstenberg: Deutsche Sonder-
gotik) die Hallenkirche aufgrilf, ließ sich die Ten-
denz der Gotik durchführen. Aber zur gleichen
Zeit treten Erscheinungen auf, die dem Stil der
Gotik entgegen sind: als mächtiger Klotz liegt das
Dach einer deutschen Hallenkirche in dem Stadt-
bild, als fest gegen den Außenraum abgeschlossene
Masse. In der Spätgotik tritt eine neue Werthc-
tonung der Wand auf, die der Auflösungstendenz
der Gotik widerspricht. ,,Vielleicht muß jeder End-
stil in diesem Sinne unrein sein: er vollendet und
entfernt sich zu gleicher Zeit". Diese ungotische
Tendenz der Spätgotik trägt in sich eine Verwandt-
schaft mit dem Stil der Vorromanik, natürlich in
einer zeitbedingten Lmhildung. Die Bettelorden
scheinen für diese Strömung in der Spätgotik be-
deutungsvoll gewesen zu sein: ,,Sie binden die An-
fangs- und die Endphase der ganzen mittelalter-
lichen Bauentwicklung zusammen: nach rück-
wärts gewandt Vorromanisches aufnehmend unter
olfensichtlich bewußter Ablehnung der hohen Go-
tik und gerade damit der Spätgotik den Weg bah-
nend".
Nach diesen Ausführungen über die Stellung der
Bettelordenskirchen in der Entwicklung der mit-
telalterlichen Architektur als Einleitung (!) glie-
dert sich die Arbeit in einen systematischen Teil,
in dem die Beschreibung der Typen (der Saal, die
flachgedeckte Basilika, die gewölbte Basilika, die
Halle) und der Einhau in die allgemeine Entwick-
lung erfolgt, und in einen historischen Teil, der,
die Bauten in landschaftliche Gruppen zusammen-
fassend, die Entstehung der Bettelordenskirchen
unter den verschiedenen Einflüssen eingehend be-
handelt.
Die Anlage der Arbeit geht also von einer gedank-
lichen Begrilfsuntersuclmng langsam zur kriti
sehen Tatsachenforschung vor. Dem Leser wird
erst gesagt, was und wie er zu sehen hat, bevor er
dem Material gegenühergestellt wird. Eine solche
Taktik muß notwendigerweise Bedenken hervor-
iufen. Man möchte zuerst das Material kennen
466