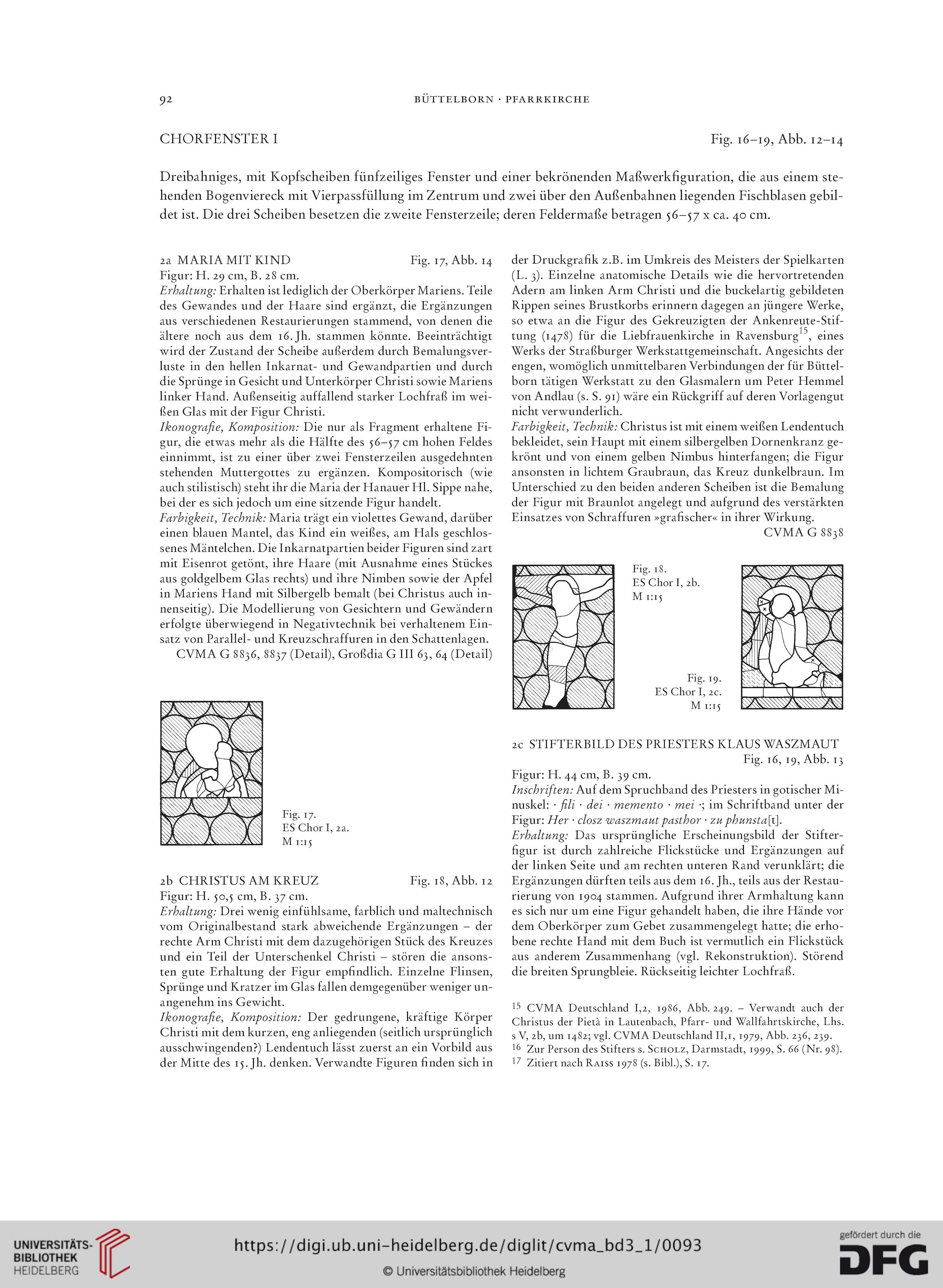BÜTTELBORN • PFARRKIRCHE
92
CHORFENSTER I
Fig. 16-19, Abb. 12-14
Dreibahniges, mit Kopfscheiben fünfzeiliges Fenster und einer bekrönenden Maßwerkfiguration, die aus einem ste-
henden Bogenviereck mit Vierpassfüllung im Zentrum und zwei über den Außenbahnen liegenden Fischblasen gebil-
det ist. Die drei Scheiben besetzen die zweite Fensterzeile; deren Feldermaße betragen 56-57 x ca. 40 cm.
2a MARIA MIT KIND Fig. 17, Abb. 14
Figur: H. 29 cm, B. 28 cm.
Erhaltung: Erhalten ist lediglich der Oberkörper Mariens. Teile
des Gewandes und der Haare sind ergänzt, die Ergänzungen
aus verschiedenen Restaurierungen stammend, von denen die
ältere noch aus dem 16. Jh. stammen könnte. Beeinträchtigt
wird der Zustand der Scheibe außerdem durch Bemalungsver-
luste in den hellen Inkarnat- und Gewandpartien und durch
die Sprünge in Gesicht und Unterkörper Christi sowie Mariens
linker Hand. Außenseitig auffallend starker Lochfraß im wei-
ßen Glas mit der Figur Christi.
Ikonografie, Komposition: Die nur als Fragment erhaltene Fi-
gur, die etwas mehr als die Hälfte des 56-57 cm hohen Feldes
einnimmt, ist zu einer über zwei Fensterzeilen ausgedehnten
stehenden Muttergottes zu ergänzen. Kompositorisch (wie
auch stilistisch) steht ihr die Maria der Hanauer Hl. Sippe nahe,
bei der es sich jedoch um eine sitzende Figur handelt.
Farbigkeit, Technik: Maria trägt ein violettes Gewand, darüber
einen blauen Mantel, das Kind ein weißes, am Hals geschlos-
senes Mäntelchen. Die Inkarnatpartien beider Figuren sind zart
mit Eisenrot getönt, ihre Haare (mit Ausnahme eines Stückes
aus goldgelbem Glas rechts) und ihre Nimben sowie der Apfel
in Mariens Hand mit Silbergelb bemalt (bei Christus auch in-
nenseitig). Die Modellierung von Gesichtern und Gewändern
erfolgte überwiegend in Negativtechnik bei verhaltenem Ein-
satz von Parallel- und Kreuzschraffuren in den Schattenlagen.
CVMA G 8836, 8837 (Detail), Großdia G III 63, 64 (Detail)
Fig- U-
ES Chor I, 2a.
M 1:15
2b CHRISTUS AM KREUZ Fig. 18, Abb. 12
Figur: H. 50,5 cm, B. 37 cm.
Erhaltung: Drei wenig einfühlsame, farblich und maltechnisch
vom Originalbestand stark abweichende Ergänzungen - der
rechte Arm Christi mit dem dazugehörigen Stück des Kreuzes
und ein Teil der Unterschenkel Christi - stören die ansons-
ten gute Erhaltung der Figur empfindlich. Einzelne Flinsen,
Sprünge und Kratzer im Glas fallen demgegenüber weniger un-
angenehm ins Gewicht.
Ikonografie, Komposition: Der gedrungene, kräftige Körper
Christi mit dem kurzen, eng anliegenden (seitlich ursprünglich
ausschwingenden?) Lendentuch lässt zuerst an ein Vorbild aus
der Mitte des 15. Jh. denken. Verwandte Figuren finden sich in
der Druckgrafik z.B. im Umkreis des Meisters der Spielkarten
(L. 3). Einzelne anatomische Details wie die hervortretenden
Adern am linken Arm Christi und die buckelartig gebildeten
Rippen seines Brustkorbs erinnern dagegen an jüngere Werke,
so etwa an die Figur des Gekreuzigten der Ankenreute-Stif-
tung (1478) für die Liebfrauenkirche in Ravensburg15, eines
Werks der Straßburger Werkstattgemeinschaft. Angesichts der
engen, womöglich unmittelbaren Verbindungen der für Büttel-
born tätigen Werkstatt zu den Glasmalern um Peter Hemmel
von Andlau (s. S. 91) wäre ein Rückgriff auf deren Vorlagengut
nicht verwunderlich.
Farbigkeit, Technik: Christus ist mit einem weißen Lendentuch
bekleidet, sein Haupt mit einem silbergelben Dornenkranz ge-
krönt und von einem gelben Nimbus hinterfangen; die Figur
ansonsten in lichtem Graubraun, das Kreuz dunkelbraun. Im
Unterschied zu den beiden anderen Scheiben ist die Bemalung
der Figur mit Braunlot angelegt und aufgrund des verstärkten
Einsatzes von Schraffuren »grafischer« in ihrer Wirkung.
CVMA G 8838
Fig. 18.
ES Chor I, 2b.
M 1:15
Fig. 19-
ES Chor I, 2c.
M 1:15
2c STIFTERBILD DES PRIESTERS KLAUS WASZMAUT
Fig. 16, 19, Abb. 13
Figur: H. 44 cm, B. 39 cm.
Inschriften: Auf dem Spruchband des Priesters in gotischer Mi-
nuskel: • fili ■ dei • memento • mei •; im Schriftband unter der
Figur: Her ■ closz waszmautpasthor • zu phunstaft].
Erhaltung: Das ursprüngliche Erscheinungsbild der Stifter-
figur ist durch zahlreiche Flickstücke und Ergänzungen auf
der linken Seite und am rechten unteren Rand verunklärt; die
Ergänzungen dürften teils aus dem 16. Jh., teils aus der Restau-
rierung von 1904 stammen. Aufgrund ihrer Armhaltung kann
es sich nur um eine Figur gehandelt haben, die ihre Hände vor
dem Oberkörper zum Gebet zusammengelegt hatte; die erho-
bene rechte Hand mit dem Buch ist vermutlich ein Flickstück
aus anderem Zusammenhang (vgl. Rekonstruktion). Störend
die breiten Sprungbleie. Rückseitig leichter Lochfraß.
15 CVMA Deutschland 1,2, 1986, Abb. 249. - Verwandt auch der
Christus der Pieta in Lautenbach, Pfarr- und Wallfahrtskirche, Lhs.
s V, 2b, um 1482; vgl. CVMA Deutschland II,1, 1979, Abb. 236, 239.
16 Zur Person des Stifters s. Scholz, Darmstadt, 1999, S. 66 (Nr. 98).
17 Zitiert nach Raiss 1978 (s. Bibi.), S. 17.
92
CHORFENSTER I
Fig. 16-19, Abb. 12-14
Dreibahniges, mit Kopfscheiben fünfzeiliges Fenster und einer bekrönenden Maßwerkfiguration, die aus einem ste-
henden Bogenviereck mit Vierpassfüllung im Zentrum und zwei über den Außenbahnen liegenden Fischblasen gebil-
det ist. Die drei Scheiben besetzen die zweite Fensterzeile; deren Feldermaße betragen 56-57 x ca. 40 cm.
2a MARIA MIT KIND Fig. 17, Abb. 14
Figur: H. 29 cm, B. 28 cm.
Erhaltung: Erhalten ist lediglich der Oberkörper Mariens. Teile
des Gewandes und der Haare sind ergänzt, die Ergänzungen
aus verschiedenen Restaurierungen stammend, von denen die
ältere noch aus dem 16. Jh. stammen könnte. Beeinträchtigt
wird der Zustand der Scheibe außerdem durch Bemalungsver-
luste in den hellen Inkarnat- und Gewandpartien und durch
die Sprünge in Gesicht und Unterkörper Christi sowie Mariens
linker Hand. Außenseitig auffallend starker Lochfraß im wei-
ßen Glas mit der Figur Christi.
Ikonografie, Komposition: Die nur als Fragment erhaltene Fi-
gur, die etwas mehr als die Hälfte des 56-57 cm hohen Feldes
einnimmt, ist zu einer über zwei Fensterzeilen ausgedehnten
stehenden Muttergottes zu ergänzen. Kompositorisch (wie
auch stilistisch) steht ihr die Maria der Hanauer Hl. Sippe nahe,
bei der es sich jedoch um eine sitzende Figur handelt.
Farbigkeit, Technik: Maria trägt ein violettes Gewand, darüber
einen blauen Mantel, das Kind ein weißes, am Hals geschlos-
senes Mäntelchen. Die Inkarnatpartien beider Figuren sind zart
mit Eisenrot getönt, ihre Haare (mit Ausnahme eines Stückes
aus goldgelbem Glas rechts) und ihre Nimben sowie der Apfel
in Mariens Hand mit Silbergelb bemalt (bei Christus auch in-
nenseitig). Die Modellierung von Gesichtern und Gewändern
erfolgte überwiegend in Negativtechnik bei verhaltenem Ein-
satz von Parallel- und Kreuzschraffuren in den Schattenlagen.
CVMA G 8836, 8837 (Detail), Großdia G III 63, 64 (Detail)
Fig- U-
ES Chor I, 2a.
M 1:15
2b CHRISTUS AM KREUZ Fig. 18, Abb. 12
Figur: H. 50,5 cm, B. 37 cm.
Erhaltung: Drei wenig einfühlsame, farblich und maltechnisch
vom Originalbestand stark abweichende Ergänzungen - der
rechte Arm Christi mit dem dazugehörigen Stück des Kreuzes
und ein Teil der Unterschenkel Christi - stören die ansons-
ten gute Erhaltung der Figur empfindlich. Einzelne Flinsen,
Sprünge und Kratzer im Glas fallen demgegenüber weniger un-
angenehm ins Gewicht.
Ikonografie, Komposition: Der gedrungene, kräftige Körper
Christi mit dem kurzen, eng anliegenden (seitlich ursprünglich
ausschwingenden?) Lendentuch lässt zuerst an ein Vorbild aus
der Mitte des 15. Jh. denken. Verwandte Figuren finden sich in
der Druckgrafik z.B. im Umkreis des Meisters der Spielkarten
(L. 3). Einzelne anatomische Details wie die hervortretenden
Adern am linken Arm Christi und die buckelartig gebildeten
Rippen seines Brustkorbs erinnern dagegen an jüngere Werke,
so etwa an die Figur des Gekreuzigten der Ankenreute-Stif-
tung (1478) für die Liebfrauenkirche in Ravensburg15, eines
Werks der Straßburger Werkstattgemeinschaft. Angesichts der
engen, womöglich unmittelbaren Verbindungen der für Büttel-
born tätigen Werkstatt zu den Glasmalern um Peter Hemmel
von Andlau (s. S. 91) wäre ein Rückgriff auf deren Vorlagengut
nicht verwunderlich.
Farbigkeit, Technik: Christus ist mit einem weißen Lendentuch
bekleidet, sein Haupt mit einem silbergelben Dornenkranz ge-
krönt und von einem gelben Nimbus hinterfangen; die Figur
ansonsten in lichtem Graubraun, das Kreuz dunkelbraun. Im
Unterschied zu den beiden anderen Scheiben ist die Bemalung
der Figur mit Braunlot angelegt und aufgrund des verstärkten
Einsatzes von Schraffuren »grafischer« in ihrer Wirkung.
CVMA G 8838
Fig. 18.
ES Chor I, 2b.
M 1:15
Fig. 19-
ES Chor I, 2c.
M 1:15
2c STIFTERBILD DES PRIESTERS KLAUS WASZMAUT
Fig. 16, 19, Abb. 13
Figur: H. 44 cm, B. 39 cm.
Inschriften: Auf dem Spruchband des Priesters in gotischer Mi-
nuskel: • fili ■ dei • memento • mei •; im Schriftband unter der
Figur: Her ■ closz waszmautpasthor • zu phunstaft].
Erhaltung: Das ursprüngliche Erscheinungsbild der Stifter-
figur ist durch zahlreiche Flickstücke und Ergänzungen auf
der linken Seite und am rechten unteren Rand verunklärt; die
Ergänzungen dürften teils aus dem 16. Jh., teils aus der Restau-
rierung von 1904 stammen. Aufgrund ihrer Armhaltung kann
es sich nur um eine Figur gehandelt haben, die ihre Hände vor
dem Oberkörper zum Gebet zusammengelegt hatte; die erho-
bene rechte Hand mit dem Buch ist vermutlich ein Flickstück
aus anderem Zusammenhang (vgl. Rekonstruktion). Störend
die breiten Sprungbleie. Rückseitig leichter Lochfraß.
15 CVMA Deutschland 1,2, 1986, Abb. 249. - Verwandt auch der
Christus der Pieta in Lautenbach, Pfarr- und Wallfahrtskirche, Lhs.
s V, 2b, um 1482; vgl. CVMA Deutschland II,1, 1979, Abb. 236, 239.
16 Zur Person des Stifters s. Scholz, Darmstadt, 1999, S. 66 (Nr. 98).
17 Zitiert nach Raiss 1978 (s. Bibi.), S. 17.