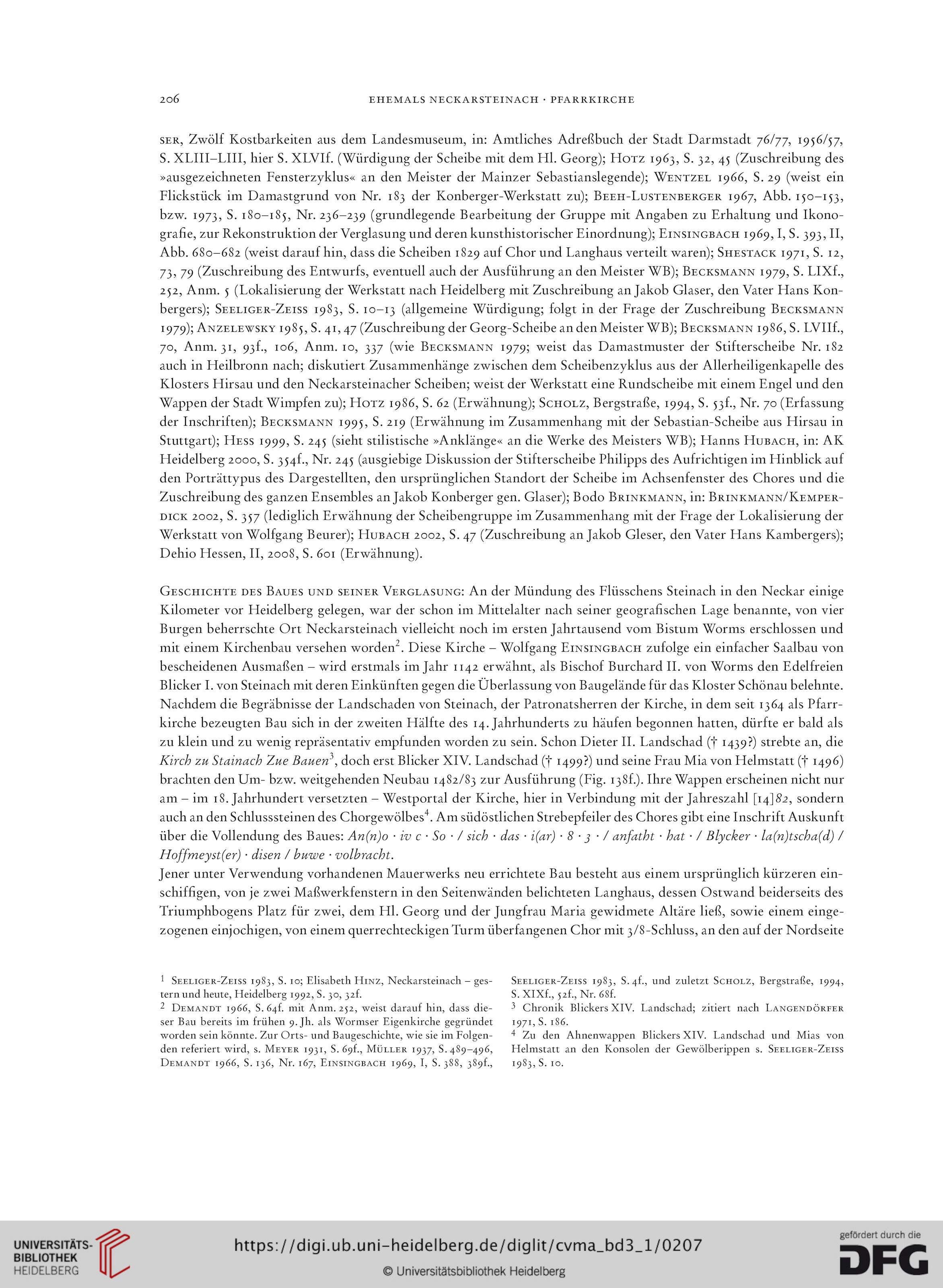206
EHEMALS NECKARSTEINACH • PFARRKIRCHE
ser, Zwölf Kostbarkeiten aus dem Landesmuseum, in: Amtliches Adreßbuch der Stadt Darmstadt 76/77, 1956/57,
S. XLIII-LIII, hier S. XLVIf. (Würdigung der Scheibe mit dem Hl. Georg); Hotz 1963, S. 32, 45 (Zuschreibung des
»ausgezeichneten Fensterzyklus« an den Meister der Mainzer Sebastianslegende); Wentzel 1966, S. 29 (weist ein
Flickstück im Damastgrund von Nr. 183 der Konberger-Werkstatt zu); Beeh-Lustenberger 1967, Abb. 150-153,
bzw. 1973, S. 180-185, Nr. 236-239 (grundlegende Bearbeitung der Gruppe mit Angaben zu Erhaltung und Ikono-
grafie, zur Rekonstruktion der Verglasung und deren kunsthistorischer Einordnung); Einsingbach 1969,1, S. 393, II,
Abb. 680-682 (weist darauf hin, dass die Scheiben 1829 auf Chor und Langhaus verteilt waren); Shestack 1971, S. 12,
73, 79 (Zuschreibung des Entwurfs, eventuell auch der Ausführung an den Meister WB); Becksmann 1979, S. LIXf.,
252, Anm. 5 (Lokalisierung der Werkstatt nach Heidelberg mit Zuschreibung an Jakob Glaser, den Vater Hans Kon-
bergers); Seeliger-Zeiss 1983, S. 10-13 (allgemeine Würdigung; folgt in der Frage der Zuschreibung Becksmann
1979); Anzelewsky 1985, S. 41, 47 (Zuschreibung der Georg-Scheibe an den Meister WB); Becksmann 1986, S. LVIIf.,
70, Anm. 31, 93L, 106, Anm. 10, 337 (wie Becksmann 1979; weist das Damastmuster der Stifterscheibe Nr. 182
auch in Heilbronn nach; diskutiert Zusammenhänge zwischen dem Scheibenzyklus aus der Allerheiligenkapelle des
Klosters Hirsau und den Neckarsteinacher Scheiben; weist der Werkstatt eine Rundscheibe mit einem Engel und den
Wappen der Stadt Wimpfen zu); Hotz 1986, S. 62 (Erwähnung); Scholz, Bergstraße, 1994, S. 53L, Nr. 70 (Erfassung
der Inschriften); Becksmann 1995, S. 219 (Erwähnung im Zusammenhang mit der Sebastian-Scheibe aus Hirsau in
Stuttgart); Hess 1999, S. 245 (sieht stilistische »Anklänge« an die Werke des Meisters WB); Hanns Hubach, in: AK
Heidelberg 2000, S. 354E, Nr. 245 (ausgiebige Diskussion der Stifterscheibe Philipps des Aufrichtigen im Hinblick auf
den Porträttypus des Dargestellten, den ursprünglichen Standort der Scheibe im Achsenfenster des Chores und die
Zuschreibung des ganzen Ensembles an Jakob Konberger gen. Glaser); Bodo Brinkmann, in: Brinkmann/Kemper-
dick 2002, S. 357 (lediglich Erwähnung der Scheibengruppe im Zusammenhang mit der Frage der Lokalisierung der
Werkstatt von Wolfgang Beurer); Hubach 2002, S. 47 (Zuschreibung an Jakob Gleser, den Vater Hans Kambergers);
Dehio Hessen, II, 2008, S. 601 (Erwähnung).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: An der Mündung des Flüsschens Steinach in den Neckar einige
Kilometer vor Heidelberg gelegen, war der schon im Mittelalter nach seiner geografischen Lage benannte, von vier
Burgen beherrschte Ort Neckarsteinach vielleicht noch im ersten Jahrtausend vom Bistum Worms erschlossen und
mit einem Kirchenbau versehen worden1 2 *. Diese Kirche - Wolfgang Einsingbach zufolge ein einfacher Saalbau von
bescheidenen Ausmaßen - wird erstmals im Jahr 1142 erwähnt, als Bischof Burchard II. von Worms den Edelfreien
Blicker I. von Steinach mit deren Einkünften gegen die Überlassung von Baugelände für das Kloster Schönau belehnte.
Nachdem die Begräbnisse der Landschaden von Steinach, der Patronatsherren der Kirche, in dem seit 1364 als Pfarr-
kirche bezeugten Bau sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu häufen begonnen hatten, dürfte er bald als
zu klein und zu wenig repräsentativ empfunden worden zu sein. Schon Dieter II. Landschad (fi 1439?) strebte an, die
Kirch zu Stainach Zue Bauen5, doch erst Blicker XIV. Landschad (j* 1499?) und seine Frau Mia von Heimstatt (fi 1496)
brachten den Um- bzw. weitgehenden Neubau 1482/83 zur Ausführung (Fig. 138f.). Ihre Wappen erscheinen nicht nur
am - im 18. Jahrhundert versetzten - Westportal der Kirche, hier in Verbindung mit der Jahreszahl [14]^, sondern
auch an den Schlusssteinen des Chorgewölbes4. Am südöstlichen Strebepfeiler des Chores gibt eine Inschrift Auskunft
über die Vollendung des Baues: An(n)o • iv c • So • / sich • das • i(ar) • 8 • j • / anfatht • hat • / Blycker • la(n)tscha(d) /
Hoffmeyst(er) • disen / buwe • volbracht.
Jener unter Verwendung vorhandenen Mauerwerks neu errichtete Bau besteht aus einem ursprünglich kürzeren ein-
schiffigen, von je zwei Maßwerkfenstern in den Seitenwänden belichteten Langhaus, dessen Ostwand beiderseits des
Triumphbogens Platz für zwei, dem Hl. Georg und der Jungfrau Maria gewidmete Altäre ließ, sowie einem einge-
zogenen einjochigen, von einem querrechteckigen Turm überfangenen Chor mit 3/8-Schluss, an den auf der Nordseite
1 Seeliger-Zeiss 19S3, S. 10; Elisabeth Hinz, Neckarsteinach - ges-
tern und heute, Heidelberg 1992, S. 30, 32!.
2 Demandt 1966, S. 64k mit Anm. 252, weist darauf hin, dass die-
ser Bau bereits im frühen 9.JI1. als Wormser Eigenkirche gegründet
worden sein könnte. Zur Orts- und Baugeschichte, wie sie im Folgen-
den referiert wird, s. Meyer 1931, S. 69E, Müller 1937, S. 489-496,
Demandt 1966, S. 136, Nr. 167, Einsingbach 1969, I, S. 388, 389L,
Seeliger-Zeiss 1983, S.4L und zuletzt Scholz, Bergstraße, 1994,
S. XIXf., 52k, Nr. 68f.
3 Chronik Blickers XIV. Landschad; zitiert nach Langendörfer
1971, S. 186.
4 Zu den Ahnenwappen Blickers XIV. Landschad und Mias von
Heimstatt an den Konsolen der Gewölberippen s. Seeliger-Zeiss
1983, S. 10.
EHEMALS NECKARSTEINACH • PFARRKIRCHE
ser, Zwölf Kostbarkeiten aus dem Landesmuseum, in: Amtliches Adreßbuch der Stadt Darmstadt 76/77, 1956/57,
S. XLIII-LIII, hier S. XLVIf. (Würdigung der Scheibe mit dem Hl. Georg); Hotz 1963, S. 32, 45 (Zuschreibung des
»ausgezeichneten Fensterzyklus« an den Meister der Mainzer Sebastianslegende); Wentzel 1966, S. 29 (weist ein
Flickstück im Damastgrund von Nr. 183 der Konberger-Werkstatt zu); Beeh-Lustenberger 1967, Abb. 150-153,
bzw. 1973, S. 180-185, Nr. 236-239 (grundlegende Bearbeitung der Gruppe mit Angaben zu Erhaltung und Ikono-
grafie, zur Rekonstruktion der Verglasung und deren kunsthistorischer Einordnung); Einsingbach 1969,1, S. 393, II,
Abb. 680-682 (weist darauf hin, dass die Scheiben 1829 auf Chor und Langhaus verteilt waren); Shestack 1971, S. 12,
73, 79 (Zuschreibung des Entwurfs, eventuell auch der Ausführung an den Meister WB); Becksmann 1979, S. LIXf.,
252, Anm. 5 (Lokalisierung der Werkstatt nach Heidelberg mit Zuschreibung an Jakob Glaser, den Vater Hans Kon-
bergers); Seeliger-Zeiss 1983, S. 10-13 (allgemeine Würdigung; folgt in der Frage der Zuschreibung Becksmann
1979); Anzelewsky 1985, S. 41, 47 (Zuschreibung der Georg-Scheibe an den Meister WB); Becksmann 1986, S. LVIIf.,
70, Anm. 31, 93L, 106, Anm. 10, 337 (wie Becksmann 1979; weist das Damastmuster der Stifterscheibe Nr. 182
auch in Heilbronn nach; diskutiert Zusammenhänge zwischen dem Scheibenzyklus aus der Allerheiligenkapelle des
Klosters Hirsau und den Neckarsteinacher Scheiben; weist der Werkstatt eine Rundscheibe mit einem Engel und den
Wappen der Stadt Wimpfen zu); Hotz 1986, S. 62 (Erwähnung); Scholz, Bergstraße, 1994, S. 53L, Nr. 70 (Erfassung
der Inschriften); Becksmann 1995, S. 219 (Erwähnung im Zusammenhang mit der Sebastian-Scheibe aus Hirsau in
Stuttgart); Hess 1999, S. 245 (sieht stilistische »Anklänge« an die Werke des Meisters WB); Hanns Hubach, in: AK
Heidelberg 2000, S. 354E, Nr. 245 (ausgiebige Diskussion der Stifterscheibe Philipps des Aufrichtigen im Hinblick auf
den Porträttypus des Dargestellten, den ursprünglichen Standort der Scheibe im Achsenfenster des Chores und die
Zuschreibung des ganzen Ensembles an Jakob Konberger gen. Glaser); Bodo Brinkmann, in: Brinkmann/Kemper-
dick 2002, S. 357 (lediglich Erwähnung der Scheibengruppe im Zusammenhang mit der Frage der Lokalisierung der
Werkstatt von Wolfgang Beurer); Hubach 2002, S. 47 (Zuschreibung an Jakob Gleser, den Vater Hans Kambergers);
Dehio Hessen, II, 2008, S. 601 (Erwähnung).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: An der Mündung des Flüsschens Steinach in den Neckar einige
Kilometer vor Heidelberg gelegen, war der schon im Mittelalter nach seiner geografischen Lage benannte, von vier
Burgen beherrschte Ort Neckarsteinach vielleicht noch im ersten Jahrtausend vom Bistum Worms erschlossen und
mit einem Kirchenbau versehen worden1 2 *. Diese Kirche - Wolfgang Einsingbach zufolge ein einfacher Saalbau von
bescheidenen Ausmaßen - wird erstmals im Jahr 1142 erwähnt, als Bischof Burchard II. von Worms den Edelfreien
Blicker I. von Steinach mit deren Einkünften gegen die Überlassung von Baugelände für das Kloster Schönau belehnte.
Nachdem die Begräbnisse der Landschaden von Steinach, der Patronatsherren der Kirche, in dem seit 1364 als Pfarr-
kirche bezeugten Bau sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu häufen begonnen hatten, dürfte er bald als
zu klein und zu wenig repräsentativ empfunden worden zu sein. Schon Dieter II. Landschad (fi 1439?) strebte an, die
Kirch zu Stainach Zue Bauen5, doch erst Blicker XIV. Landschad (j* 1499?) und seine Frau Mia von Heimstatt (fi 1496)
brachten den Um- bzw. weitgehenden Neubau 1482/83 zur Ausführung (Fig. 138f.). Ihre Wappen erscheinen nicht nur
am - im 18. Jahrhundert versetzten - Westportal der Kirche, hier in Verbindung mit der Jahreszahl [14]^, sondern
auch an den Schlusssteinen des Chorgewölbes4. Am südöstlichen Strebepfeiler des Chores gibt eine Inschrift Auskunft
über die Vollendung des Baues: An(n)o • iv c • So • / sich • das • i(ar) • 8 • j • / anfatht • hat • / Blycker • la(n)tscha(d) /
Hoffmeyst(er) • disen / buwe • volbracht.
Jener unter Verwendung vorhandenen Mauerwerks neu errichtete Bau besteht aus einem ursprünglich kürzeren ein-
schiffigen, von je zwei Maßwerkfenstern in den Seitenwänden belichteten Langhaus, dessen Ostwand beiderseits des
Triumphbogens Platz für zwei, dem Hl. Georg und der Jungfrau Maria gewidmete Altäre ließ, sowie einem einge-
zogenen einjochigen, von einem querrechteckigen Turm überfangenen Chor mit 3/8-Schluss, an den auf der Nordseite
1 Seeliger-Zeiss 19S3, S. 10; Elisabeth Hinz, Neckarsteinach - ges-
tern und heute, Heidelberg 1992, S. 30, 32!.
2 Demandt 1966, S. 64k mit Anm. 252, weist darauf hin, dass die-
ser Bau bereits im frühen 9.JI1. als Wormser Eigenkirche gegründet
worden sein könnte. Zur Orts- und Baugeschichte, wie sie im Folgen-
den referiert wird, s. Meyer 1931, S. 69E, Müller 1937, S. 489-496,
Demandt 1966, S. 136, Nr. 167, Einsingbach 1969, I, S. 388, 389L,
Seeliger-Zeiss 1983, S.4L und zuletzt Scholz, Bergstraße, 1994,
S. XIXf., 52k, Nr. 68f.
3 Chronik Blickers XIV. Landschad; zitiert nach Langendörfer
1971, S. 186.
4 Zu den Ahnenwappen Blickers XIV. Landschad und Mias von
Heimstatt an den Konsolen der Gewölberippen s. Seeliger-Zeiss
1983, S. 10.