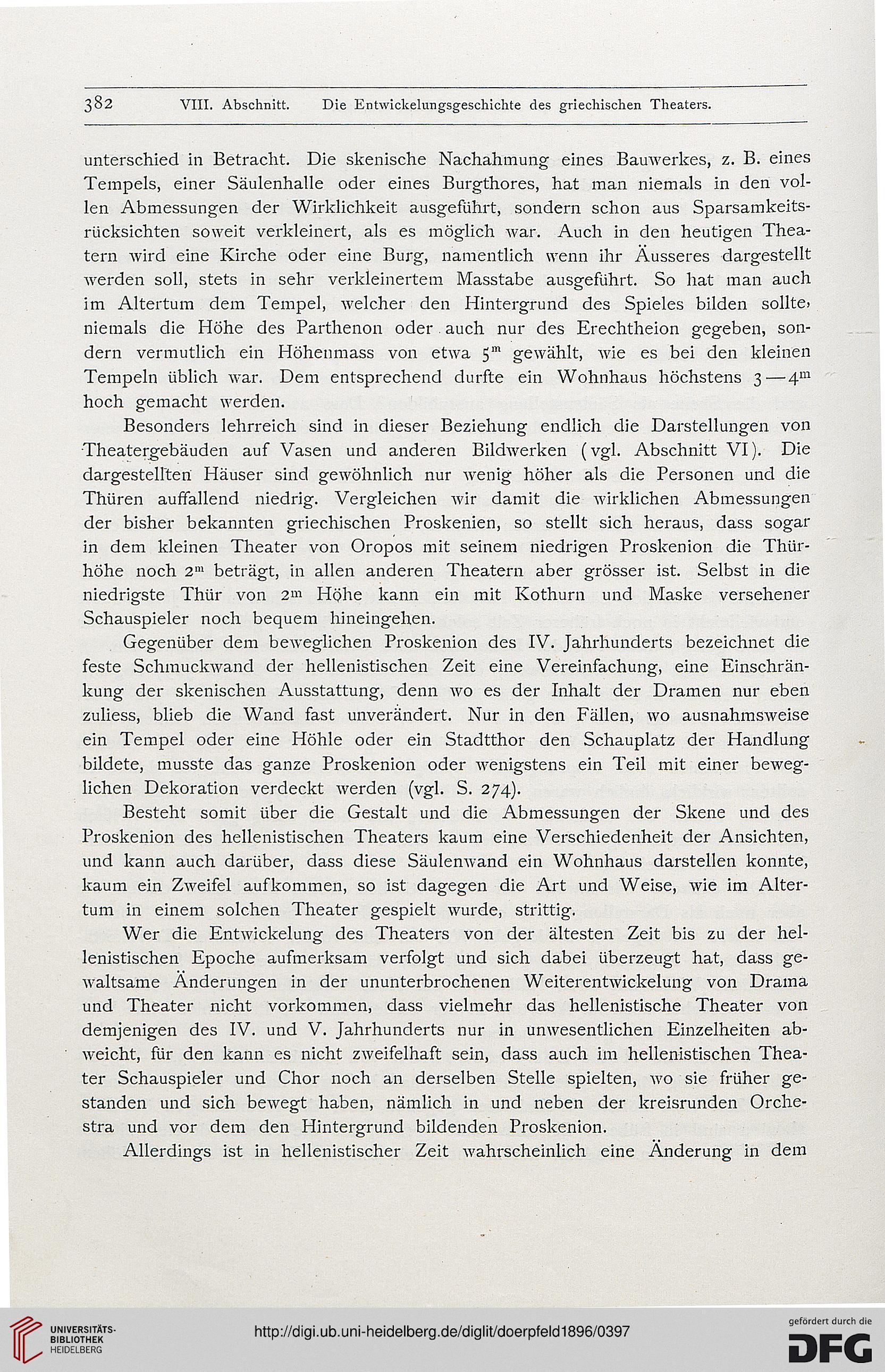382
VIII. Abschnitt. Die EntwickplungsgeSchichte des griechischen Theaters.
unterschied in Betracht. Die skenische Nachahmung eines Bauwerkes, z. B. eines
Tempels, einer Säulenhalle oder eines Burgthores, hat man niemals in den vol-
len Abmessungen der Wirklichkeit ausgeführt, sondern schon aus Sparsamkeits-
rücksichten soweit verkleinert, als es möglich war. Auch in den heutigen Thea-
tern wird eine Kirche oder eine Burg, namentlich wenn ihr Äusseres dargestellt
werden soll, stets in sehr verkleinertem Masstabe ausgeführt. So hat man auch
im Altertum dem Tempel, welcher den Hintergrund des Spieles bilden sollte)
niemals die Höhe des Parthenon oder auch nur des Erechtheion gegeben, son-
dern vermutlich ein Höhenmass von etwa 5m gewählt, wie es bei den kleinen
Tempeln üblich war. Dem entsprechend durfte ein Wohnhaus höchstens 3—4m
hoch gemacht werden.
Besonders lehrreich sind in dieser Beziehung endlich die Darstellungen von
Theatergebäuden auf Vasen und anderen Bildwerken (vgl. Abschnitt VI). Die
dargestellten Häuser sind gewöhnlich nur wenig höher als die Personen und die
Thüren auffallend niedrig. Vergleichen wir damit die wirklichen Abmessungen
der bisher bekannten griechischen Proskenien, so stellt sich heraus, dass sogar
in dem kleinen Theater von Oropos mit seinem niedrigen Proskenion die Thür-
höhe noch 2m beträgt, in allen anderen Theatern aber grösser ist. Selbst in die
niedrigste Thür von 2m Hphe kann ein mit Kothurn und Maske versehener
Schauspieler noch bequem hineingehen.
Gegenüber dem beweglichen Proskenion des IV. Jahrhunderts bezeichnet die
feste Schmuckwand der hellenistischen Zeit eine Vereinfachung, eine Einschrän-
kung der skenischen Ausstattung, denn wo es der Inhalt der Dramen nur eben
zuliess, blieb die Wand fast unverändert. Nur in den Fällen, wo ausnahmsweise
ein Tempel oder eine Höhle oder ein Stadtthor den Schauplatz der Handlung
bildete, musste das ganze Proskenion oder wenigstens ein Teil mit einer beweg-
lichen Dekoration verdeckt werden (vgl. S. 274).
Besteht somit über die Gestalt und die Abmessungen der Skene und des
Proskenion des hellenistischen Theaters kaum eine Verschiedenheit der Ansichten,
und kann auch darüber, dass diese Säulenwand ein Wohnhaus darstellen konnte,
kaum ein Zweifel aufkommen, so ist dagegen die Art und Weise, wie im Alter-
tum in einem solchen Theater gespielt wurde, strittig.
Wer die Entwickelung des Theaters von der ältesten Zeit bis zu der hel-
lenistischen Epoche aufmerksam verfolgt und sich dabei überzeugt hat, dass ge-
waltsame Änderungen in der ununterbrochenen Weiterentwickelung von Drama
und Theater nicht vorkommen, dass vielmehr das hellenistische Theater von
demjenigen des IV. und V. Jahrhunderts nur in unwesentlichen Einzelheiten ab-
weicht, für den kann es nicht zweifelhaft sein, dass auch im hellenistischen Thea-
ter Schauspieler und Chor noch an derselben Stelle spielten, wo sie früher ge-
standen und sich bewegt haben, nämlich in und neben der kreisrunden Orche-
stra und vor dem den Hintergrund bildenden Proskenton.
Allerdings ist in hellenistischer Zeit wahrscheinlich eine Änderung in dem
VIII. Abschnitt. Die EntwickplungsgeSchichte des griechischen Theaters.
unterschied in Betracht. Die skenische Nachahmung eines Bauwerkes, z. B. eines
Tempels, einer Säulenhalle oder eines Burgthores, hat man niemals in den vol-
len Abmessungen der Wirklichkeit ausgeführt, sondern schon aus Sparsamkeits-
rücksichten soweit verkleinert, als es möglich war. Auch in den heutigen Thea-
tern wird eine Kirche oder eine Burg, namentlich wenn ihr Äusseres dargestellt
werden soll, stets in sehr verkleinertem Masstabe ausgeführt. So hat man auch
im Altertum dem Tempel, welcher den Hintergrund des Spieles bilden sollte)
niemals die Höhe des Parthenon oder auch nur des Erechtheion gegeben, son-
dern vermutlich ein Höhenmass von etwa 5m gewählt, wie es bei den kleinen
Tempeln üblich war. Dem entsprechend durfte ein Wohnhaus höchstens 3—4m
hoch gemacht werden.
Besonders lehrreich sind in dieser Beziehung endlich die Darstellungen von
Theatergebäuden auf Vasen und anderen Bildwerken (vgl. Abschnitt VI). Die
dargestellten Häuser sind gewöhnlich nur wenig höher als die Personen und die
Thüren auffallend niedrig. Vergleichen wir damit die wirklichen Abmessungen
der bisher bekannten griechischen Proskenien, so stellt sich heraus, dass sogar
in dem kleinen Theater von Oropos mit seinem niedrigen Proskenion die Thür-
höhe noch 2m beträgt, in allen anderen Theatern aber grösser ist. Selbst in die
niedrigste Thür von 2m Hphe kann ein mit Kothurn und Maske versehener
Schauspieler noch bequem hineingehen.
Gegenüber dem beweglichen Proskenion des IV. Jahrhunderts bezeichnet die
feste Schmuckwand der hellenistischen Zeit eine Vereinfachung, eine Einschrän-
kung der skenischen Ausstattung, denn wo es der Inhalt der Dramen nur eben
zuliess, blieb die Wand fast unverändert. Nur in den Fällen, wo ausnahmsweise
ein Tempel oder eine Höhle oder ein Stadtthor den Schauplatz der Handlung
bildete, musste das ganze Proskenion oder wenigstens ein Teil mit einer beweg-
lichen Dekoration verdeckt werden (vgl. S. 274).
Besteht somit über die Gestalt und die Abmessungen der Skene und des
Proskenion des hellenistischen Theaters kaum eine Verschiedenheit der Ansichten,
und kann auch darüber, dass diese Säulenwand ein Wohnhaus darstellen konnte,
kaum ein Zweifel aufkommen, so ist dagegen die Art und Weise, wie im Alter-
tum in einem solchen Theater gespielt wurde, strittig.
Wer die Entwickelung des Theaters von der ältesten Zeit bis zu der hel-
lenistischen Epoche aufmerksam verfolgt und sich dabei überzeugt hat, dass ge-
waltsame Änderungen in der ununterbrochenen Weiterentwickelung von Drama
und Theater nicht vorkommen, dass vielmehr das hellenistische Theater von
demjenigen des IV. und V. Jahrhunderts nur in unwesentlichen Einzelheiten ab-
weicht, für den kann es nicht zweifelhaft sein, dass auch im hellenistischen Thea-
ter Schauspieler und Chor noch an derselben Stelle spielten, wo sie früher ge-
standen und sich bewegt haben, nämlich in und neben der kreisrunden Orche-
stra und vor dem den Hintergrund bildenden Proskenton.
Allerdings ist in hellenistischer Zeit wahrscheinlich eine Änderung in dem