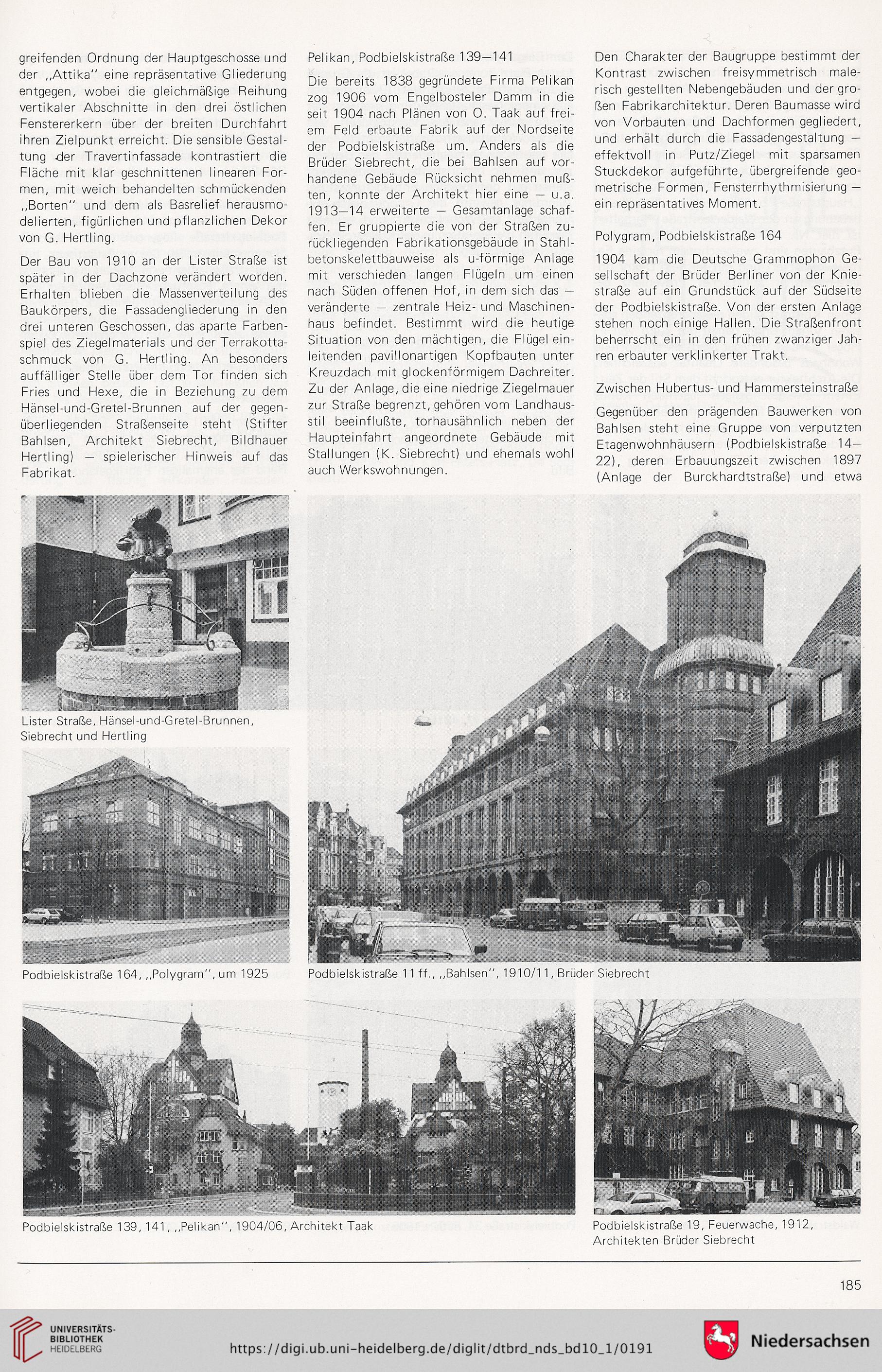greifenden Ordnung der Hauptgeschosse und
der „Attika" eine repräsentative Gliederung
entgegen, wobei die gleichmäßige Reihung
vertikaler Abschnitte in den drei östlichen
Fenstererkern über der breiten Durchfahrt
ihren Zielpunkt erreicht. Die sensible Gestal-
tung der Travertinfassade kontrastiert die
Fläche mit klar geschnittenen linearen For-
men, mit weich behandelten schmückenden
„Borten" und dem als Basrelief herausmo-
delierten, figürlichen und pflanzlichen Dekor
von G. Hertling.
Der Bau von 1910 an der Lister Straße ist
später in der Dachzone verändert worden.
Erhalten blieben die Massenverteilung des
Baukörpers, die Fassadengliederung in den
drei unteren Geschossen, das aparte Farben-
spiel des Ziegelmaterials und der Terrakotta-
schmuck von G. Hertling. An besonders
auffälliger Stelle über dem Tor finden sich
Fries und Hexe, die in Beziehung zu dem
Hänsel-und-Gretel-Brunnen auf der gegen-
überliegenden Straßenseite steht (Stifter
Bahlsen, Architekt Siebrecht, Bildhauer
Hertling) — spielerischer Hinweis auf das
Fabrikat.
Pelikan, Podbielskistraße 139—141
Die bereits 1838 gegründete Firma Pelikan
zog 1906 vom Engelbosteler Damm in die
seit 1904 nach Plänen von 0. Taak auf frei-
em Feld erbaute Fabrik auf der Nordseite
der Podbielskistraße um. Anders als die
Brüder Siebrecht, die bei Bahlsen auf vor-
handene Gebäude Rücksicht nehmen muß-
ten, konnte der Architekt hier eine — u.a.
1913—14 erweiterte — Gesamtanlage schaf-
fen. Er gruppierte die von der Straßen zu-
rückliegenden Fabrikationsgebäude in Stahl-
betonskelettbauweise als u-förmige Anlage
mit verschieden langen Flügeln um einen
nach Süden offenen Hof, in dem sich das —
veränderte — zentrale Heiz- und Maschinen-
haus befindet. Bestimmt wird die heutige
Situation von den mächtigen, die Flügel ein-
leitenden pavillonartigen Kopfbauten unter
Kreuzdach mit glockenförmigem Dachreiter.
Zu der Anlage, die eine niedrige Ziegelmauer
zur Straße begrenzt, gehören vom Landhaus-
stil beeinflußte, torhausähnlich neben der
Haupteinfahrt angeordnete Gebäude mit
Stallungen (K. Siebrecht) und ehemals wohl
auch Werkswohnungen.
Den Charakter der Baugruppe bestimmt der
Kontrast zwischen freisymmetrisch male-
risch gestellten Nebengebäuden und der gro-
ßen Fabrikarchitektur. Deren Baumasse wird
von Vorbauten und Dachformen gegliedert,
und erhält durch die Fassadengestaltung —
effektvoll in Putz/Ziegel mit sparsamen
Stuckdekor aufgeführte, übergreifende geo-
metrische Formen, Fensterrhythmisierung—
ein repräsentatives Moment.
Polygram, Podbielskistraße 164
1904 kam die Deutsche Grammophon Ge-
sellschaft der Brüder Berliner von der Knie-
straße auf ein Grundstück auf der Südseite
der Podbielskistraße. Von der ersten Anlage
stehen noch einige Hallen. Die Straßenfront
beherrscht ein in den frühen zwanziger Jah-
ren erbauter verklinkerter Trakt.
Zwischen Hubertus- und Hammersteinstraße
Gegenüber den prägenden Bauwerken von
Bahlsen steht eine Gruppe von verputzten
Etagenwohnhäusern (Podbielskistraße 14—
22), deren Erbauungszeit zwischen 1897
(Anlage der Burckhardtstraße) und etwa
Lister Straße, Hänsel-und-Gretel-Brunnen,
Siebrecht und Hertling
Podbielskistraße 164, „Polygram", um 1925
Podbielskistraße 11 ff., „Bahlsen", 1910/1 1. Brüder Siebrecht
Podbielskistraße 19, Feuerwache, 1912,
Architekten Brüder Siebrecht
Podbielskistraße 139, 141. „Pelikan", 1904/06, Architekt Taak
185
der „Attika" eine repräsentative Gliederung
entgegen, wobei die gleichmäßige Reihung
vertikaler Abschnitte in den drei östlichen
Fenstererkern über der breiten Durchfahrt
ihren Zielpunkt erreicht. Die sensible Gestal-
tung der Travertinfassade kontrastiert die
Fläche mit klar geschnittenen linearen For-
men, mit weich behandelten schmückenden
„Borten" und dem als Basrelief herausmo-
delierten, figürlichen und pflanzlichen Dekor
von G. Hertling.
Der Bau von 1910 an der Lister Straße ist
später in der Dachzone verändert worden.
Erhalten blieben die Massenverteilung des
Baukörpers, die Fassadengliederung in den
drei unteren Geschossen, das aparte Farben-
spiel des Ziegelmaterials und der Terrakotta-
schmuck von G. Hertling. An besonders
auffälliger Stelle über dem Tor finden sich
Fries und Hexe, die in Beziehung zu dem
Hänsel-und-Gretel-Brunnen auf der gegen-
überliegenden Straßenseite steht (Stifter
Bahlsen, Architekt Siebrecht, Bildhauer
Hertling) — spielerischer Hinweis auf das
Fabrikat.
Pelikan, Podbielskistraße 139—141
Die bereits 1838 gegründete Firma Pelikan
zog 1906 vom Engelbosteler Damm in die
seit 1904 nach Plänen von 0. Taak auf frei-
em Feld erbaute Fabrik auf der Nordseite
der Podbielskistraße um. Anders als die
Brüder Siebrecht, die bei Bahlsen auf vor-
handene Gebäude Rücksicht nehmen muß-
ten, konnte der Architekt hier eine — u.a.
1913—14 erweiterte — Gesamtanlage schaf-
fen. Er gruppierte die von der Straßen zu-
rückliegenden Fabrikationsgebäude in Stahl-
betonskelettbauweise als u-förmige Anlage
mit verschieden langen Flügeln um einen
nach Süden offenen Hof, in dem sich das —
veränderte — zentrale Heiz- und Maschinen-
haus befindet. Bestimmt wird die heutige
Situation von den mächtigen, die Flügel ein-
leitenden pavillonartigen Kopfbauten unter
Kreuzdach mit glockenförmigem Dachreiter.
Zu der Anlage, die eine niedrige Ziegelmauer
zur Straße begrenzt, gehören vom Landhaus-
stil beeinflußte, torhausähnlich neben der
Haupteinfahrt angeordnete Gebäude mit
Stallungen (K. Siebrecht) und ehemals wohl
auch Werkswohnungen.
Den Charakter der Baugruppe bestimmt der
Kontrast zwischen freisymmetrisch male-
risch gestellten Nebengebäuden und der gro-
ßen Fabrikarchitektur. Deren Baumasse wird
von Vorbauten und Dachformen gegliedert,
und erhält durch die Fassadengestaltung —
effektvoll in Putz/Ziegel mit sparsamen
Stuckdekor aufgeführte, übergreifende geo-
metrische Formen, Fensterrhythmisierung—
ein repräsentatives Moment.
Polygram, Podbielskistraße 164
1904 kam die Deutsche Grammophon Ge-
sellschaft der Brüder Berliner von der Knie-
straße auf ein Grundstück auf der Südseite
der Podbielskistraße. Von der ersten Anlage
stehen noch einige Hallen. Die Straßenfront
beherrscht ein in den frühen zwanziger Jah-
ren erbauter verklinkerter Trakt.
Zwischen Hubertus- und Hammersteinstraße
Gegenüber den prägenden Bauwerken von
Bahlsen steht eine Gruppe von verputzten
Etagenwohnhäusern (Podbielskistraße 14—
22), deren Erbauungszeit zwischen 1897
(Anlage der Burckhardtstraße) und etwa
Lister Straße, Hänsel-und-Gretel-Brunnen,
Siebrecht und Hertling
Podbielskistraße 164, „Polygram", um 1925
Podbielskistraße 11 ff., „Bahlsen", 1910/1 1. Brüder Siebrecht
Podbielskistraße 19, Feuerwache, 1912,
Architekten Brüder Siebrecht
Podbielskistraße 139, 141. „Pelikan", 1904/06, Architekt Taak
185