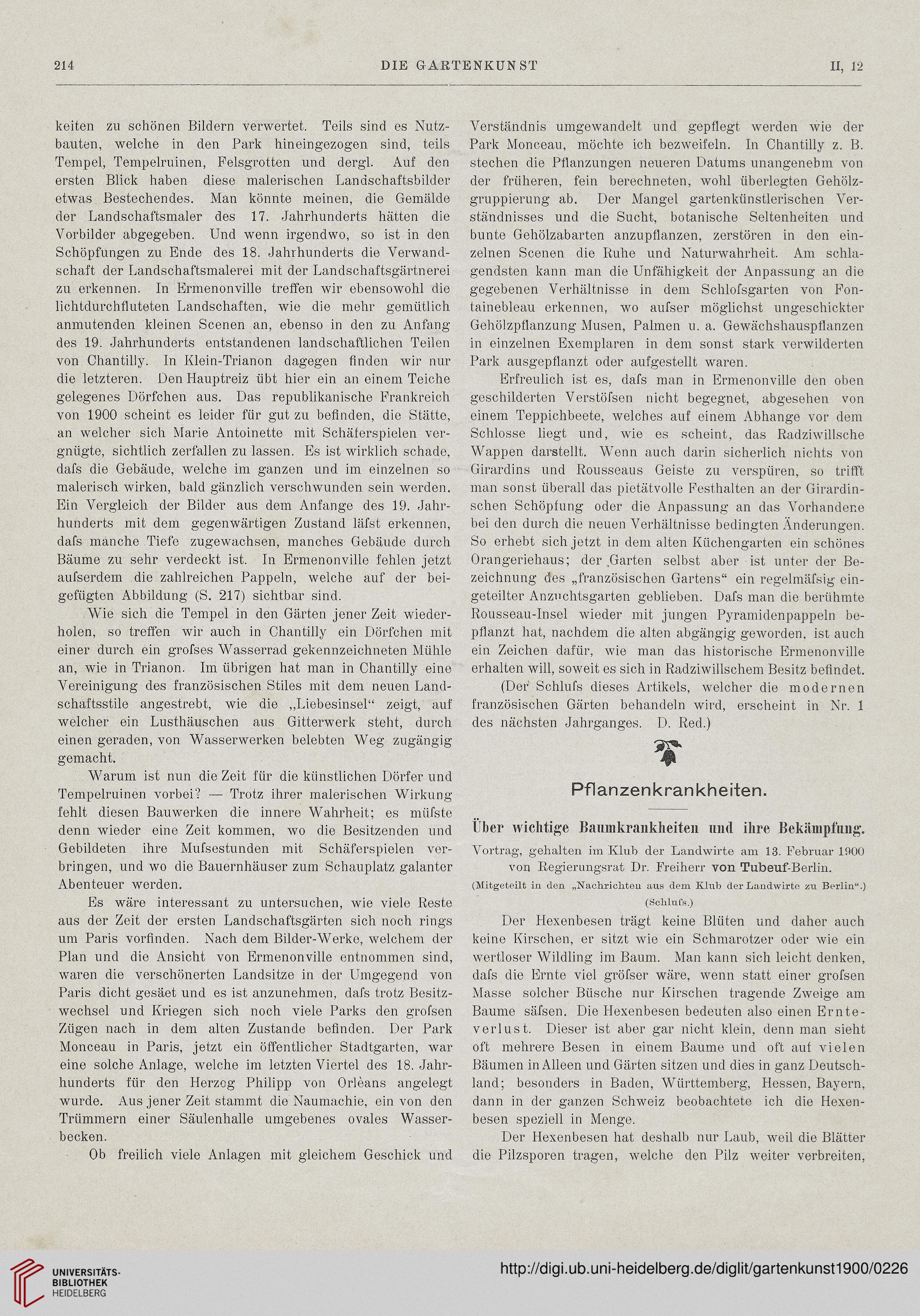214
DIE GARTENKUNST
II, 12
keiten zu schönen Bildern verwertet. Teils sind es Nutz-
baren, welche in den Park hineingezogen sind, teils
Tempel, Tempelruinen, Pelsgrotten und dergl. Auf den
ersten Blick haben diese malerischen Landschaftsbilder
etwas Bestechendes. Man könnte meinen, die Gemälde
der Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts hätten die
Vorbilder abgegeben. Und wenn irgendwo, so ist in den
Schöpfungen zu Ende des 18. Jahrhunderts die Verwand-
schaft der Landschaftsmalerei mit der Landschaftsgärtnerei
zu erkennen. In Ermenonville treffen wir ebensowohl die
lichtdurchfluteten Landschaften, wie die mehr gemütlich
anmutenden kleinen Scenen an, ebenso in den zu Anfang
des 19. Jahrhunderts entstandenen landschaftlichen Teilen
von Chantilly. In Klein-Trianon dagegen finden wir nur
die letzteren. Den Hauptreiz übt hier ein an einem Teiche
gelegenes Dörfchen aus. Das republikanische Prankreich
von 1900 scheint es leider für gut zu befinden, die Stätte,
an welcher sich Marie Antoinette mit Schäferspielen ver-
gnügte, sichtlich zerfallen zu lassen. Es ist wirklich schade,
dafs die Gebäude, welche im ganzen und im einzelnen so
malerisch wirken, bald gänzlich verschwunden sein werden.
Ein Vergleich der Bilder aus dem Anfange des 19. Jahr-
hunderts mit dem gegenwärtigen Zustand läfst erkennen,
dafs manche Tiefe zugewachsen, manches Gebäude durch
Bäume zu sehr verdeckt ist. In Ermenonville fehlen jetzt
aufserdem die zahlreichen Pappeln, welche auf der bei-
gefügten Abbildung (S. 217) sichtbar sind.
Wie sich die Tempel in den Gärten jener Zeit wieder-
holen, so treffen wir auch in Chantilly ein Dörfchen mit
einer durch ein grofses Wasserrad gekennzeichneten Mühle
an, wie in Trianon. Im übrigen hat man in Chantilly eine
Vereinigung des französischen Stiles mit dem neuen Land-
schaftsstile angestrebt, wie die „Liebesinsel" zeigt, auf
welcher ein Lusthäuschen aus Gitterwerk steht, durch
einen geraden, von Wasserwerken belebten Weg zugängig
gemacht.
Warum ist nun die Zeit für die künstlichen Dörfer und
Tompelruinen vorbei? — Trotz ihrer malerischen Wirkung
fehlt diesen Bauwerken die innere Wahrheit; es müfste
denn wieder eine Zeit kommen, wo die Besitzenden und
Gebildeten ihre Mufsostunden mit Schäferspielen ver-
bringen, und wo die Bauernhäuser zum Schauplatz galanter
Abenteuer werden.
Es wäre interessant zu untersuchen, wie viele Reste
aus der Zeit der ersten Landschaftsgärten sich noch rings
um Paris vorfinden. Nach dem Bilder-Werke, welchem der
Plan und die Ansicht von Ermenonville entnommen sind,
waren die verschönerten Landsitze in der Umgegend von
Paris dicht gesäet und es ist anzunehmen, dafs trotz Besitz-
wechsel und Kriegen sich noch viele Parks den grofsen
Zügen nach in dem alten Zustande befinden. Der Park
Monceau in Paris, jetzt ein öffentlicher Stadtgarton, war
eine solche Anlage, welche im letzten Viertel des 18. Jahr-
hunderts für den Herzog Philipp von Orleans angelegt
wurde. Aus jener Zeit stammt die Naumachie, ein von den
Trümmern einer Säulenhalle umgebenes ovales Wasser-
becken.
Ob freilich viele Anlagen mit gleichem Geschick und
Verständnis umgewandelt und gepflegt werden wie der
Park Monceau, möchte ich bezweifeln. In Chantilly z. B.
stechen die Pflanzungen neueren Datums unangenehm von
der früheren, fein berechneten, wohl überlegten Gehölz-
gruppierung ab. Der Mangel gartenkünstlerischen Ver-
ständnisses und die Sucht, botanische Seltenheiten und
bunte Gehölzabarton anzupflanzen, zerstören in den ein-
zelnen Scenen die Ruhe und Naturwahrheit. Am schla-
gendsten kann man die Unfähigkeit der Anpassung an die
gegebenen Verhältnisse in dem Schlofsgarten von Pon-
tainebleau erkennen, wo aufser möglichst ungeschickter
Gehölzpflanzung Musen, Palmen u. a. Gewächshauspflanzen
in einzelnen Exemplaren in dem sonst stark verwilderten
Park ausgepflanzt oder aufgestellt waren.
Erfreulich ist es, dafs man in Ermenonville den oben
geschilderten Verstöfsen nicht begegnet, abgesehen von
einem Teppichbeete, welches auf einem Abhänge vor dem
Schlosse liegt und, wie es scheint, das Radziwillsche
Wappen darstellt. Wenn auch darin sicherlich nichts von
Girardins und Rousseaus Geiste zu vorspüren, so trifft
man sonst überall das pietätvolle Pesthalten an der Girardin-
schen Schöpfung oder die Anpassung an das Vorhandene
bei den durch die neuen Verhältnisse bedingten Änderungen.
So erhebt sich jetzt in dem alten Küchengarten ein schönes
Orangeriehaus; der Garten selbst aber ist unter der Be-
zeichnung des „französischen Gartens" ein regelmäfsig ein-
geteilter Anzuchtsgarten geblieben. Dafs man die berühmte
Rousseau-Insel wieder mit jungen Pyramidenpappeln be-
pflanzt hat, nachdem die alten abgängig geworden, ist auch
ein Zeichen dafür, wie man das historische Ermenonville
erhalten will, soweit es sich in Radziwillschem Besitz befindet.
(Der Schlufs dieses Artikels, welcher die modernen
französischen Gärten behandeln wird, erscheint in Nr. 1
des nächsten Jahrganges. D. Red.)
Pflanzenkrankheiten.
Iber wichtige Baiimkrankheiten und ihre Bekämpfung.
Vortrag, gehalten im Klub der Landwirte am 13. Februar 1900
von Regierungsrat Dr. Freiherr von Tubeuf-Berlin.
(Mitgeteilt in den „Nachrichten aus dem Kluh der Landwirte zu Berlin".)
(Schlufs.)
Der Hexenbesen trägt keine Blüten und daher auch
keine Kirschen, er sitzt wie ein Schmarotzer oder wie ein
wertloser Wildling im Baum. Man kann sich leicht denken,
dafs die Ernte viel gröfser wäre, wenn statt einer grofsen
Masse solcher Büsche nur Kirschen tragende Zweige am
Baume säfsen. Die Hexenbesen bedeuten also einen Ernte-
verlust. Dieser ist aber gar nicht klein, denn man sieht
oft mehrere Besen in einem Baume und oft auf vielen
Bäumen in Alleen und Gärten sitzen und dies in ganz Deutsch-
land; besonders in Baden, Württemberg, Hessen, Bayern,
dann in der ganzen Schweiz beobachtete ich die Hexen-
besen speziell in Menge.
Der Hexenbesen hat deshalb nur Laub, weil die Blätter
die Pilzsporen tragen, welche den Pilz weiter verbreiten,
DIE GARTENKUNST
II, 12
keiten zu schönen Bildern verwertet. Teils sind es Nutz-
baren, welche in den Park hineingezogen sind, teils
Tempel, Tempelruinen, Pelsgrotten und dergl. Auf den
ersten Blick haben diese malerischen Landschaftsbilder
etwas Bestechendes. Man könnte meinen, die Gemälde
der Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts hätten die
Vorbilder abgegeben. Und wenn irgendwo, so ist in den
Schöpfungen zu Ende des 18. Jahrhunderts die Verwand-
schaft der Landschaftsmalerei mit der Landschaftsgärtnerei
zu erkennen. In Ermenonville treffen wir ebensowohl die
lichtdurchfluteten Landschaften, wie die mehr gemütlich
anmutenden kleinen Scenen an, ebenso in den zu Anfang
des 19. Jahrhunderts entstandenen landschaftlichen Teilen
von Chantilly. In Klein-Trianon dagegen finden wir nur
die letzteren. Den Hauptreiz übt hier ein an einem Teiche
gelegenes Dörfchen aus. Das republikanische Prankreich
von 1900 scheint es leider für gut zu befinden, die Stätte,
an welcher sich Marie Antoinette mit Schäferspielen ver-
gnügte, sichtlich zerfallen zu lassen. Es ist wirklich schade,
dafs die Gebäude, welche im ganzen und im einzelnen so
malerisch wirken, bald gänzlich verschwunden sein werden.
Ein Vergleich der Bilder aus dem Anfange des 19. Jahr-
hunderts mit dem gegenwärtigen Zustand läfst erkennen,
dafs manche Tiefe zugewachsen, manches Gebäude durch
Bäume zu sehr verdeckt ist. In Ermenonville fehlen jetzt
aufserdem die zahlreichen Pappeln, welche auf der bei-
gefügten Abbildung (S. 217) sichtbar sind.
Wie sich die Tempel in den Gärten jener Zeit wieder-
holen, so treffen wir auch in Chantilly ein Dörfchen mit
einer durch ein grofses Wasserrad gekennzeichneten Mühle
an, wie in Trianon. Im übrigen hat man in Chantilly eine
Vereinigung des französischen Stiles mit dem neuen Land-
schaftsstile angestrebt, wie die „Liebesinsel" zeigt, auf
welcher ein Lusthäuschen aus Gitterwerk steht, durch
einen geraden, von Wasserwerken belebten Weg zugängig
gemacht.
Warum ist nun die Zeit für die künstlichen Dörfer und
Tompelruinen vorbei? — Trotz ihrer malerischen Wirkung
fehlt diesen Bauwerken die innere Wahrheit; es müfste
denn wieder eine Zeit kommen, wo die Besitzenden und
Gebildeten ihre Mufsostunden mit Schäferspielen ver-
bringen, und wo die Bauernhäuser zum Schauplatz galanter
Abenteuer werden.
Es wäre interessant zu untersuchen, wie viele Reste
aus der Zeit der ersten Landschaftsgärten sich noch rings
um Paris vorfinden. Nach dem Bilder-Werke, welchem der
Plan und die Ansicht von Ermenonville entnommen sind,
waren die verschönerten Landsitze in der Umgegend von
Paris dicht gesäet und es ist anzunehmen, dafs trotz Besitz-
wechsel und Kriegen sich noch viele Parks den grofsen
Zügen nach in dem alten Zustande befinden. Der Park
Monceau in Paris, jetzt ein öffentlicher Stadtgarton, war
eine solche Anlage, welche im letzten Viertel des 18. Jahr-
hunderts für den Herzog Philipp von Orleans angelegt
wurde. Aus jener Zeit stammt die Naumachie, ein von den
Trümmern einer Säulenhalle umgebenes ovales Wasser-
becken.
Ob freilich viele Anlagen mit gleichem Geschick und
Verständnis umgewandelt und gepflegt werden wie der
Park Monceau, möchte ich bezweifeln. In Chantilly z. B.
stechen die Pflanzungen neueren Datums unangenehm von
der früheren, fein berechneten, wohl überlegten Gehölz-
gruppierung ab. Der Mangel gartenkünstlerischen Ver-
ständnisses und die Sucht, botanische Seltenheiten und
bunte Gehölzabarton anzupflanzen, zerstören in den ein-
zelnen Scenen die Ruhe und Naturwahrheit. Am schla-
gendsten kann man die Unfähigkeit der Anpassung an die
gegebenen Verhältnisse in dem Schlofsgarten von Pon-
tainebleau erkennen, wo aufser möglichst ungeschickter
Gehölzpflanzung Musen, Palmen u. a. Gewächshauspflanzen
in einzelnen Exemplaren in dem sonst stark verwilderten
Park ausgepflanzt oder aufgestellt waren.
Erfreulich ist es, dafs man in Ermenonville den oben
geschilderten Verstöfsen nicht begegnet, abgesehen von
einem Teppichbeete, welches auf einem Abhänge vor dem
Schlosse liegt und, wie es scheint, das Radziwillsche
Wappen darstellt. Wenn auch darin sicherlich nichts von
Girardins und Rousseaus Geiste zu vorspüren, so trifft
man sonst überall das pietätvolle Pesthalten an der Girardin-
schen Schöpfung oder die Anpassung an das Vorhandene
bei den durch die neuen Verhältnisse bedingten Änderungen.
So erhebt sich jetzt in dem alten Küchengarten ein schönes
Orangeriehaus; der Garten selbst aber ist unter der Be-
zeichnung des „französischen Gartens" ein regelmäfsig ein-
geteilter Anzuchtsgarten geblieben. Dafs man die berühmte
Rousseau-Insel wieder mit jungen Pyramidenpappeln be-
pflanzt hat, nachdem die alten abgängig geworden, ist auch
ein Zeichen dafür, wie man das historische Ermenonville
erhalten will, soweit es sich in Radziwillschem Besitz befindet.
(Der Schlufs dieses Artikels, welcher die modernen
französischen Gärten behandeln wird, erscheint in Nr. 1
des nächsten Jahrganges. D. Red.)
Pflanzenkrankheiten.
Iber wichtige Baiimkrankheiten und ihre Bekämpfung.
Vortrag, gehalten im Klub der Landwirte am 13. Februar 1900
von Regierungsrat Dr. Freiherr von Tubeuf-Berlin.
(Mitgeteilt in den „Nachrichten aus dem Kluh der Landwirte zu Berlin".)
(Schlufs.)
Der Hexenbesen trägt keine Blüten und daher auch
keine Kirschen, er sitzt wie ein Schmarotzer oder wie ein
wertloser Wildling im Baum. Man kann sich leicht denken,
dafs die Ernte viel gröfser wäre, wenn statt einer grofsen
Masse solcher Büsche nur Kirschen tragende Zweige am
Baume säfsen. Die Hexenbesen bedeuten also einen Ernte-
verlust. Dieser ist aber gar nicht klein, denn man sieht
oft mehrere Besen in einem Baume und oft auf vielen
Bäumen in Alleen und Gärten sitzen und dies in ganz Deutsch-
land; besonders in Baden, Württemberg, Hessen, Bayern,
dann in der ganzen Schweiz beobachtete ich die Hexen-
besen speziell in Menge.
Der Hexenbesen hat deshalb nur Laub, weil die Blätter
die Pilzsporen tragen, welche den Pilz weiter verbreiten,