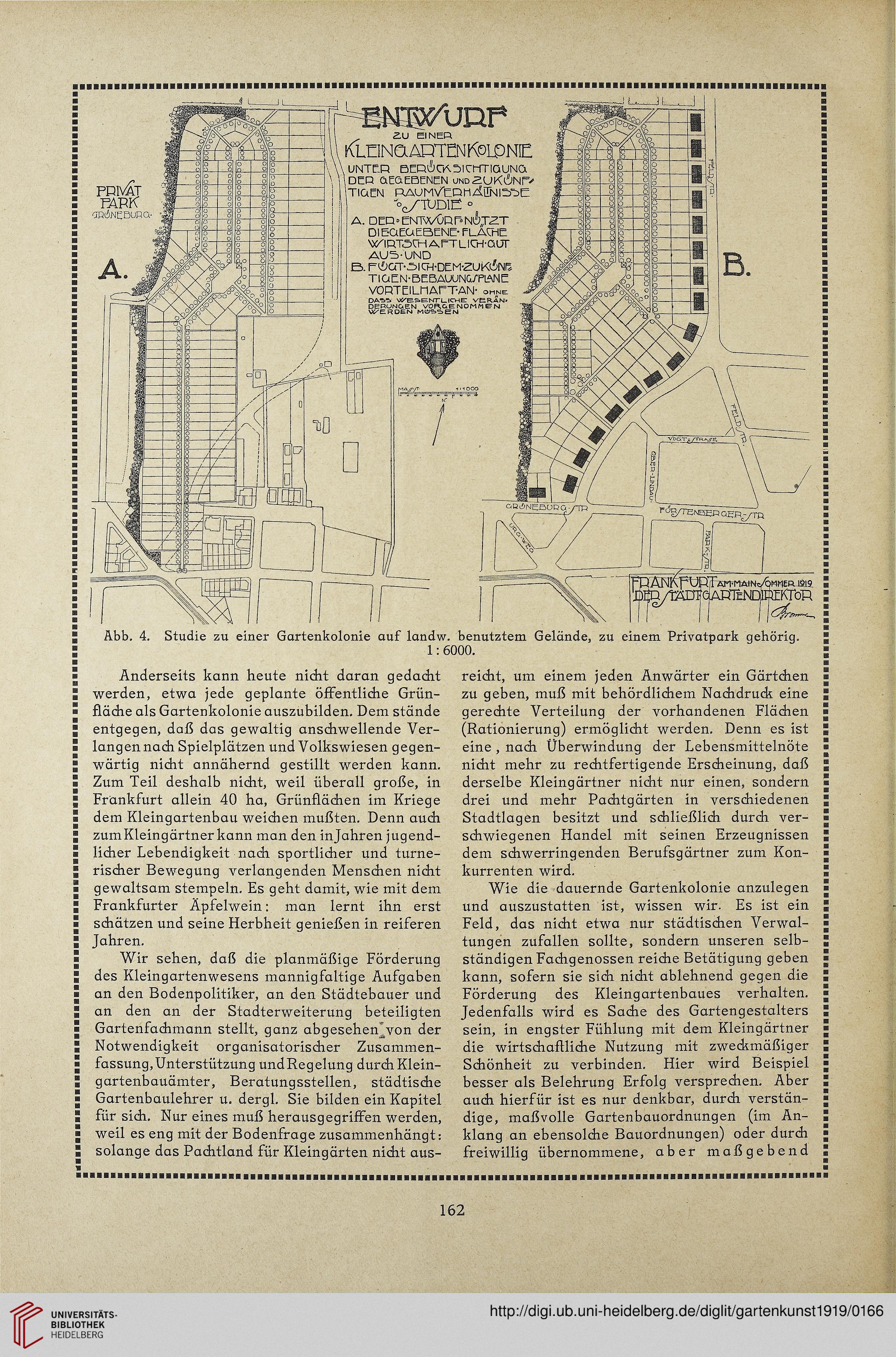PRIVAT
PAPK
an^NEBuRQ-
Abb. 4.
Studie zu einer Gartenkolonie auf landw. benutztem Gelände, zu einem Privatpark gehörig.
1:6000.
Anderseits kann heute nicht daran gedacht
werden, etwa jede geplante öffentliche Grün-
fläche als Gartenkolonie auszubilden. Dem stände
entgegen, daß das gewaltig anschwellende Ver-
langen nach Spielplätzen und Volkswiesen gegen-
wärtig nicht annähernd gestillt werden kann.
Zum Teil deshalb nicht, weil überall große, in
Frankfurt allein 40 ha, Grünflächen im Kriege
dem Kleingartenbau weichen mußten. Denn auch
zumKleingärtnerkann man den injahren jugend-
licher Lebendigkeit nach sportlicher und turne-
rischer Bewegung verlangenden Menschen nicht
gewaltsam stempeln. Es geht damit, wie mit dem
Frankfurter Apfelwein: man lernt ihn erst
schätzen und seine Herbheit genießen in reiferen
Jahren.
Wir sehen, daß die planmäßige Förderung
des Kleingartenwesens mannigfaltige Aufgaben
an den Bodenpolitiker, an den Städtebauer und
an den an der Stadterweiterung beteiligten
Gartenfachmann stellt, ganz abgesehen von der
Notwendigkeit organisatorischer Zusammen-
fassung, Unterstützung undRegelung durch Klein-
gartenbauämter, Beratungsstellen, städtische
Gartenbaulehrer u. dergl. Sie bilden ein Kapitel
für sich. Nur eines muß herausgegriffen werden,
weil es eng mit der Bodenfrage zusammenhängt:
solange das Pachtland für Kleingärten nicht aus-
reicht, um einem jeden Anwärter ein Gärtchen
zu geben, muß mit behördlichem Nachdruck eine
gerechte Verteilung der vorhandenen Flächen
(Rationierung) ermöglicht werden. Denn es ist
eine , nach Überwindung der Lebensmittelnöte
nicht mehr zu rechtfertigende Erscheinung, daß
derselbe Kleingärtner nicht nur einen, sondern
drei und mehr Pachtgärten in verschiedenen
Stadtlagen besitzt und schließlich durch ver-
schwiegenen Handel mit seinen Erzeugnissen
dem schwerringenden Berufsgärtner zum Kon-
kurrenten wird.
Wie die dauernde Gartenkolonie anzulegen
und auszustatten ist, wissen wir. Es ist ein
Feld, das nicht etwa nur städtischen Verwal-
tungen zufallen sollte, sondern unseren selb-
ständigen Fachgenossen reiche Betätigung geben
kann, sofern sie sich nicht ablehnend gegen die
Förderung des Kleingartenbaues verhalten.
Jedenfalls wird es Sache des Gartengestalters
sein, in engster Fühlung mit dem Kleingärtner
die wirtschaftliche Nutzung mit zweckmäßiger
Schönheit zu verbinden. Hier wird Beispiel
besser als Belehrung Erfolg versprechen. Aber
auch hierfür ist es nur denkbar, durch verstän-
dige, maßvolle Gartenbauordnungen (im An-
klang an ebensolche Bauordnungen) oder durch
freiwillig übernommene, aber maßgebend
162
PAPK
an^NEBuRQ-
Abb. 4.
Studie zu einer Gartenkolonie auf landw. benutztem Gelände, zu einem Privatpark gehörig.
1:6000.
Anderseits kann heute nicht daran gedacht
werden, etwa jede geplante öffentliche Grün-
fläche als Gartenkolonie auszubilden. Dem stände
entgegen, daß das gewaltig anschwellende Ver-
langen nach Spielplätzen und Volkswiesen gegen-
wärtig nicht annähernd gestillt werden kann.
Zum Teil deshalb nicht, weil überall große, in
Frankfurt allein 40 ha, Grünflächen im Kriege
dem Kleingartenbau weichen mußten. Denn auch
zumKleingärtnerkann man den injahren jugend-
licher Lebendigkeit nach sportlicher und turne-
rischer Bewegung verlangenden Menschen nicht
gewaltsam stempeln. Es geht damit, wie mit dem
Frankfurter Apfelwein: man lernt ihn erst
schätzen und seine Herbheit genießen in reiferen
Jahren.
Wir sehen, daß die planmäßige Förderung
des Kleingartenwesens mannigfaltige Aufgaben
an den Bodenpolitiker, an den Städtebauer und
an den an der Stadterweiterung beteiligten
Gartenfachmann stellt, ganz abgesehen von der
Notwendigkeit organisatorischer Zusammen-
fassung, Unterstützung undRegelung durch Klein-
gartenbauämter, Beratungsstellen, städtische
Gartenbaulehrer u. dergl. Sie bilden ein Kapitel
für sich. Nur eines muß herausgegriffen werden,
weil es eng mit der Bodenfrage zusammenhängt:
solange das Pachtland für Kleingärten nicht aus-
reicht, um einem jeden Anwärter ein Gärtchen
zu geben, muß mit behördlichem Nachdruck eine
gerechte Verteilung der vorhandenen Flächen
(Rationierung) ermöglicht werden. Denn es ist
eine , nach Überwindung der Lebensmittelnöte
nicht mehr zu rechtfertigende Erscheinung, daß
derselbe Kleingärtner nicht nur einen, sondern
drei und mehr Pachtgärten in verschiedenen
Stadtlagen besitzt und schließlich durch ver-
schwiegenen Handel mit seinen Erzeugnissen
dem schwerringenden Berufsgärtner zum Kon-
kurrenten wird.
Wie die dauernde Gartenkolonie anzulegen
und auszustatten ist, wissen wir. Es ist ein
Feld, das nicht etwa nur städtischen Verwal-
tungen zufallen sollte, sondern unseren selb-
ständigen Fachgenossen reiche Betätigung geben
kann, sofern sie sich nicht ablehnend gegen die
Förderung des Kleingartenbaues verhalten.
Jedenfalls wird es Sache des Gartengestalters
sein, in engster Fühlung mit dem Kleingärtner
die wirtschaftliche Nutzung mit zweckmäßiger
Schönheit zu verbinden. Hier wird Beispiel
besser als Belehrung Erfolg versprechen. Aber
auch hierfür ist es nur denkbar, durch verstän-
dige, maßvolle Gartenbauordnungen (im An-
klang an ebensolche Bauordnungen) oder durch
freiwillig übernommene, aber maßgebend
162