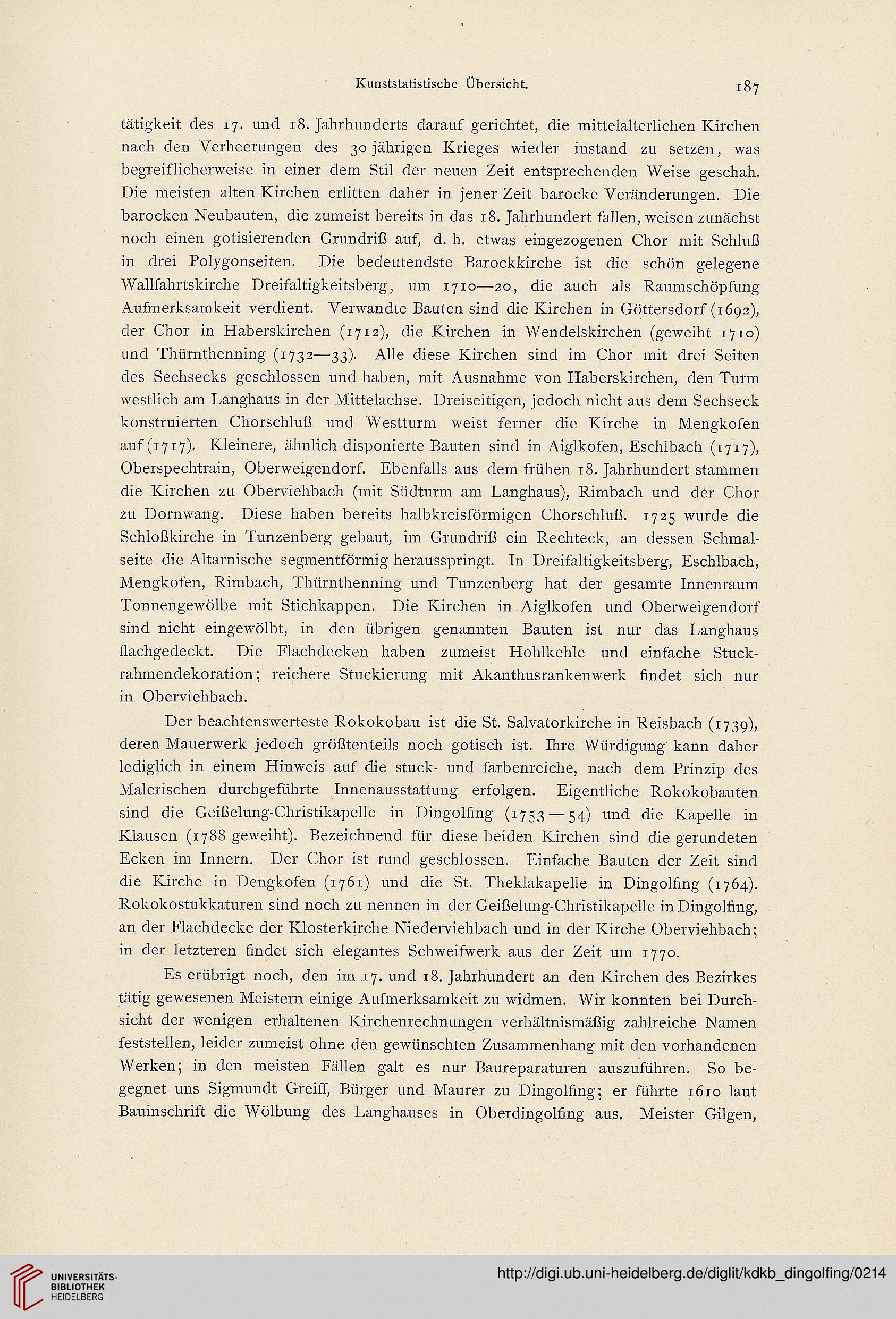Kunststatistische Übersicht.
187
tätigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts darauf gerichtet, die mittelalterlichen Kirchen
nach den Verheerungen des 30 jährigen Krieges wieder instand zu setzen, was
begreiflicherweise in einer dem Stil der neuen Zeit entsprechenden Weise geschah.
Die meisten alten Kirchen erlitten daher in jener Zeit barocke Veränderungen. Die
barocken Neubauten, die zumeist bereits in das 18. Jahrhundert fallen, weisen zunächst
noch einen gotisierenden Grundriß auf, d. h. etwas eingezogenen Chor mit Schluß
in drei Polygonseiten. Die bedeutendste Barockkirche ist die schön gelegene
Wallfahrtskirche Dreifaltigkeitsberg, um 1710—20, die auch als Raumschöpfung
Aufmerksamkeit verdient. Verwandte Bauten sind die Kirchen in Göttersdorf (1692),
der Chor in Haberskirchen (1712), die Kirchen in Wendelskirchen (geweiht 1710)
und Thürnthenning (1732—33). Alle diese Kirchen sind im Chor mit drei Seiten
des Sechsecks geschlossen und haben, mit Ausnahme von Haberskirchen, den Turm
westlich am Langhaus in der Mittelachse. Dreiseitigen, jedoch nicht aus dem Sechseck
konstruierten Chorschluß und Westturm weist ferner die Kirche in Mengkofen
auf (1717), Kleinere, ähnlich disponierte Bauten sind in Aiglkofen, Eschlbach (1717),
Oberspechtrain, Oberweigendorf. Ebenfalls aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen
die Kirchen zu Oberviehbach (mit Südturm am Langhaus), Rimbach und der Chor
zu Dornwang. Diese haben bereits halbkreisförmigen Chorschluß. 1725 wurde die
Schloßkirche in Tunzenberg gebaut, im Grundriß ein Rechteck, an dessen Schmal-
seite die Altarnische segmentförmig herausspringt. In Dreifaltigkeitsberg, Eschlbach,
Mengkofen, Rimbach, Thürnthenning und Tunzenberg hat der gesamte Innenraum
Tonnengewölbe mit Stichkappen. Die Kirchen in Aiglkofen und Oberweigendorf
sind nicht eingewölbt, in den übrigen genannten Bauten ist nur das Langhaus
flachgedeckt. Die Flachdecken haben zumeist Hohlkehle und einfache Stuck-
rahmendekoration ; reichere Stuckierung mit Akanthusrankenwerk findet sich nur
in Oberviehbach.
Der beachtenswerteste Rokokobau ist die St. Salvatorkirche in Reisbach (1739),
deren Mauerwerk jedoch größtenteils noch gotisch ist. Ihre Würdigung kann daher
lediglich in einem Hinweis auf die stuck- und farbenreiche, nach dem Prinzip des
Malerischen durchgeführte Innenausstattung erfolgen. Eigentliche Rokokobauten
sind die Geißelung-Christikapelle in Dingolfing (1733 — 54) und die Kapelle in
Klausen (1788 geweiht). Bezeichnend für diese beiden Kirchen sind die gerundeten
Ecken im Innern. Der Chor ist rund geschlossen. Einfache Bauten der Zeit sind
die Kirche in Dengkofen (1761) und die St. Theklakapelle in Dingolfing (1764).
Rokokostukkaturen sind noch zu nennen in der Geißelung-Christikapelle in Dingolfing,
an der Flachdecke der Klosterkirche Niederviehbach und in der Kirche Oberviehbach;
in der letzteren findet sich elegantes Schweifwerk aus der Zeit um 1770.
Es erübrigt noch, den im 17. und 18. Jahrhundert an den Kirchen des Bezirkes
tätig gewesenen Meistern einige Aufmerksamkeit zu widmen. Wir konnten bei Durch-
sicht der wenigen erhaltenen Kirchenrechnungen verhältnismäßig zahlreiche Namen
feststellen, leider zumeist ohne den gewünschten Zusammenhang mit den vorhandenen
Werken; in den meisten Fällen galt es nur Baureparaturen auszuführen. So be-
gegnet uns Sigmundt Greiff, Bürger und Maurer zu Dingolfing; er führte 1610 laut
Bauinschrift die Wölbung des Langhauses in Oberdingolfing aus. Meister Gilgen,
187
tätigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts darauf gerichtet, die mittelalterlichen Kirchen
nach den Verheerungen des 30 jährigen Krieges wieder instand zu setzen, was
begreiflicherweise in einer dem Stil der neuen Zeit entsprechenden Weise geschah.
Die meisten alten Kirchen erlitten daher in jener Zeit barocke Veränderungen. Die
barocken Neubauten, die zumeist bereits in das 18. Jahrhundert fallen, weisen zunächst
noch einen gotisierenden Grundriß auf, d. h. etwas eingezogenen Chor mit Schluß
in drei Polygonseiten. Die bedeutendste Barockkirche ist die schön gelegene
Wallfahrtskirche Dreifaltigkeitsberg, um 1710—20, die auch als Raumschöpfung
Aufmerksamkeit verdient. Verwandte Bauten sind die Kirchen in Göttersdorf (1692),
der Chor in Haberskirchen (1712), die Kirchen in Wendelskirchen (geweiht 1710)
und Thürnthenning (1732—33). Alle diese Kirchen sind im Chor mit drei Seiten
des Sechsecks geschlossen und haben, mit Ausnahme von Haberskirchen, den Turm
westlich am Langhaus in der Mittelachse. Dreiseitigen, jedoch nicht aus dem Sechseck
konstruierten Chorschluß und Westturm weist ferner die Kirche in Mengkofen
auf (1717), Kleinere, ähnlich disponierte Bauten sind in Aiglkofen, Eschlbach (1717),
Oberspechtrain, Oberweigendorf. Ebenfalls aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen
die Kirchen zu Oberviehbach (mit Südturm am Langhaus), Rimbach und der Chor
zu Dornwang. Diese haben bereits halbkreisförmigen Chorschluß. 1725 wurde die
Schloßkirche in Tunzenberg gebaut, im Grundriß ein Rechteck, an dessen Schmal-
seite die Altarnische segmentförmig herausspringt. In Dreifaltigkeitsberg, Eschlbach,
Mengkofen, Rimbach, Thürnthenning und Tunzenberg hat der gesamte Innenraum
Tonnengewölbe mit Stichkappen. Die Kirchen in Aiglkofen und Oberweigendorf
sind nicht eingewölbt, in den übrigen genannten Bauten ist nur das Langhaus
flachgedeckt. Die Flachdecken haben zumeist Hohlkehle und einfache Stuck-
rahmendekoration ; reichere Stuckierung mit Akanthusrankenwerk findet sich nur
in Oberviehbach.
Der beachtenswerteste Rokokobau ist die St. Salvatorkirche in Reisbach (1739),
deren Mauerwerk jedoch größtenteils noch gotisch ist. Ihre Würdigung kann daher
lediglich in einem Hinweis auf die stuck- und farbenreiche, nach dem Prinzip des
Malerischen durchgeführte Innenausstattung erfolgen. Eigentliche Rokokobauten
sind die Geißelung-Christikapelle in Dingolfing (1733 — 54) und die Kapelle in
Klausen (1788 geweiht). Bezeichnend für diese beiden Kirchen sind die gerundeten
Ecken im Innern. Der Chor ist rund geschlossen. Einfache Bauten der Zeit sind
die Kirche in Dengkofen (1761) und die St. Theklakapelle in Dingolfing (1764).
Rokokostukkaturen sind noch zu nennen in der Geißelung-Christikapelle in Dingolfing,
an der Flachdecke der Klosterkirche Niederviehbach und in der Kirche Oberviehbach;
in der letzteren findet sich elegantes Schweifwerk aus der Zeit um 1770.
Es erübrigt noch, den im 17. und 18. Jahrhundert an den Kirchen des Bezirkes
tätig gewesenen Meistern einige Aufmerksamkeit zu widmen. Wir konnten bei Durch-
sicht der wenigen erhaltenen Kirchenrechnungen verhältnismäßig zahlreiche Namen
feststellen, leider zumeist ohne den gewünschten Zusammenhang mit den vorhandenen
Werken; in den meisten Fällen galt es nur Baureparaturen auszuführen. So be-
gegnet uns Sigmundt Greiff, Bürger und Maurer zu Dingolfing; er führte 1610 laut
Bauinschrift die Wölbung des Langhauses in Oberdingolfing aus. Meister Gilgen,