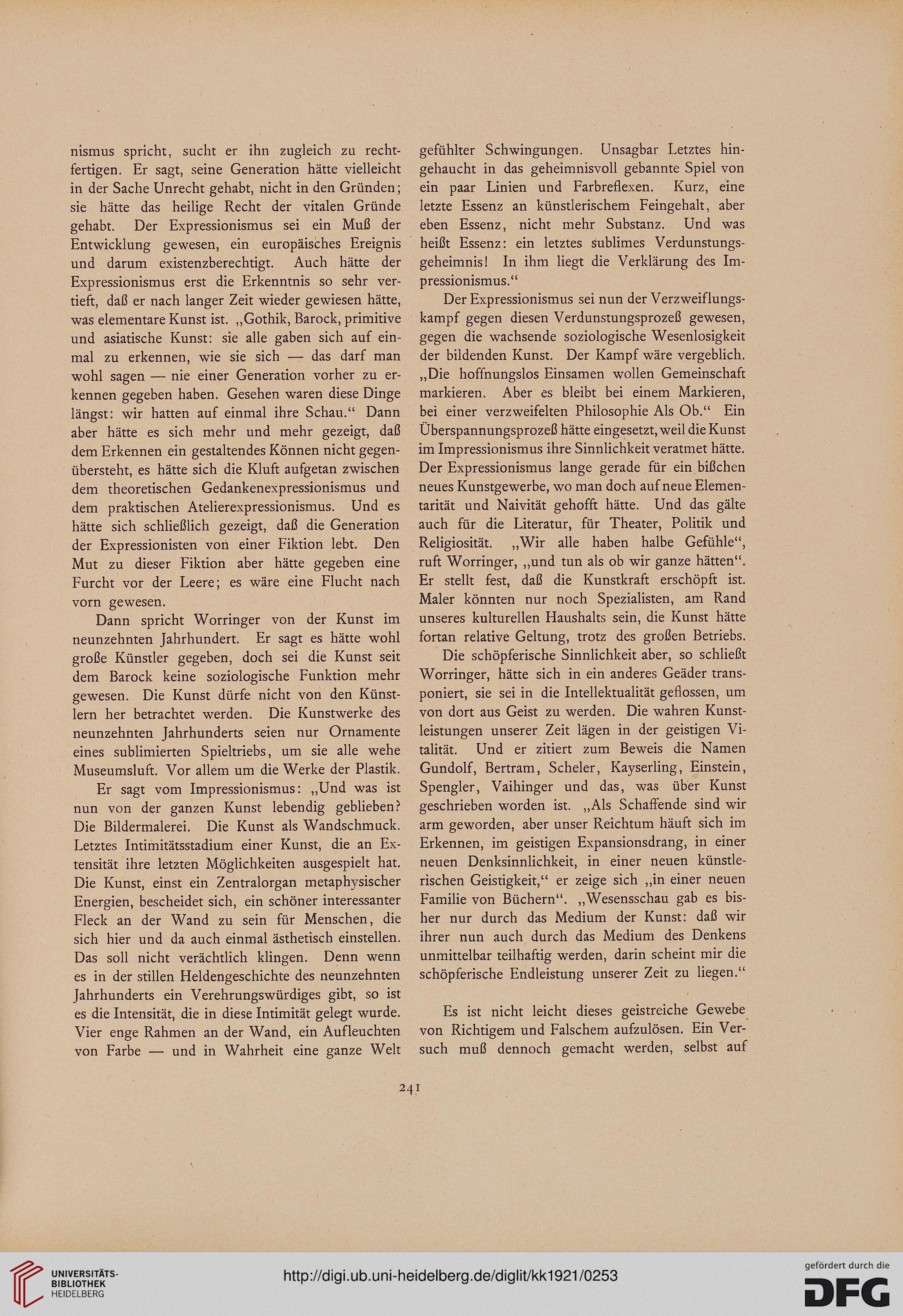nismus spricht, sucht er ihn zugleich zu recht-
fertigen. Er sagt, seine Generation hätte vielleicht
in der Sache Unrecht gehabt, nicht in den Gründen;
sie hätte das heilige Recht der vitalen Gründe
gehabt. Der Expressionismus sei ein Muß der
Entwicklung gewesen, ein europäisches Ereignis
und darum existenzberechtigt. Auch hätte der
Expressionismus erst die Erkenntnis so sehr ver-
tieft, daß er nach langer Zeit wieder gewiesen hätte,
was elementare Kunst ist. „Gothik, Barock, primitive
und asiatische Kunst: sie alle gaben sich auf ein-
mal zu erkennen, wie sie sich — das darf man
wohl sagen — nie einer Generation vorher zu er-
kennen gegeben haben. Gesehen waren diese Dinge
längst: wir hatten auf einmal ihre Schau." Dann
aber hätte es sich mehr und mehr gezeigt, daß
dem Erkennen ein gestaltendes Können nicht gegen-
übersteht, es hätte sich die Kluft aufgetan zwischen
dem theoretischen Gedankenexpressionismus und
dem praktischen Atelierexpressionismus. Und es
hätte sich schließlich gezeigt, daß die Generation
der Expressionisten vori einer Fiktion lebt. Den
Mut zu dieser Fiktion aber hätte gegeben eine
Furcht vor der Leere; es wäre eine Flucht nach
vorn gewesen.
Dann spricht Worringer von der Kunst im
neunzehnten Jahrhundert. Er sagt es hätte wohl
große Künstler gegeben, doch sei die Kunst seit
dem Barock keine soziologische Funktion mehr
gewesen. Die Kunst dürfe nicht von den Künst-
lern her betrachtet werden. Die Kunstwerke des
neunzehnten Jahrhunderts seien nur Ornamente
eines sublimierten Spieltriebs, um sie alle wehe
Museumsluft. Vor allem um die Werke der Plastik.
Er sagt vom Impressionismus: „Und was ist
nun von der ganzen Kunst lebendig geblieben?
Die Bildermalerei. Die Kunst als Wandschmuck.
Letztes Intimitätsstadium einer Kunst, die an Ex-
tensität ihre letzten Möglichkeiten ausgespielt hat.
Die Kunst, einst ein Zentralorgan metaphysischer
Energien, bescheidet sich, ein schöner interessanter
Fleck an der Wand zu sein für Menschen, die
sich hier und da auch einmal ästhetisch einstellen.
Das soll nicht verächtlich klingen. Denn wenn
es in der stillen Heldengeschichte des neunzehnten
Jahrhunderts ein Verehrungswürdiges gibt, so ist
es die Intensität, die in diese Intimität gelegt wurde.
Vier enge Rahmen an der Wand, ein Aufleuchten
von Farbe — und in Wahrheit eine ganze Welt
gefühlter Schwingungen. Unsagbar Letztes hin-
gehaucht in das geheimnisvoll gebannte Spiel von
ein paar Linien und Farbreflexen. Kurz, eine
letzte Essenz an künstlerischem Feingehalt, aber
eben Essenz, nicht mehr Substanz. Und was
heißt Essenz: ein letztes sublimes Verdunstungs-
geheimnis! In ihm liegt die Verklärung des Im-
pressionismus."
Der Expressionismus sei nun der Verzweiflungs-
kampf gegen diesen Verdunstungsprozeß gewesen,
gegen die wachsende soziologische Wesenlosigkeit
der bildenden Kunst. Der Kampf wäre vergeblich.
„Die hoffnungslos Einsamen wollen Gemeinschaft
markieren. Aber es bleibt bei einem Markieren,
bei einer verzweifelten Philosophie Als Ob." Ein
Überspannungsprozeß hätte eingesetzt, weil die Kunst
im Impressionismus ihre Sinnlichkeit veratmet hätte.
Der Expressionismus lange gerade für ein bißchen
neues Kunstgewerbe, wo man doch auf neue Elemen-
tarität und Naivität gehofft hätte. Und das gälte
auch für die Literatur, für Theater, Politik und
Religiosität. „Wir alle haben halbe Gefühle",
ruft Worringer, „und tun als ob wir ganze hätten".
Er stellt fest, daß die Kunstkraft erschöpft ist.
Maler könnten nur noch Spezialisten, am Rand
unseres kulturellen Haushalts sein, die Kunst hätte
fortan relative Geltung, trotz des großen Betriebs.
Die schöpferische Sinnlichkeit aber, so schließt
Worringer, hätte sich in ein anderes Geäder trans-
poniert, sie sei in die Intellektualität geflossen, um
von dort aus Geist zu werden. Die wahren Kunst-
leistungen unserer Zeit lägen in der geistigen Vi-
talität. Und er zitiert zum Beweis die Namen
Gundolf, Bertram, Scheler, Kayserling, Einstein,
Spengler, Vaihinger und das, was über Kunst
geschrieben worden ist. „Als Schaffende sind wir
arm geworden, aber unser Reichtum häuft sich im
Erkennen, im geistigen Expansionsdrang, in einer
neuen Denksinnlichkeit, in einer neuen künstle-
rischen Geistigkeit," er zeige sich „in einer neuen
Familie von Büchern". „Wesensschau gab es bis-
her nur durch das Medium der Kunst: daß wir
ihrer nun auch durch das Medium des Denkens
unmittelbar teilhaftig werden, darin scheint mir die
schöpferische Endleistung unserer Zeit zu liegen."
Es ist nicht leicht dieses geistreiche Gewebe
von Richtigem und Falschem aufzulösen. Ein Ver-
such muß dennoch gemacht werden, selbst auf
241
fertigen. Er sagt, seine Generation hätte vielleicht
in der Sache Unrecht gehabt, nicht in den Gründen;
sie hätte das heilige Recht der vitalen Gründe
gehabt. Der Expressionismus sei ein Muß der
Entwicklung gewesen, ein europäisches Ereignis
und darum existenzberechtigt. Auch hätte der
Expressionismus erst die Erkenntnis so sehr ver-
tieft, daß er nach langer Zeit wieder gewiesen hätte,
was elementare Kunst ist. „Gothik, Barock, primitive
und asiatische Kunst: sie alle gaben sich auf ein-
mal zu erkennen, wie sie sich — das darf man
wohl sagen — nie einer Generation vorher zu er-
kennen gegeben haben. Gesehen waren diese Dinge
längst: wir hatten auf einmal ihre Schau." Dann
aber hätte es sich mehr und mehr gezeigt, daß
dem Erkennen ein gestaltendes Können nicht gegen-
übersteht, es hätte sich die Kluft aufgetan zwischen
dem theoretischen Gedankenexpressionismus und
dem praktischen Atelierexpressionismus. Und es
hätte sich schließlich gezeigt, daß die Generation
der Expressionisten vori einer Fiktion lebt. Den
Mut zu dieser Fiktion aber hätte gegeben eine
Furcht vor der Leere; es wäre eine Flucht nach
vorn gewesen.
Dann spricht Worringer von der Kunst im
neunzehnten Jahrhundert. Er sagt es hätte wohl
große Künstler gegeben, doch sei die Kunst seit
dem Barock keine soziologische Funktion mehr
gewesen. Die Kunst dürfe nicht von den Künst-
lern her betrachtet werden. Die Kunstwerke des
neunzehnten Jahrhunderts seien nur Ornamente
eines sublimierten Spieltriebs, um sie alle wehe
Museumsluft. Vor allem um die Werke der Plastik.
Er sagt vom Impressionismus: „Und was ist
nun von der ganzen Kunst lebendig geblieben?
Die Bildermalerei. Die Kunst als Wandschmuck.
Letztes Intimitätsstadium einer Kunst, die an Ex-
tensität ihre letzten Möglichkeiten ausgespielt hat.
Die Kunst, einst ein Zentralorgan metaphysischer
Energien, bescheidet sich, ein schöner interessanter
Fleck an der Wand zu sein für Menschen, die
sich hier und da auch einmal ästhetisch einstellen.
Das soll nicht verächtlich klingen. Denn wenn
es in der stillen Heldengeschichte des neunzehnten
Jahrhunderts ein Verehrungswürdiges gibt, so ist
es die Intensität, die in diese Intimität gelegt wurde.
Vier enge Rahmen an der Wand, ein Aufleuchten
von Farbe — und in Wahrheit eine ganze Welt
gefühlter Schwingungen. Unsagbar Letztes hin-
gehaucht in das geheimnisvoll gebannte Spiel von
ein paar Linien und Farbreflexen. Kurz, eine
letzte Essenz an künstlerischem Feingehalt, aber
eben Essenz, nicht mehr Substanz. Und was
heißt Essenz: ein letztes sublimes Verdunstungs-
geheimnis! In ihm liegt die Verklärung des Im-
pressionismus."
Der Expressionismus sei nun der Verzweiflungs-
kampf gegen diesen Verdunstungsprozeß gewesen,
gegen die wachsende soziologische Wesenlosigkeit
der bildenden Kunst. Der Kampf wäre vergeblich.
„Die hoffnungslos Einsamen wollen Gemeinschaft
markieren. Aber es bleibt bei einem Markieren,
bei einer verzweifelten Philosophie Als Ob." Ein
Überspannungsprozeß hätte eingesetzt, weil die Kunst
im Impressionismus ihre Sinnlichkeit veratmet hätte.
Der Expressionismus lange gerade für ein bißchen
neues Kunstgewerbe, wo man doch auf neue Elemen-
tarität und Naivität gehofft hätte. Und das gälte
auch für die Literatur, für Theater, Politik und
Religiosität. „Wir alle haben halbe Gefühle",
ruft Worringer, „und tun als ob wir ganze hätten".
Er stellt fest, daß die Kunstkraft erschöpft ist.
Maler könnten nur noch Spezialisten, am Rand
unseres kulturellen Haushalts sein, die Kunst hätte
fortan relative Geltung, trotz des großen Betriebs.
Die schöpferische Sinnlichkeit aber, so schließt
Worringer, hätte sich in ein anderes Geäder trans-
poniert, sie sei in die Intellektualität geflossen, um
von dort aus Geist zu werden. Die wahren Kunst-
leistungen unserer Zeit lägen in der geistigen Vi-
talität. Und er zitiert zum Beweis die Namen
Gundolf, Bertram, Scheler, Kayserling, Einstein,
Spengler, Vaihinger und das, was über Kunst
geschrieben worden ist. „Als Schaffende sind wir
arm geworden, aber unser Reichtum häuft sich im
Erkennen, im geistigen Expansionsdrang, in einer
neuen Denksinnlichkeit, in einer neuen künstle-
rischen Geistigkeit," er zeige sich „in einer neuen
Familie von Büchern". „Wesensschau gab es bis-
her nur durch das Medium der Kunst: daß wir
ihrer nun auch durch das Medium des Denkens
unmittelbar teilhaftig werden, darin scheint mir die
schöpferische Endleistung unserer Zeit zu liegen."
Es ist nicht leicht dieses geistreiche Gewebe
von Richtigem und Falschem aufzulösen. Ein Ver-
such muß dennoch gemacht werden, selbst auf
241