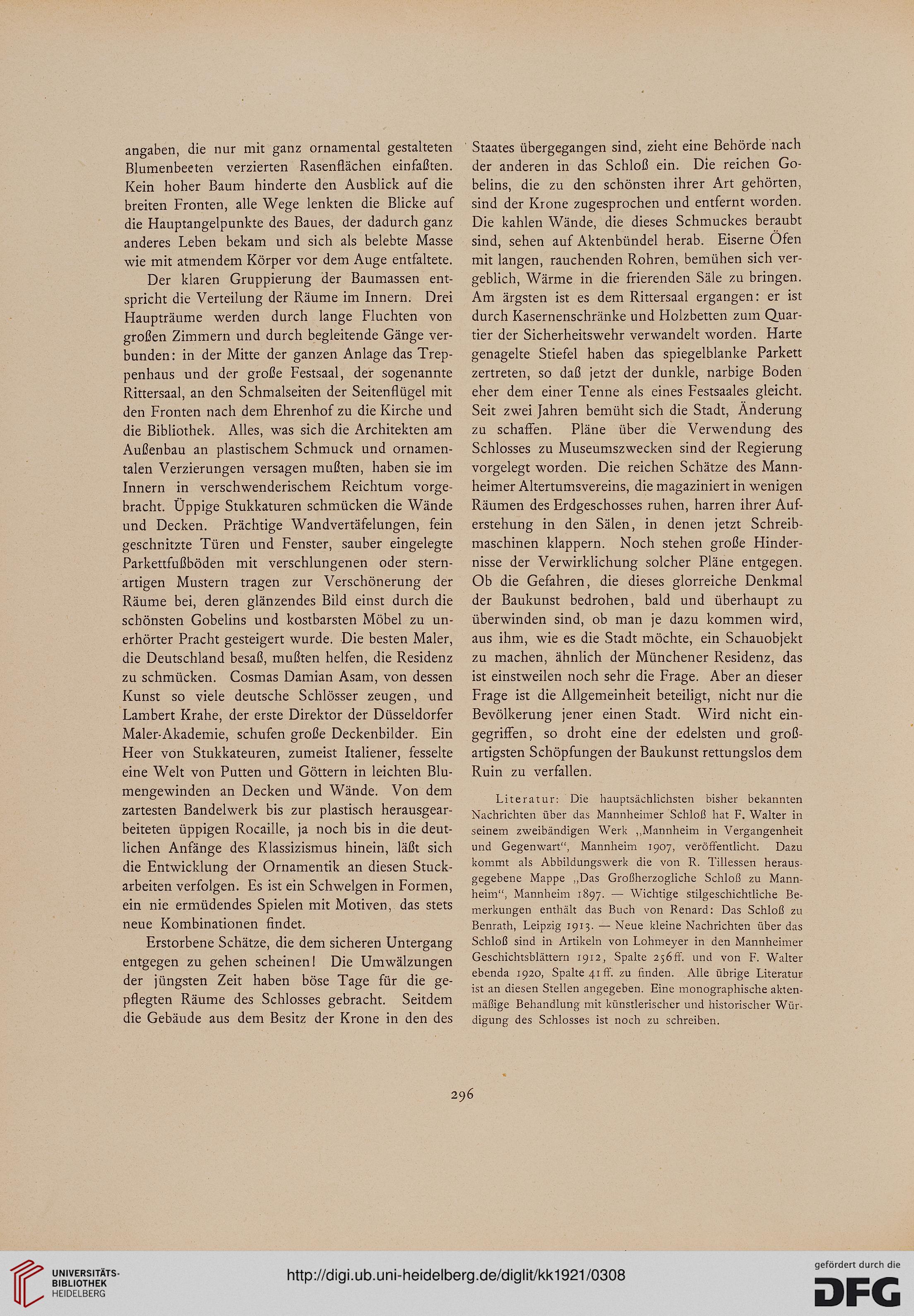angaben, die nur mit ganz ornamental gestalteten
Blumenbeeten verzierten Rasenflächen einfaßten.
Kein hoher Baum hinderte den Ausblick auf die
breiten Fronten, alle Wege lenkten die Blicke auf
die Hauptangelpunkte des Baues, der dadurch ganz
anderes Leben bekam und sich als belebte Masse
wie mit atmendem Körper vor dem Auge entfaltete.
Der klaren Gruppierung der Baumassen ent-
spricht die Verteilung der Räume im Innern. Drei
Haupträume werden durch lange Fluchten von
großen Zimmern und durch begleitende Gänge ver-
bunden : in der Mitte der ganzen Anlage das Trep-
penhaus und der große Festsaal, der sogenannte
Rittersaal, an den Schmalseiten der Seitenflügel mit
den Fronten nach dem Ehrenhof zu die Kirche und
die Bibliothek. Alles, was sich die Architekten am
Außenbau an plastischem Schmuck und ornamen-
talen Verzierungen versagen mußten, haben sie im
Innern in verschwenderischem Reichtum vorge-
bracht. Üppige Stukkaturen schmücken die Wände
und Decken. Prächtige Wandvertäfelungen, fein
geschnitzte Türen und Fenster, sauber eingelegte
Parkettfußböden mit verschlungenen oder stern-
artigen Mustern tragen zur Verschönerung der
Räume bei, deren glänzendes Bild einst durch die
schönsten Gobelins und kostbarsten Möbel zu un-
erhörter Pracht gesteigert wurde. Die besten Maler,
die Deutschland besaß, mußten helfen, die Residenz
zu schmücken. Cosmas Damian Asam, von dessen
Kunst so viele deutsche Schlösser zeugen, und
Lambert Krähe, der erste Direktor der Düsseldorfer
Maler-Akademie, schufen große Deckenbilder. Ein
Heer von Stukkateuren, zumeist Italiener, fesselte
eine Welt von Putten und Göttern in leichten Blu-
mengewinden an Decken und Wände. Von dem
zartesten Bandelwerk bis zur plastisch herausgear-
beiteten üppigen Rocaille, ja noch bis in die deut-
lichen Anfänge des Klassizismus hinein, läßt sich
die Entwicklung der Ornamentik an diesen Stuck-
arbeiten verfolgen. Es ist ein Schwelgen in Formen,
ein nie ermüdendes Spielen mit Motiven, das stets
neue Kombinationen findet.
Erstorbene Schätze, die dem sicheren Untergang
entgegen zu gehen scheinen I Die Umwälzungen
der jüngsten Zeit haben böse Tage für die ge-
pflegten Räume des Schlosses gebracht. Seitdem
die Gebäude aus dem Besitz der Krone in den des
Staates übergegangen sind, zieht eine Behörde nach
der anderen in das Schloß ein. Die reichen Go-
belins, die zu den schönsten ihrer Art gehörten,
sind der Krone zugesprochen und entfernt worden.
Die kahlen Wände, die dieses Schmuckes beraubt
sind, sehen auf Aktenbündel herab. Eiserne Ofen
mit langen, rauchenden Rohren, bemühen sich ver-
geblich, Wärme in die frierenden Säle zu bringen.
Am ärgsten ist es dem Rittersaal ergangen: er ist
durch Kasernenschränke und Holzbetten zum Quar-
tier der Sicherheitswehr verwandelt worden. Harte
genagelte Stiefel haben das spiegelblanke Parkett
zertreten, so daß jetzt der dunkle, narbige Boden
eher dem einer Tenne als eines Festsaales gleicht.
Seit zwei Jahren bemüht sich die Stadt, Änderung
zu schaffen. Pläne über die Verwendung des
Schlosses zu Museumszwecken sind der Regierung
vorgelegt worden. Die reichen Schätze des Mann-
heimer Altertumsvereins, die magaziniert in wenigen
Räumen des Erdgeschosses ruhen, harren ihrer Auf-
erstehung in den Sälen, in denen jetzt Schreib-
maschinen klappern. Noch stehen große Hinder-
nisse der Verwirklichung solcher Pläne entgegen.
Ob die Gefahren, die dieses glorreiche Denkmal
der Baukunst bedrohen, bald und überhaupt zu
überwinden sind, ob man je dazu kommen wird,
aus ihm, wie es die Stadt möchte, ein Schauobjekt
zu machen, ähnlich der Münchener Residenz, das
ist einstweilen noch sehr die Frage. Aber an dieser
Frage ist die Allgemeinheit beteiligt, nicht nur die
Bevölkerung jener einen Stadt. Wird nicht ein-
gegriffen, so droht eine der edelsten und groß-
artigsten Schöpfungen der Baukunst rettungslos dem
Ruin zu verfallen.
Literatur: Die hauptsächlichsten bisher bekannten
Nachrichten über das Mannheimer Schloß hat F. Walter in
seinem zweibändigen Werk ,,Mannheim in Vergangenheit
und Gegenwart", Mannheim 1907, veröffentlicht. Dazu
kommt als Abbildungswerk die von R. Tillessen heraus-
gegebene Mappe „Das Großherzogliche Schloß zu Mann-
heim", Mannheim 1897. — Wichtige stilgeschichtliche Be-
merkungen enthält das Buch von Renard: Das Schloß zu
Benrath, Leipzig 1913. — Neue kleine Nachrichten über das
Schloß sind in Artikeln von Lohmeyer in den Mannheimer
Geschichtsblättern 1912, Spalte 256ff. und von F. Walter
ebenda 1920, Spalte 41 ff. zu finden. Alle übrige Literatur
ist an diesen Stellen angegeben. Eine monographische akten-
mäßige Behandlung mit künstlerischer und historischer Wür-
digung des Schlosses ist noch zu schreiben.
296
Blumenbeeten verzierten Rasenflächen einfaßten.
Kein hoher Baum hinderte den Ausblick auf die
breiten Fronten, alle Wege lenkten die Blicke auf
die Hauptangelpunkte des Baues, der dadurch ganz
anderes Leben bekam und sich als belebte Masse
wie mit atmendem Körper vor dem Auge entfaltete.
Der klaren Gruppierung der Baumassen ent-
spricht die Verteilung der Räume im Innern. Drei
Haupträume werden durch lange Fluchten von
großen Zimmern und durch begleitende Gänge ver-
bunden : in der Mitte der ganzen Anlage das Trep-
penhaus und der große Festsaal, der sogenannte
Rittersaal, an den Schmalseiten der Seitenflügel mit
den Fronten nach dem Ehrenhof zu die Kirche und
die Bibliothek. Alles, was sich die Architekten am
Außenbau an plastischem Schmuck und ornamen-
talen Verzierungen versagen mußten, haben sie im
Innern in verschwenderischem Reichtum vorge-
bracht. Üppige Stukkaturen schmücken die Wände
und Decken. Prächtige Wandvertäfelungen, fein
geschnitzte Türen und Fenster, sauber eingelegte
Parkettfußböden mit verschlungenen oder stern-
artigen Mustern tragen zur Verschönerung der
Räume bei, deren glänzendes Bild einst durch die
schönsten Gobelins und kostbarsten Möbel zu un-
erhörter Pracht gesteigert wurde. Die besten Maler,
die Deutschland besaß, mußten helfen, die Residenz
zu schmücken. Cosmas Damian Asam, von dessen
Kunst so viele deutsche Schlösser zeugen, und
Lambert Krähe, der erste Direktor der Düsseldorfer
Maler-Akademie, schufen große Deckenbilder. Ein
Heer von Stukkateuren, zumeist Italiener, fesselte
eine Welt von Putten und Göttern in leichten Blu-
mengewinden an Decken und Wände. Von dem
zartesten Bandelwerk bis zur plastisch herausgear-
beiteten üppigen Rocaille, ja noch bis in die deut-
lichen Anfänge des Klassizismus hinein, läßt sich
die Entwicklung der Ornamentik an diesen Stuck-
arbeiten verfolgen. Es ist ein Schwelgen in Formen,
ein nie ermüdendes Spielen mit Motiven, das stets
neue Kombinationen findet.
Erstorbene Schätze, die dem sicheren Untergang
entgegen zu gehen scheinen I Die Umwälzungen
der jüngsten Zeit haben böse Tage für die ge-
pflegten Räume des Schlosses gebracht. Seitdem
die Gebäude aus dem Besitz der Krone in den des
Staates übergegangen sind, zieht eine Behörde nach
der anderen in das Schloß ein. Die reichen Go-
belins, die zu den schönsten ihrer Art gehörten,
sind der Krone zugesprochen und entfernt worden.
Die kahlen Wände, die dieses Schmuckes beraubt
sind, sehen auf Aktenbündel herab. Eiserne Ofen
mit langen, rauchenden Rohren, bemühen sich ver-
geblich, Wärme in die frierenden Säle zu bringen.
Am ärgsten ist es dem Rittersaal ergangen: er ist
durch Kasernenschränke und Holzbetten zum Quar-
tier der Sicherheitswehr verwandelt worden. Harte
genagelte Stiefel haben das spiegelblanke Parkett
zertreten, so daß jetzt der dunkle, narbige Boden
eher dem einer Tenne als eines Festsaales gleicht.
Seit zwei Jahren bemüht sich die Stadt, Änderung
zu schaffen. Pläne über die Verwendung des
Schlosses zu Museumszwecken sind der Regierung
vorgelegt worden. Die reichen Schätze des Mann-
heimer Altertumsvereins, die magaziniert in wenigen
Räumen des Erdgeschosses ruhen, harren ihrer Auf-
erstehung in den Sälen, in denen jetzt Schreib-
maschinen klappern. Noch stehen große Hinder-
nisse der Verwirklichung solcher Pläne entgegen.
Ob die Gefahren, die dieses glorreiche Denkmal
der Baukunst bedrohen, bald und überhaupt zu
überwinden sind, ob man je dazu kommen wird,
aus ihm, wie es die Stadt möchte, ein Schauobjekt
zu machen, ähnlich der Münchener Residenz, das
ist einstweilen noch sehr die Frage. Aber an dieser
Frage ist die Allgemeinheit beteiligt, nicht nur die
Bevölkerung jener einen Stadt. Wird nicht ein-
gegriffen, so droht eine der edelsten und groß-
artigsten Schöpfungen der Baukunst rettungslos dem
Ruin zu verfallen.
Literatur: Die hauptsächlichsten bisher bekannten
Nachrichten über das Mannheimer Schloß hat F. Walter in
seinem zweibändigen Werk ,,Mannheim in Vergangenheit
und Gegenwart", Mannheim 1907, veröffentlicht. Dazu
kommt als Abbildungswerk die von R. Tillessen heraus-
gegebene Mappe „Das Großherzogliche Schloß zu Mann-
heim", Mannheim 1897. — Wichtige stilgeschichtliche Be-
merkungen enthält das Buch von Renard: Das Schloß zu
Benrath, Leipzig 1913. — Neue kleine Nachrichten über das
Schloß sind in Artikeln von Lohmeyer in den Mannheimer
Geschichtsblättern 1912, Spalte 256ff. und von F. Walter
ebenda 1920, Spalte 41 ff. zu finden. Alle übrige Literatur
ist an diesen Stellen angegeben. Eine monographische akten-
mäßige Behandlung mit künstlerischer und historischer Wür-
digung des Schlosses ist noch zu schreiben.
296