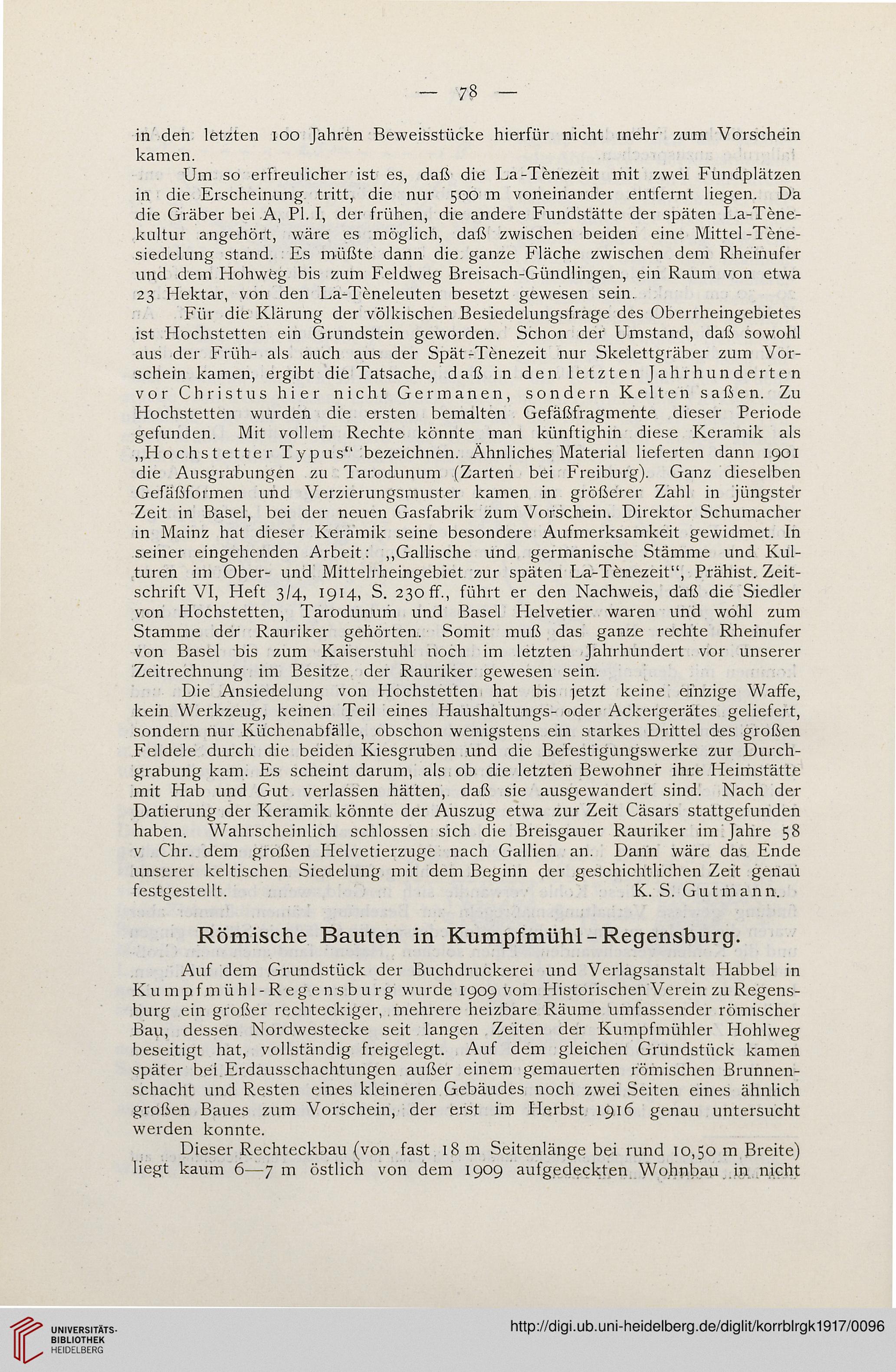78
in den letzten ioo Jahren Beweisstücke hierfür nicht mehr zum Vorschein
kamen.
Um so erfreulicher ist es, daß die La-Tenezeit mit zwei Fundplätzen
in die Erscheinung tritt, die nur 500 m voneinander entfernt liegen. Da
die Gräber bei A, PI. I, der frühen, die andere Fundstätte der späten La-Tene-
kultur angehört, wäre es möglich, daß zwischen beiden eine Mittel-Tene-
siedelung stand. Es müßte dann die. ganze Fläche zwischen dem Rheinufer
und dem Hohweg bis zum Feldweg Breisach-Gündlingen, ein Raum von etwa
23 Hektar, von den La-Teneleuten besetzt gewesen sein.
Für die Klärung der völkischen Besiedelungsfrage des Oberrheingebietes
ist Hochstetten ein Grundstein geworden. Schon der Umstand, daß sowohl
aus der Früh- als auch aus der Spät-Tenezeit nur Skelettgräber zum Vor-
schein kamen, ergibt die Tatsache, daß in den letzten Jahrhunderten
vor Christus hier nicht Germanen, sondern Kelten saßen. Zu
Hochstetten wurden die ersten bemalten Gefäßfragmente dieser Periode
gefunden. Mit vollem Rechte könnte man künftighin diese Keramik als
„Hochstetter Typus“ bezeichnen. Ähnliches Material lieferten dann 1901
die Ausgrabungen zu Tarodunum (Zarten bei Freiburg). Ganz dieselben
Gefäßform.en und Verzierungsmuster kamen in größerer Zahl in jüngster
Zeit in Basel, bei der neuen Gasfabrik zum Vorschein. Direktor Schumacher
in Mainz hat dieser Keramik seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In
seiner eingehenden Arbeit: „Gallische und germanische Stämme und Kul-
turen im Ober- und Mittelrheingebiet zur späten La-Tenezeit“, Prähist. Zeit-
schrift VI, Heft 3/4, 1914, S. 230 ff., führt er den Nachweis, daß die Siedler
von Hochstetten, Tarodunum und Basel Helvetier waren und wohl zum
Stamme der Rauriker gehörten. Somit muß das ganze rechte Rheinufer
von Basel bis zum Kaiserstuhl noch im letzten Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung im Besitze der Rauriker gewesen sein.
Die Ansiedelung von Hochstetten hat bis jetzt keine einzige Waffe,
kein Werkzeug, keinen Teil eines Haushaltungs- oder Ackergerätes geliefert,
sondern nur Küchenabfälle, obschon wenigstens ein starkes Drittel des großen
Feldele durch die beiden Kiesgruben und die Befestigungswerke zur Durch-
grabung kam. Es scheint darum, als ob die letzten Bewohner ihre Heimstätte
mit Hab und Gut verlassen hätten, daß sie ausgewandert sind. Nach der
Datierung der Keramik könnte der Auszug etwa zur Zeit Cäsars stattgefunden
haben. Wahrscheinlich schlossen sich die Breisgauer Rauriker im Jahre 58
v Chr. dem großen Helvetierzuge nach Gallien an. Dann wäre das Ende
unserer keltischen Siedelung mit dem Beginn der geschichtlichen Zeit genau
festgestellt. K. S. Gutmann.
Römische Bauten in Kumpfmühl-Regensburg.
Auf dem Grundstück der Buchdruckerei und Verlagsanstalt Habbel in
Kumpfmühl-Regensburg wurde 1909 vom Historischen Verein zu Regens-
burg ein großer rechteckiger, mehrere heizbare Räume umfassender römischer
Bau, dessen Nordwestecke seit langen Zeiten der Kumpfmühler Hohlweg
beseitigt hat, vollständig freigelegt. Auf dem gleichen Grundstück kamen
später bei Erdausschachtungen außer einem gemauerten römischen Brunnen-
schacht und Resten eines kleineren Gebäudes noch zwei Seiten eines ähnlich
großen Baues zum Vorschein, der erst im Herbst 1916 genau untersucht
werden konnte.
Dieser Rechteckbau (von fast 18 m Seitenlänge bei rund 10,50 m Breite)
liegt kaum 6—7 m östlich von dem 1909 aufgedeckten Wohnbau in nicht
in den letzten ioo Jahren Beweisstücke hierfür nicht mehr zum Vorschein
kamen.
Um so erfreulicher ist es, daß die La-Tenezeit mit zwei Fundplätzen
in die Erscheinung tritt, die nur 500 m voneinander entfernt liegen. Da
die Gräber bei A, PI. I, der frühen, die andere Fundstätte der späten La-Tene-
kultur angehört, wäre es möglich, daß zwischen beiden eine Mittel-Tene-
siedelung stand. Es müßte dann die. ganze Fläche zwischen dem Rheinufer
und dem Hohweg bis zum Feldweg Breisach-Gündlingen, ein Raum von etwa
23 Hektar, von den La-Teneleuten besetzt gewesen sein.
Für die Klärung der völkischen Besiedelungsfrage des Oberrheingebietes
ist Hochstetten ein Grundstein geworden. Schon der Umstand, daß sowohl
aus der Früh- als auch aus der Spät-Tenezeit nur Skelettgräber zum Vor-
schein kamen, ergibt die Tatsache, daß in den letzten Jahrhunderten
vor Christus hier nicht Germanen, sondern Kelten saßen. Zu
Hochstetten wurden die ersten bemalten Gefäßfragmente dieser Periode
gefunden. Mit vollem Rechte könnte man künftighin diese Keramik als
„Hochstetter Typus“ bezeichnen. Ähnliches Material lieferten dann 1901
die Ausgrabungen zu Tarodunum (Zarten bei Freiburg). Ganz dieselben
Gefäßform.en und Verzierungsmuster kamen in größerer Zahl in jüngster
Zeit in Basel, bei der neuen Gasfabrik zum Vorschein. Direktor Schumacher
in Mainz hat dieser Keramik seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In
seiner eingehenden Arbeit: „Gallische und germanische Stämme und Kul-
turen im Ober- und Mittelrheingebiet zur späten La-Tenezeit“, Prähist. Zeit-
schrift VI, Heft 3/4, 1914, S. 230 ff., führt er den Nachweis, daß die Siedler
von Hochstetten, Tarodunum und Basel Helvetier waren und wohl zum
Stamme der Rauriker gehörten. Somit muß das ganze rechte Rheinufer
von Basel bis zum Kaiserstuhl noch im letzten Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung im Besitze der Rauriker gewesen sein.
Die Ansiedelung von Hochstetten hat bis jetzt keine einzige Waffe,
kein Werkzeug, keinen Teil eines Haushaltungs- oder Ackergerätes geliefert,
sondern nur Küchenabfälle, obschon wenigstens ein starkes Drittel des großen
Feldele durch die beiden Kiesgruben und die Befestigungswerke zur Durch-
grabung kam. Es scheint darum, als ob die letzten Bewohner ihre Heimstätte
mit Hab und Gut verlassen hätten, daß sie ausgewandert sind. Nach der
Datierung der Keramik könnte der Auszug etwa zur Zeit Cäsars stattgefunden
haben. Wahrscheinlich schlossen sich die Breisgauer Rauriker im Jahre 58
v Chr. dem großen Helvetierzuge nach Gallien an. Dann wäre das Ende
unserer keltischen Siedelung mit dem Beginn der geschichtlichen Zeit genau
festgestellt. K. S. Gutmann.
Römische Bauten in Kumpfmühl-Regensburg.
Auf dem Grundstück der Buchdruckerei und Verlagsanstalt Habbel in
Kumpfmühl-Regensburg wurde 1909 vom Historischen Verein zu Regens-
burg ein großer rechteckiger, mehrere heizbare Räume umfassender römischer
Bau, dessen Nordwestecke seit langen Zeiten der Kumpfmühler Hohlweg
beseitigt hat, vollständig freigelegt. Auf dem gleichen Grundstück kamen
später bei Erdausschachtungen außer einem gemauerten römischen Brunnen-
schacht und Resten eines kleineren Gebäudes noch zwei Seiten eines ähnlich
großen Baues zum Vorschein, der erst im Herbst 1916 genau untersucht
werden konnte.
Dieser Rechteckbau (von fast 18 m Seitenlänge bei rund 10,50 m Breite)
liegt kaum 6—7 m östlich von dem 1909 aufgedeckten Wohnbau in nicht