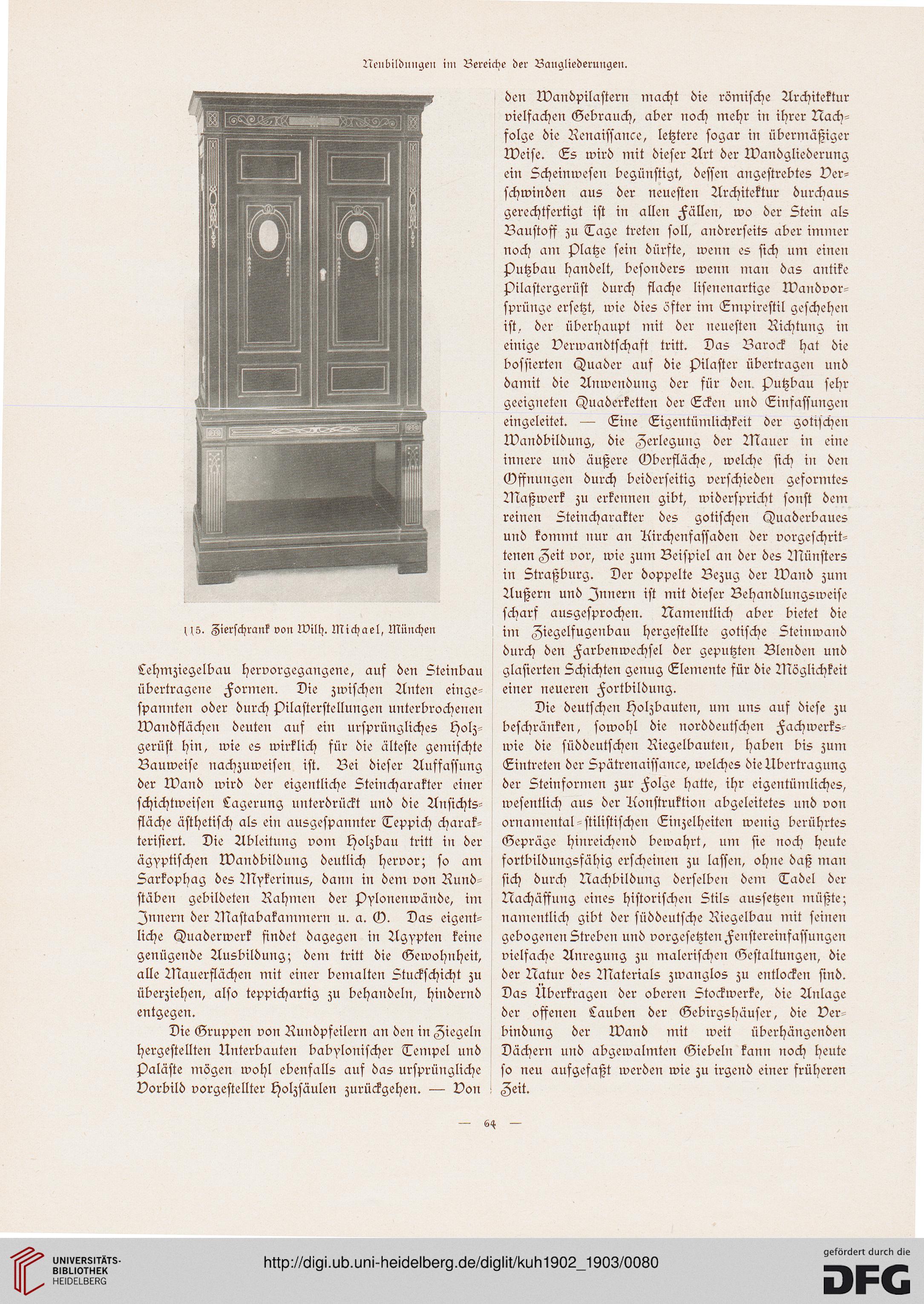Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.
Zierschrank von lVilh. Michael, München
Lehmziegelbau hervorgegangene, auf den Steinbau
übertragene Formen. Die zwischen Anten einge-
spannten oder durch Pilasterstellungen unterbrochenen
Wandflächen deuten auf ein ursprüngliches polz-
gerüst hin, wie es wirklich für die älteste gemischte
Bauweise nachzuweisen ist. Bei dieser Auffassung
der Wand wird der eigentliche Steincharakter einer
schichtweisen Lagerung unterdrückt und die Ansichts-
fläche ästhetisch als ein ausgespannter Teppich charak-
terisiert. Die Ableitung vom polzbau tritt in der
ägyptischen Wandbildung deutlich hervor; so am
Sarkophag des Mykerinus, dann in dem von Rund-
stäben gebildeten Rahmen der Pylonenwände, im
Innern der Mastabakammern u. a. (D. Das eigent-
liche ^uaderwerk findet dagegen in Ägypten keine
genügende Ausbildung; dem tritt die Gewohnheit,
alle Mauerflächen mit einer bemalten Stuckschicht zu
überziehen, also teppichartig zu behandeln, hindernd
entgegen.
Die Gruppen von Rundpfeilern an den in Ziegeln
hergestellten Unterbauten babylonischer Tempel und
Paläste mögen wohl ebenfalls auf das ursprüngliche
Borbild vorgestellter Holzfäulen zurückgehen. — Bon
den Wandpilastern macht die römische Architektur
vielfachen Gebrauch, aber noch mehr in ihrer Nach-
folge die Renaissance, letztere sogar in übermäßiger
Weise. Es wird mit dieser Art der Wandgliederung
ein Scheinwesen begünstigt, dessen angestrebtes Ver-
schwinden aus der neuesten Architektur durchaus
gerechtfertigt ist in allen Fällen, wo der Stein als
Baustoff zu Tage treten soll, andrerseits aber immer-
noch am Platze fein dürfte, wenn es sich um einen
putzbau handelt, besonders wenn man das antike
Pilastergerüst durch flache lisenenartige Wandvor-
sprünge ersetzt, wie dies öfter im Empirestil geschehen
ist, der überhaupt mit der neuesten Richtung in
einige Verwandtschaft tritt. Das Barock hat die
bossierten Quader auf die Pilaster übertragen und
damit die Anwendung der für den. putzbau sehr-
geeigneten (Huaderketten der Ecken und Einfassungen
eingeleitet. — Eine Eigentümlichkeit der gotischen
Wandbildung, die Zerlegung der Mauer in eine
innere und äußere Oberfläche, welche sich in den
Öffnungen durch beiderseitig verschieden geformtes
Maßwerk zu erkennen gibt, widerspricht sonst dem
reinen Steincharakter des gotischen Auaderbaues
und kommt nur an Kirchenfassaden der vorgeschrit-
tenen Zeit vor, wie zürn Beispiel an der des Münsters
in Straßburg. Der doppelte Bezug der Wand zum
Äußern und Znnern ist mit dieser Behandlungsweise
scharf ausgesprochen. Namentlich aber bietet die
im Ziegelfugenbau hergestellte gotische Steinwand
durch den Farbenwechsel der geputzten Blenden und
glasierten Schichten genug Elemente für die Möglichkeit
einer neueren Fortbildung.
Die deutschen Holzbauten, um uns auf diese zu
beschränken, sowohl die norddeutschen Fachwerks-
wie die süddeutschen Riegelbauten, haben bis zum
Eintreten der Spätrenaissance, welches die Übertragung
der Steinformen zur Folge hatte, ihr eigentümliches,
wesentlich aus der Konstruktion abgeleitetes und von
ornamental-stilistischen Einzelheiten wenig berührtes
Gepräge hinreichend bewahrt, um sie noch heute
fortbildungsfähig erscheinen zu lassen, ohne daß man
sich durch Nachbildung derselben dem Tadel der
Nachäffung eines historischen Stils aussetzen müßte;
namentlich gibt der süddeutsche Riegelbau mit seinen
gebogenen Streben und Vorgesetzten Fenstereinfassungen
vielfache Anregung zu malerischen Gestaltungen, die
der Natur des Materials zwanglos zu entlocken sind.
Das Überkragen der oberen Stockwerke, die Anlage
der offenen Lauben der Gebirgshäuser, die Ver-
bindung der Wand mit weit überhängenden
Dächern und abgewalmten Giebeln kann noch heute
so neu aufgesaßt werden wie zu irgend einer früheren
Zeit.
6^
Zierschrank von lVilh. Michael, München
Lehmziegelbau hervorgegangene, auf den Steinbau
übertragene Formen. Die zwischen Anten einge-
spannten oder durch Pilasterstellungen unterbrochenen
Wandflächen deuten auf ein ursprüngliches polz-
gerüst hin, wie es wirklich für die älteste gemischte
Bauweise nachzuweisen ist. Bei dieser Auffassung
der Wand wird der eigentliche Steincharakter einer
schichtweisen Lagerung unterdrückt und die Ansichts-
fläche ästhetisch als ein ausgespannter Teppich charak-
terisiert. Die Ableitung vom polzbau tritt in der
ägyptischen Wandbildung deutlich hervor; so am
Sarkophag des Mykerinus, dann in dem von Rund-
stäben gebildeten Rahmen der Pylonenwände, im
Innern der Mastabakammern u. a. (D. Das eigent-
liche ^uaderwerk findet dagegen in Ägypten keine
genügende Ausbildung; dem tritt die Gewohnheit,
alle Mauerflächen mit einer bemalten Stuckschicht zu
überziehen, also teppichartig zu behandeln, hindernd
entgegen.
Die Gruppen von Rundpfeilern an den in Ziegeln
hergestellten Unterbauten babylonischer Tempel und
Paläste mögen wohl ebenfalls auf das ursprüngliche
Borbild vorgestellter Holzfäulen zurückgehen. — Bon
den Wandpilastern macht die römische Architektur
vielfachen Gebrauch, aber noch mehr in ihrer Nach-
folge die Renaissance, letztere sogar in übermäßiger
Weise. Es wird mit dieser Art der Wandgliederung
ein Scheinwesen begünstigt, dessen angestrebtes Ver-
schwinden aus der neuesten Architektur durchaus
gerechtfertigt ist in allen Fällen, wo der Stein als
Baustoff zu Tage treten soll, andrerseits aber immer-
noch am Platze fein dürfte, wenn es sich um einen
putzbau handelt, besonders wenn man das antike
Pilastergerüst durch flache lisenenartige Wandvor-
sprünge ersetzt, wie dies öfter im Empirestil geschehen
ist, der überhaupt mit der neuesten Richtung in
einige Verwandtschaft tritt. Das Barock hat die
bossierten Quader auf die Pilaster übertragen und
damit die Anwendung der für den. putzbau sehr-
geeigneten (Huaderketten der Ecken und Einfassungen
eingeleitet. — Eine Eigentümlichkeit der gotischen
Wandbildung, die Zerlegung der Mauer in eine
innere und äußere Oberfläche, welche sich in den
Öffnungen durch beiderseitig verschieden geformtes
Maßwerk zu erkennen gibt, widerspricht sonst dem
reinen Steincharakter des gotischen Auaderbaues
und kommt nur an Kirchenfassaden der vorgeschrit-
tenen Zeit vor, wie zürn Beispiel an der des Münsters
in Straßburg. Der doppelte Bezug der Wand zum
Äußern und Znnern ist mit dieser Behandlungsweise
scharf ausgesprochen. Namentlich aber bietet die
im Ziegelfugenbau hergestellte gotische Steinwand
durch den Farbenwechsel der geputzten Blenden und
glasierten Schichten genug Elemente für die Möglichkeit
einer neueren Fortbildung.
Die deutschen Holzbauten, um uns auf diese zu
beschränken, sowohl die norddeutschen Fachwerks-
wie die süddeutschen Riegelbauten, haben bis zum
Eintreten der Spätrenaissance, welches die Übertragung
der Steinformen zur Folge hatte, ihr eigentümliches,
wesentlich aus der Konstruktion abgeleitetes und von
ornamental-stilistischen Einzelheiten wenig berührtes
Gepräge hinreichend bewahrt, um sie noch heute
fortbildungsfähig erscheinen zu lassen, ohne daß man
sich durch Nachbildung derselben dem Tadel der
Nachäffung eines historischen Stils aussetzen müßte;
namentlich gibt der süddeutsche Riegelbau mit seinen
gebogenen Streben und Vorgesetzten Fenstereinfassungen
vielfache Anregung zu malerischen Gestaltungen, die
der Natur des Materials zwanglos zu entlocken sind.
Das Überkragen der oberen Stockwerke, die Anlage
der offenen Lauben der Gebirgshäuser, die Ver-
bindung der Wand mit weit überhängenden
Dächern und abgewalmten Giebeln kann noch heute
so neu aufgesaßt werden wie zu irgend einer früheren
Zeit.
6^