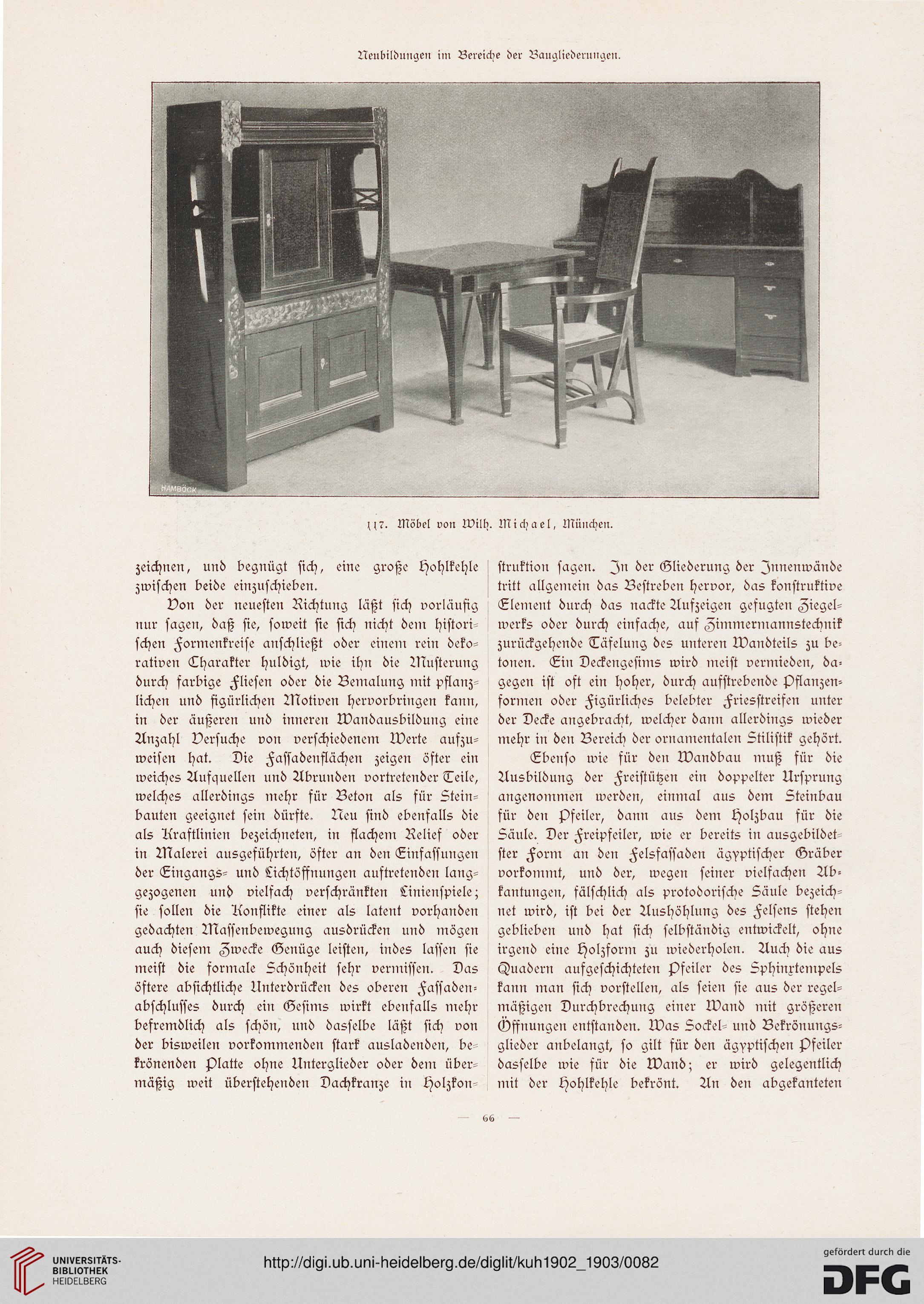Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.
\[7. Möbel von Wilh. Michael, München.
zeichnen, und begnügt sich, eine große Hohlkehle
zwischen beide einzuschieben.
Von der neuesten Richtung läßt sich vorläufig
nur sagen, daß sie, soweit sie sich nicht dein histori-
schen Formenkreise anschließt oder einen: rein deko-
rativen Charakter huldigt, wie ihn die Musterung
durch farbige Fliesen oder die Bemalung mit pflanz-
lichen und figürlichen Motiven Hervorbringen kann,
in der äußeren und inneren Wandausbildung eine
Anzahl Versuche von verschiedenem Werte aufzu-
weisen hat. Die Fassadenflächen zeigen öfter ein
weiches Aufquellen und Abrunden vortretender Teile,
welches allerdings mehr für Beton als für Stein-
bauten geeignet fein dürfte. Neu sind ebenfalls die
als Kraftlinien bezeichneten, in flachem Relief oder
in Malerei ausgeführten, öfter an den Einfassungen
der Eingangs- und Lichtöffnungen auftretenden lang-
gezogenen und vielfach verschränkten Linienspiele;
sie sollen die Konflikte einer als latent vorhanden
gedachten Massenbewegung ausdrücken und mögen
auch diesem Zwecke Genüge leisten, indes lassen sie
meist die formale Schönheit sehr vermissen. Das
öftere absichtliche Unterdrücken des oberen Faffaden-
abfchluffes durch ein Gesims wirkt ebenfalls mehr
befremdlich als schön, und dasselbe läßt sich von
der bisweilen vorkommenden stark ausladenden, be
krönenden Platte ohne Unterglieder oder dem über-
mäßig weit überstehenden Dachkranze in Holzkon-
struktion sagen. Zn der Gliederung der Znnenwände
tritt allgemein das Bestreben hervor, das konstruktive
Element durch das nackte Aufzeigen gefugten Ziegel-
werks oder durch einfache, auf Zimmermannstechnik
zurückgehende Täfelung des unteren Wandteils zu be-
tonen. Ein Deckengesims wird meist vermieden, da-
gegen ist oft ein hoher, durch aufstrebende pflanzen-
formen oder Figürliches belebter Friesstreifen unter
der Decke angebracht, welcher dann allerdings wieder
mehr in den Bereich der ornamentalen Stilistik gehört.
Ebenso wie für den Wandbau muß für die
Ausbildung der Freistützen ein doppelter Ursprung
angenommen werden, einmal aus dem Steinbau
für den Pfeiler, dann aus dem Holzbau für die
Säule. Der Freipfeiler, wie er bereits in ausgebildet-
ster Form an den Felsfaffaden ägyptischer Gräber
vorkommt, und der, wegen feiner vielfachen Ab-
kantungen, fälschlich als protodorifche Säule bezeich-
net wird, ist bei der Aushöhlung des Felsens stehen
geblieben und hat sich selbständig entwickelt, ohne
irgend eine Holzform zu wiederholen. Auch die aus
Quadern aufgeschichteten Pfeiler des Sphinxtempels
kann man sich vorstellen, als seien sie aus der regel-
mäßigen Durchbrechung einer Wand mit größeren
Öffnungen entstanden. Was Sockel- und Bekrönungs-
glieder anbelangt, so gilt für den ägyptischen Pfeiler
dasselbe wie für die Wand; er wird gelegentlich
mit der Hohlkehle bekrönt. An den abgekanteten
\[7. Möbel von Wilh. Michael, München.
zeichnen, und begnügt sich, eine große Hohlkehle
zwischen beide einzuschieben.
Von der neuesten Richtung läßt sich vorläufig
nur sagen, daß sie, soweit sie sich nicht dein histori-
schen Formenkreise anschließt oder einen: rein deko-
rativen Charakter huldigt, wie ihn die Musterung
durch farbige Fliesen oder die Bemalung mit pflanz-
lichen und figürlichen Motiven Hervorbringen kann,
in der äußeren und inneren Wandausbildung eine
Anzahl Versuche von verschiedenem Werte aufzu-
weisen hat. Die Fassadenflächen zeigen öfter ein
weiches Aufquellen und Abrunden vortretender Teile,
welches allerdings mehr für Beton als für Stein-
bauten geeignet fein dürfte. Neu sind ebenfalls die
als Kraftlinien bezeichneten, in flachem Relief oder
in Malerei ausgeführten, öfter an den Einfassungen
der Eingangs- und Lichtöffnungen auftretenden lang-
gezogenen und vielfach verschränkten Linienspiele;
sie sollen die Konflikte einer als latent vorhanden
gedachten Massenbewegung ausdrücken und mögen
auch diesem Zwecke Genüge leisten, indes lassen sie
meist die formale Schönheit sehr vermissen. Das
öftere absichtliche Unterdrücken des oberen Faffaden-
abfchluffes durch ein Gesims wirkt ebenfalls mehr
befremdlich als schön, und dasselbe läßt sich von
der bisweilen vorkommenden stark ausladenden, be
krönenden Platte ohne Unterglieder oder dem über-
mäßig weit überstehenden Dachkranze in Holzkon-
struktion sagen. Zn der Gliederung der Znnenwände
tritt allgemein das Bestreben hervor, das konstruktive
Element durch das nackte Aufzeigen gefugten Ziegel-
werks oder durch einfache, auf Zimmermannstechnik
zurückgehende Täfelung des unteren Wandteils zu be-
tonen. Ein Deckengesims wird meist vermieden, da-
gegen ist oft ein hoher, durch aufstrebende pflanzen-
formen oder Figürliches belebter Friesstreifen unter
der Decke angebracht, welcher dann allerdings wieder
mehr in den Bereich der ornamentalen Stilistik gehört.
Ebenso wie für den Wandbau muß für die
Ausbildung der Freistützen ein doppelter Ursprung
angenommen werden, einmal aus dem Steinbau
für den Pfeiler, dann aus dem Holzbau für die
Säule. Der Freipfeiler, wie er bereits in ausgebildet-
ster Form an den Felsfaffaden ägyptischer Gräber
vorkommt, und der, wegen feiner vielfachen Ab-
kantungen, fälschlich als protodorifche Säule bezeich-
net wird, ist bei der Aushöhlung des Felsens stehen
geblieben und hat sich selbständig entwickelt, ohne
irgend eine Holzform zu wiederholen. Auch die aus
Quadern aufgeschichteten Pfeiler des Sphinxtempels
kann man sich vorstellen, als seien sie aus der regel-
mäßigen Durchbrechung einer Wand mit größeren
Öffnungen entstanden. Was Sockel- und Bekrönungs-
glieder anbelangt, so gilt für den ägyptischen Pfeiler
dasselbe wie für die Wand; er wird gelegentlich
mit der Hohlkehle bekrönt. An den abgekanteten