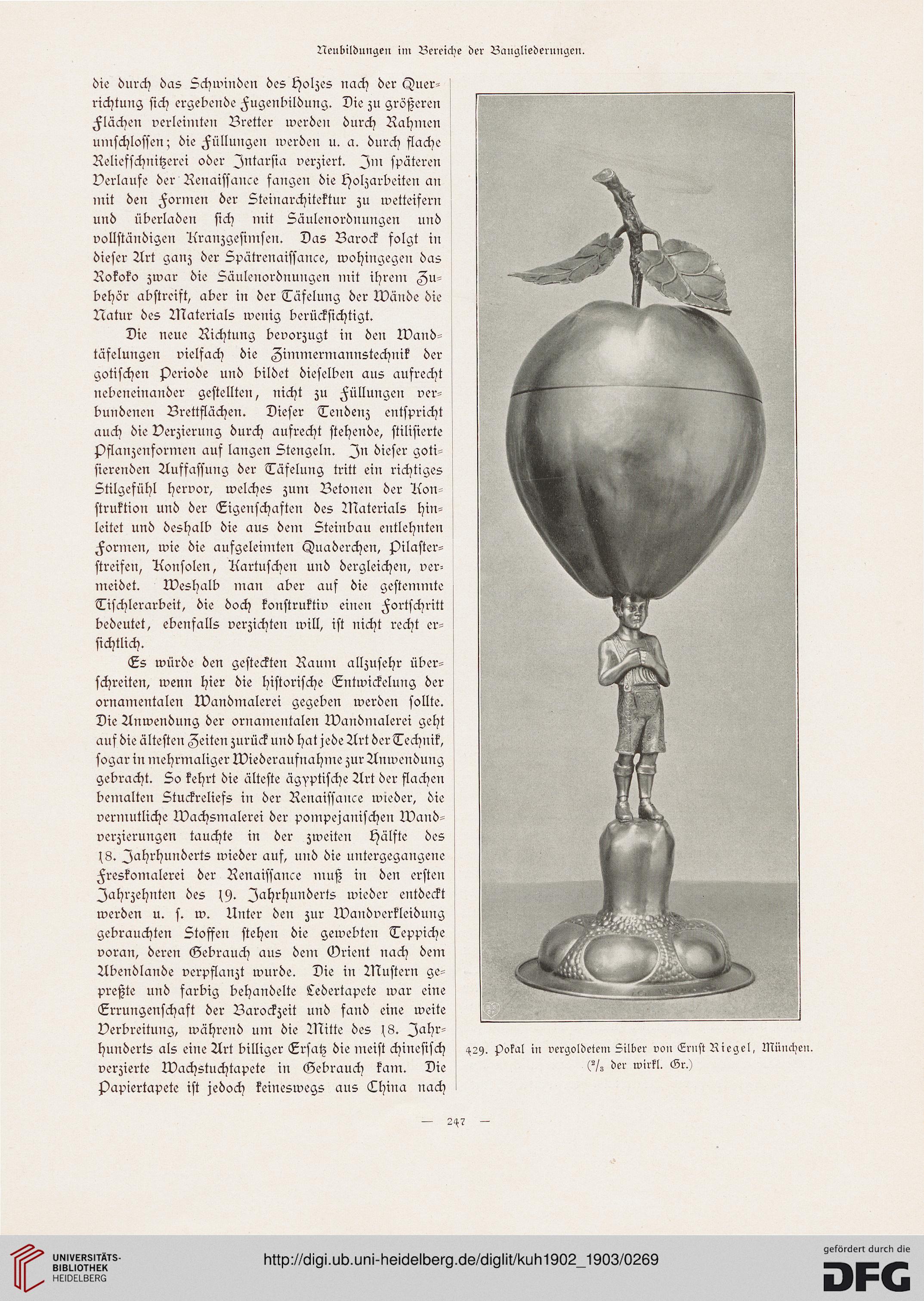Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.
die durch das Schwinden des Holzes nach der ^uer-
Achtung sich ergebende Fugenbildung. Die zu größeren
Flächen verleimten Bretter werden durch Rahmen
umschlossen; die Füllungen werden u. a. durchstäche
Reliefschnitzerei oder Intarsia verziert. Im späteren
Verlaufe der Renaissance fangen die polzarbeiten an
mit den Formen der Steinarchitektur zu wetteifern
und überladen sich mit Säulenorduungen und
vollständigen Aranzgesimsen. Das Barock folgt in
dieser Art ganz der Spätrenaissance, wohingegen das
Rokoko zwar die Säulenordnuugen mit ihrem Zu-
behör ab streift, aber in der Täfelung der Wände die
Natur des Materials wenig berücksichtigt.
Die neue Richtung bevorzugt in den Wand-
täfelungen vielfach die Zimmermaimstechnik der
gotischen Periode und bildet dieselben aus aufrecht
nebeneinander gestellten, nicht zu Füllungen ver-
bundenen Brettflächen. Dieser Tendenz entspricht
auch die Verzierung durch aufrecht stehende, stilisierte
Pflanzenformen auf langen Stengeln. In dieser goti-
sierenden Auffassung der Täfelung tritt ein richtiges
Stilgefühl hervor, welches zuni Betonen der Aon-
struktion und der Eigenschaften des Materials hin-
leitet und deshalb die aus dem Steinbau entlehnten
Formen, wie die aufgeleimten Auaderchen, Pilaster-
streifen, Aonsolen, Aartuschen und dergleichen, ver-
meidet. Weshalb inan aber auf die gestemmte
Tischlerarbeit, die doch konstruktiv einen Fortschritt |
bedeutet, ebenfalls verzichten will, ist nicht recht er-
sichtlich.
Ts würde den gesteckten Raum allzusehr über-
schreiten, wenn hier die historische Entwickelung der
ornamentalen Wandmalerei gegeben werden sollte.
Die Anwendung der ornamentalen Wandmalerei geht
aus die ältesten Zeiten zurück und hat jede Art der Techuik,
sogar in mehrmaliger Wiederaufnahme zur Anwendung
gebracht. So kehrt die älteste ägyptische Art der flachen
bemalten Stuckreliefs in der Renaissance wieder, die }
vermutliche Wachsmalerei der poinpejanischen Waud-
verzierungen tauchte in der zweiten Hälfte des
f8. Jahrhunderts wieder auf, und die untergegangene
Freskomalerei der Renaissance muß in den ersten |
Jahrzehnten des ff). Jahrhunderts wieder entdeckt I
werden u. f. w. Unter den zur Wandverkleidung !
gebrauchten Stoffen stehen die gewebten Teppiche
voran, deren Gebrauch aus dem Grient nach dem |
Abendlande verpflanzt wurde. Die in Mustern ge-
preßte und farbig behandelte Ledertapete war eine
Errungenschaft der Barockzeit und fand eine weite (
Verbreitung, während um die Mitte des f8. Jahr- |
Hunderts als eine Art billiger Ersatz die meist chinesisch
verzierte Wachstuchtapete in Gebrauch kam. Die
Papiertapete ist jedoch keineswegs aus China nach
429. Pokal in vergoldetem Silber von Ernst Riegel, München
(2/s der wirkl. Gr.)
2^7
die durch das Schwinden des Holzes nach der ^uer-
Achtung sich ergebende Fugenbildung. Die zu größeren
Flächen verleimten Bretter werden durch Rahmen
umschlossen; die Füllungen werden u. a. durchstäche
Reliefschnitzerei oder Intarsia verziert. Im späteren
Verlaufe der Renaissance fangen die polzarbeiten an
mit den Formen der Steinarchitektur zu wetteifern
und überladen sich mit Säulenorduungen und
vollständigen Aranzgesimsen. Das Barock folgt in
dieser Art ganz der Spätrenaissance, wohingegen das
Rokoko zwar die Säulenordnuugen mit ihrem Zu-
behör ab streift, aber in der Täfelung der Wände die
Natur des Materials wenig berücksichtigt.
Die neue Richtung bevorzugt in den Wand-
täfelungen vielfach die Zimmermaimstechnik der
gotischen Periode und bildet dieselben aus aufrecht
nebeneinander gestellten, nicht zu Füllungen ver-
bundenen Brettflächen. Dieser Tendenz entspricht
auch die Verzierung durch aufrecht stehende, stilisierte
Pflanzenformen auf langen Stengeln. In dieser goti-
sierenden Auffassung der Täfelung tritt ein richtiges
Stilgefühl hervor, welches zuni Betonen der Aon-
struktion und der Eigenschaften des Materials hin-
leitet und deshalb die aus dem Steinbau entlehnten
Formen, wie die aufgeleimten Auaderchen, Pilaster-
streifen, Aonsolen, Aartuschen und dergleichen, ver-
meidet. Weshalb inan aber auf die gestemmte
Tischlerarbeit, die doch konstruktiv einen Fortschritt |
bedeutet, ebenfalls verzichten will, ist nicht recht er-
sichtlich.
Ts würde den gesteckten Raum allzusehr über-
schreiten, wenn hier die historische Entwickelung der
ornamentalen Wandmalerei gegeben werden sollte.
Die Anwendung der ornamentalen Wandmalerei geht
aus die ältesten Zeiten zurück und hat jede Art der Techuik,
sogar in mehrmaliger Wiederaufnahme zur Anwendung
gebracht. So kehrt die älteste ägyptische Art der flachen
bemalten Stuckreliefs in der Renaissance wieder, die }
vermutliche Wachsmalerei der poinpejanischen Waud-
verzierungen tauchte in der zweiten Hälfte des
f8. Jahrhunderts wieder auf, und die untergegangene
Freskomalerei der Renaissance muß in den ersten |
Jahrzehnten des ff). Jahrhunderts wieder entdeckt I
werden u. f. w. Unter den zur Wandverkleidung !
gebrauchten Stoffen stehen die gewebten Teppiche
voran, deren Gebrauch aus dem Grient nach dem |
Abendlande verpflanzt wurde. Die in Mustern ge-
preßte und farbig behandelte Ledertapete war eine
Errungenschaft der Barockzeit und fand eine weite (
Verbreitung, während um die Mitte des f8. Jahr- |
Hunderts als eine Art billiger Ersatz die meist chinesisch
verzierte Wachstuchtapete in Gebrauch kam. Die
Papiertapete ist jedoch keineswegs aus China nach
429. Pokal in vergoldetem Silber von Ernst Riegel, München
(2/s der wirkl. Gr.)
2^7