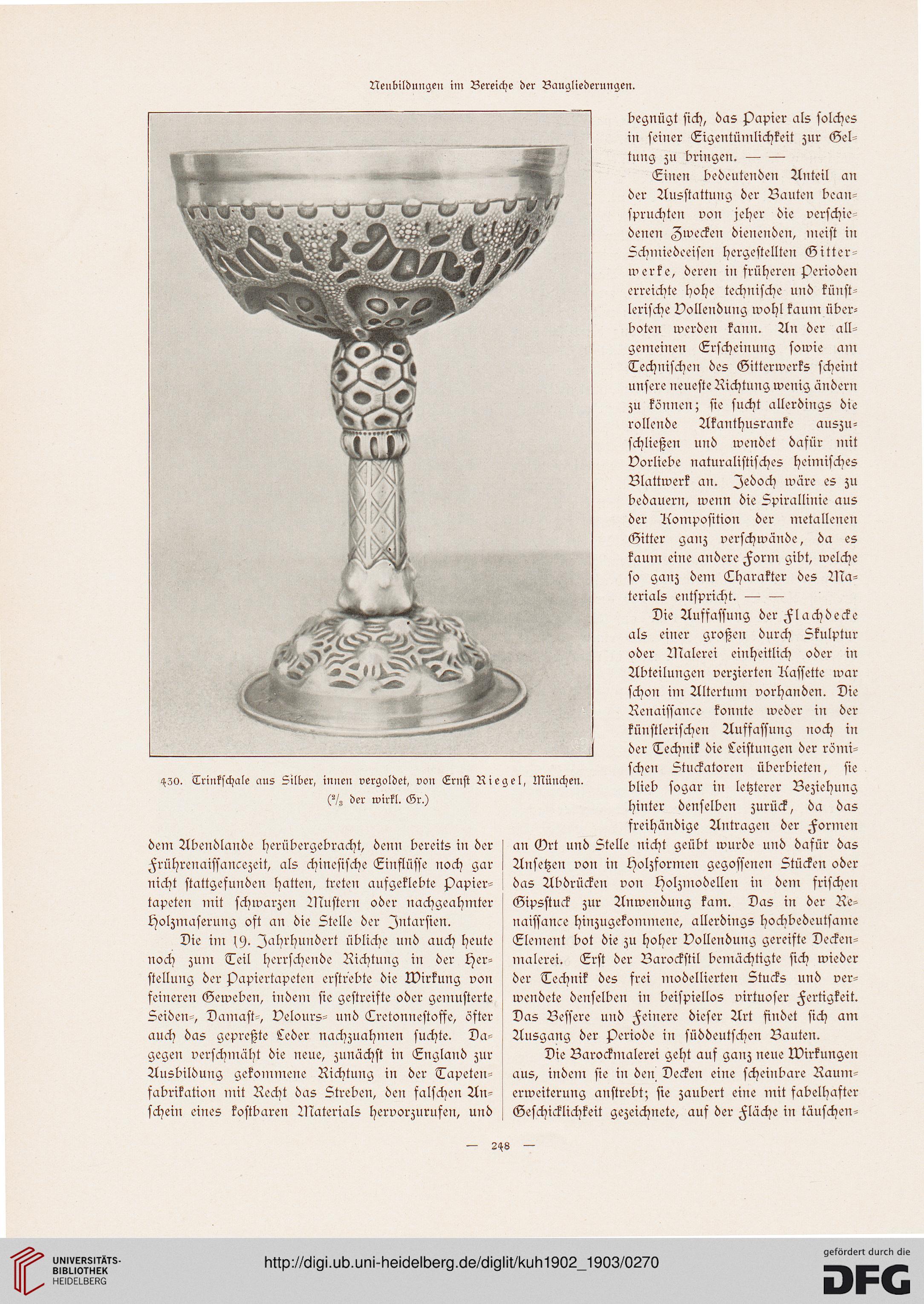Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.
^30. Trinkschale aus Silber, innen vergoldet, von Ernst Rie
(Vs der wirkl. Gr.)
dem Abendlande herübergebracht, denn bereits in der
Frührenaissancezeit, als chinesische Einflüsse noch gar
nicht stattgefunden hatten, treten ausgeklebte Papier-
tapeten mit schwarzen Mustern oder nachgeahmter
Holzmaserung oft an die Stelle der Intarsien.
Die im (9- Jahrhundert übliche und auch heute
noch zum Teil herrschende Richtung in der Her-
stellung der Papiertapeten erstrebte die Wirkung von
feineren Geweben, indem sie gestreifte oder gemusterte
Seiden-, Damast-, Velours- und Tretonneftoffe, öfter
auch das gepreßte Leder nachzuahmen suchte. Da-
gegen verschmäht die neue, zunächst in England zur
Ausbildung gekommene Richtung in der Tapeten-
fabrikation mit Recht das Streben, den falschen An-
schein eines kostbaren Materials hervorzurufen, und
begnügt sich, das Papier als solches
in seiner Eigentümlichkeit zur Gel-
tung zu bringen.-
Einen bedeutenden Anteil an
der Ausstattung der Bauten bean-
spruchten von jeher die verschie-
denen Zwecken dienenden, meist in
Schmiedeeisen hergestellten Gitter-
werke, deren in früheren Perioden
erreichte hohe technische und künst-
lerische Vollendung wohl kaum über-
boten werden kann. An der all-
gemeinen Erscheinung sowie am
Technischen des Gitterwerks scheint
unsere neueste Richtung wenig ändern
zu können; sie sucht allerdings die
rollende Akanthusranke auszu-
schließen und wendet dafür mit
Vorliebe naturalistisches heimisches
Blattwerk an. Jedoch wäre es zu
bedauern, wenn die Spirallinie aus
der Romposition der metallenen
Gitter ganz verschwände, da es
kaum eine andere Form gibt, welche
so ganz dem Charakter des Ma-
terials entspricht. — —
Die Auffassung der Flachdecke
als einer großen durch Skulptur
oder Malerei einheitlich oder in
Abteilungen verzierten Rasselte war
schon im Altertum vorhanden. Die
Renaissance konnte weder in der
künstlerischen Auffassung noch in
der Technik die Leistungen der römi-
schen Stuckatoren überbieten, sie
gel, München. blieb sogar in letzterer Beziehung
hinter denselben zurück, da das
freihändige Anträgen der Formen
an Grt und Stelle nicht geübt wurde und dafür das
Ansetzen von in Holzformen gegossenen Stücken oder
das Abdrücken von Holzmodellen in dem frischen
Gipsstuck zur Anwendung kam. Das in der Re-
naissance hinzugekommene, allerdings hochbedeutsame
Element bot die zu hoher Vollendung gereifte Decken-
malerei. Erst der Barockstil bemächtigte sich wieder
der Technik des frei modellierten Stucks und ver-
wendete denselben in beispiellos virtuoser Fertigkeit.
Das Bessere und Feinere dieser Art findet sich am
Ausgang der Periode in süddeutschen Bauten.
Die Barockmalerei geht auf ganz neue Wirkungen
aus, indenr sie in den Decken eine scheinbare Raum-
erweiterung anstrebt; sie zaubert eine mit fabelhafter
Geschicklichkeit gezeichnete, auf der Fläche in täuschen-
^30. Trinkschale aus Silber, innen vergoldet, von Ernst Rie
(Vs der wirkl. Gr.)
dem Abendlande herübergebracht, denn bereits in der
Frührenaissancezeit, als chinesische Einflüsse noch gar
nicht stattgefunden hatten, treten ausgeklebte Papier-
tapeten mit schwarzen Mustern oder nachgeahmter
Holzmaserung oft an die Stelle der Intarsien.
Die im (9- Jahrhundert übliche und auch heute
noch zum Teil herrschende Richtung in der Her-
stellung der Papiertapeten erstrebte die Wirkung von
feineren Geweben, indem sie gestreifte oder gemusterte
Seiden-, Damast-, Velours- und Tretonneftoffe, öfter
auch das gepreßte Leder nachzuahmen suchte. Da-
gegen verschmäht die neue, zunächst in England zur
Ausbildung gekommene Richtung in der Tapeten-
fabrikation mit Recht das Streben, den falschen An-
schein eines kostbaren Materials hervorzurufen, und
begnügt sich, das Papier als solches
in seiner Eigentümlichkeit zur Gel-
tung zu bringen.-
Einen bedeutenden Anteil an
der Ausstattung der Bauten bean-
spruchten von jeher die verschie-
denen Zwecken dienenden, meist in
Schmiedeeisen hergestellten Gitter-
werke, deren in früheren Perioden
erreichte hohe technische und künst-
lerische Vollendung wohl kaum über-
boten werden kann. An der all-
gemeinen Erscheinung sowie am
Technischen des Gitterwerks scheint
unsere neueste Richtung wenig ändern
zu können; sie sucht allerdings die
rollende Akanthusranke auszu-
schließen und wendet dafür mit
Vorliebe naturalistisches heimisches
Blattwerk an. Jedoch wäre es zu
bedauern, wenn die Spirallinie aus
der Romposition der metallenen
Gitter ganz verschwände, da es
kaum eine andere Form gibt, welche
so ganz dem Charakter des Ma-
terials entspricht. — —
Die Auffassung der Flachdecke
als einer großen durch Skulptur
oder Malerei einheitlich oder in
Abteilungen verzierten Rasselte war
schon im Altertum vorhanden. Die
Renaissance konnte weder in der
künstlerischen Auffassung noch in
der Technik die Leistungen der römi-
schen Stuckatoren überbieten, sie
gel, München. blieb sogar in letzterer Beziehung
hinter denselben zurück, da das
freihändige Anträgen der Formen
an Grt und Stelle nicht geübt wurde und dafür das
Ansetzen von in Holzformen gegossenen Stücken oder
das Abdrücken von Holzmodellen in dem frischen
Gipsstuck zur Anwendung kam. Das in der Re-
naissance hinzugekommene, allerdings hochbedeutsame
Element bot die zu hoher Vollendung gereifte Decken-
malerei. Erst der Barockstil bemächtigte sich wieder
der Technik des frei modellierten Stucks und ver-
wendete denselben in beispiellos virtuoser Fertigkeit.
Das Bessere und Feinere dieser Art findet sich am
Ausgang der Periode in süddeutschen Bauten.
Die Barockmalerei geht auf ganz neue Wirkungen
aus, indenr sie in den Decken eine scheinbare Raum-
erweiterung anstrebt; sie zaubert eine mit fabelhafter
Geschicklichkeit gezeichnete, auf der Fläche in täuschen-