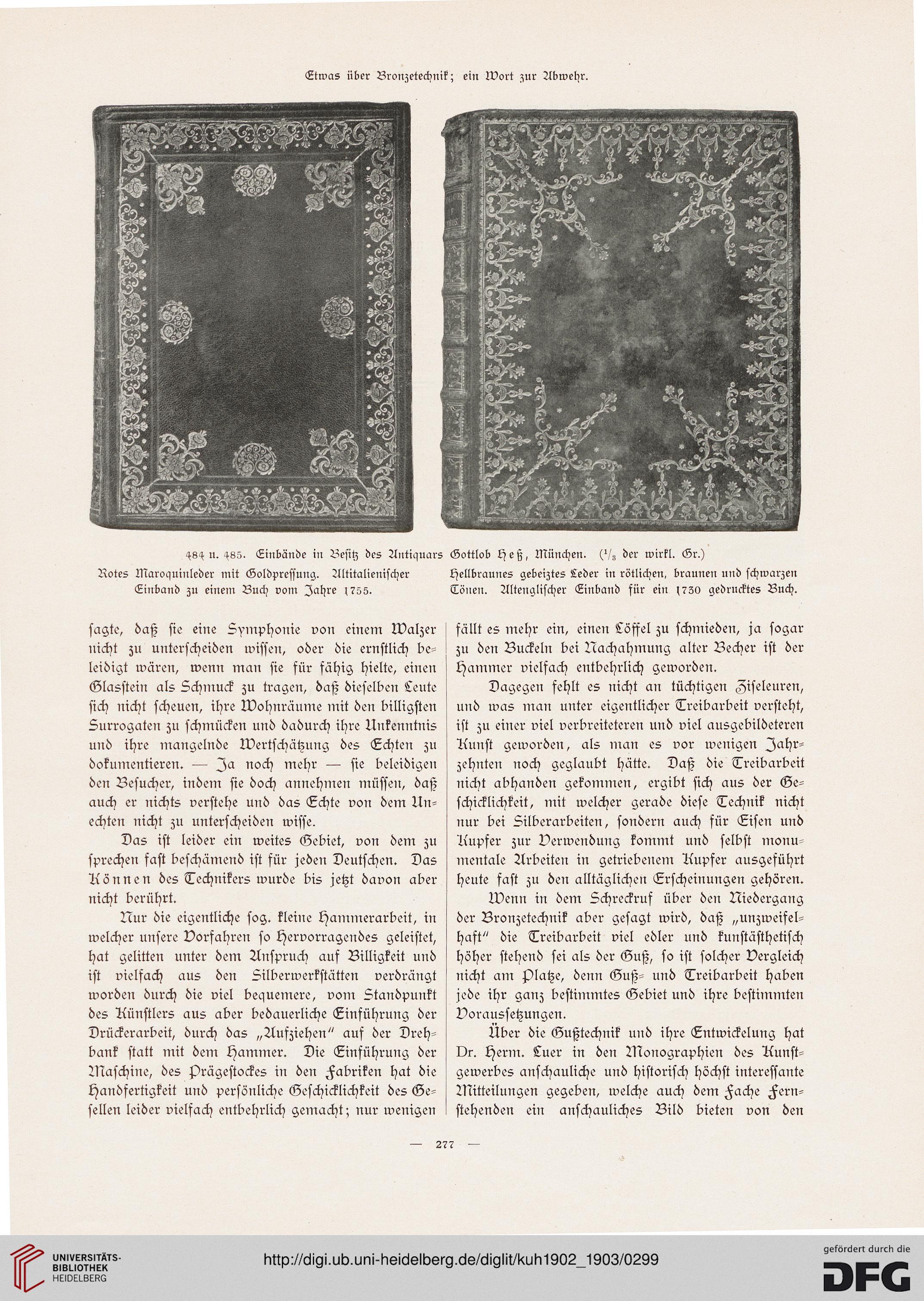Etwas über Bronzetechnik; ein Wort zur Abwehr.
484 u. ^85. Einbände in Besitz des Antiquars Gottlob e g, München. (V8 der wirkt. Gr.)
Rotes Maroquinleder mit Goldpressung. Altitalienischer Hellbraunes gebeiztes Leder in rötlichen, braunen und schwarzen
Einband zu einem Buch vom Jahre 1755. Tönen. Altenglischer Einband sür ein 1730 gedrucktes Buch.
sagte, daß sie eine Symphonie von einem Walzer
nicht zu unterscheiden wissen, oder die ernstlich be-
leidigt wären, wenn man sie für fähig hielte, einen
Glasstein als Schmuck zu tragen, daß dieselben Leute
sich nicht scheuen, ihre Wohnräume mit den billigsten
Surrogaten zu schmücken und dadurch ihre Unkenntnis
und ihre mangelnde Wertschätzung des Echten zu
dokumentieren. — Ja noch mehr — sie beleidigen
den Besucher, indem sie doch annehmen müssen, daß
auch er nichts verstehe und das Echte von dem Un-
echten nicht zu unterscheiden wisse.
Das ist leider ein weites Gebiet, voit dem zu
sprechen fast beschämend ist für jeden Deutschen. Das
Aon neu des Technikers wurde bis jetzt davon aber
nicht berührt.
Nur die eigentliche sog. kleine hammerarbeit, in
welcher unsere Vorfahren so hervorragendes geleistet,
hat gelitten unter dem Anspruch auf Billigkeit und
ist vielfach aus den Silberwerkstätten verdrängt
worden durch die viel bequemere, vom Standpunkt
des Künstlers aus aber bedauerliche Einführung der
Drückerarbeit, durch das „Ausziehen" auf der Dreh-
bank statt mit dem Hammer. Die Einführung der
Maschine, des Prägestockes in den Fabriken hat die
Handfertigkeit und persönliche Geschicklichkeit des Ge-
sellen leider vielfach entbehrlich gemacht; nur wenigen
fällt es mehr ein, einen Löffel zu schmieden, ja sogar
zu den Buckeln bei Nachahmung alter Becher ist der
Hammer vielfach entbehrlich geworden.
Dagegen fehlt es nicht an tüchtigen Ziseleuren,
und was man unter eigentlicher Treibarbeit versteht,
ist zu einer viel verbreiteteren und viel ausgebildeteren
Kunst geworden, als man es vor wenigen Jahr-
zehnten noch geglaubt hätte. Daß die Treibarbeit
nicht abhanden gekommen, ergibt sich aus der Ge-
schicklichkeit, mit welcher gerade diese Technik nicht
nur bei Silberarbeiten, sondern auch für Eisen und
Kupfer zur Verwendung kommt und selbst monu-
mentale Arbeiten in getriebenem Kupfer ausgeführt
heute fast zu den alltäglichen Erscheinungen gehören.
Wenn in dem Schreckruf über den Niedergang
der Bronzetechnik aber gesagt wird, daß „unzweifel-
haft" die Treibarbeit viel edler und kunstästhetisch
höher stehend sei als der Guß, so ist solcher Vergleich
nicht am Platze, denn Guß- und Treibarbeit haben
jede ihr ganz bestimmtes Gebiet und ihre bestimmten
Voraussetzungen.
Über die Gußtechnik und ihre Entwickelung hat
Vr. herm. Luer in den Monographien des Kunst-
gewerbes anschauliche und historisch höchst interessante
Mitteilungen gegeben, welche auch dem Fache Fern-
stehenden ein anschauliches Bild bieten von den
277
484 u. ^85. Einbände in Besitz des Antiquars Gottlob e g, München. (V8 der wirkt. Gr.)
Rotes Maroquinleder mit Goldpressung. Altitalienischer Hellbraunes gebeiztes Leder in rötlichen, braunen und schwarzen
Einband zu einem Buch vom Jahre 1755. Tönen. Altenglischer Einband sür ein 1730 gedrucktes Buch.
sagte, daß sie eine Symphonie von einem Walzer
nicht zu unterscheiden wissen, oder die ernstlich be-
leidigt wären, wenn man sie für fähig hielte, einen
Glasstein als Schmuck zu tragen, daß dieselben Leute
sich nicht scheuen, ihre Wohnräume mit den billigsten
Surrogaten zu schmücken und dadurch ihre Unkenntnis
und ihre mangelnde Wertschätzung des Echten zu
dokumentieren. — Ja noch mehr — sie beleidigen
den Besucher, indem sie doch annehmen müssen, daß
auch er nichts verstehe und das Echte von dem Un-
echten nicht zu unterscheiden wisse.
Das ist leider ein weites Gebiet, voit dem zu
sprechen fast beschämend ist für jeden Deutschen. Das
Aon neu des Technikers wurde bis jetzt davon aber
nicht berührt.
Nur die eigentliche sog. kleine hammerarbeit, in
welcher unsere Vorfahren so hervorragendes geleistet,
hat gelitten unter dem Anspruch auf Billigkeit und
ist vielfach aus den Silberwerkstätten verdrängt
worden durch die viel bequemere, vom Standpunkt
des Künstlers aus aber bedauerliche Einführung der
Drückerarbeit, durch das „Ausziehen" auf der Dreh-
bank statt mit dem Hammer. Die Einführung der
Maschine, des Prägestockes in den Fabriken hat die
Handfertigkeit und persönliche Geschicklichkeit des Ge-
sellen leider vielfach entbehrlich gemacht; nur wenigen
fällt es mehr ein, einen Löffel zu schmieden, ja sogar
zu den Buckeln bei Nachahmung alter Becher ist der
Hammer vielfach entbehrlich geworden.
Dagegen fehlt es nicht an tüchtigen Ziseleuren,
und was man unter eigentlicher Treibarbeit versteht,
ist zu einer viel verbreiteteren und viel ausgebildeteren
Kunst geworden, als man es vor wenigen Jahr-
zehnten noch geglaubt hätte. Daß die Treibarbeit
nicht abhanden gekommen, ergibt sich aus der Ge-
schicklichkeit, mit welcher gerade diese Technik nicht
nur bei Silberarbeiten, sondern auch für Eisen und
Kupfer zur Verwendung kommt und selbst monu-
mentale Arbeiten in getriebenem Kupfer ausgeführt
heute fast zu den alltäglichen Erscheinungen gehören.
Wenn in dem Schreckruf über den Niedergang
der Bronzetechnik aber gesagt wird, daß „unzweifel-
haft" die Treibarbeit viel edler und kunstästhetisch
höher stehend sei als der Guß, so ist solcher Vergleich
nicht am Platze, denn Guß- und Treibarbeit haben
jede ihr ganz bestimmtes Gebiet und ihre bestimmten
Voraussetzungen.
Über die Gußtechnik und ihre Entwickelung hat
Vr. herm. Luer in den Monographien des Kunst-
gewerbes anschauliche und historisch höchst interessante
Mitteilungen gegeben, welche auch dem Fache Fern-
stehenden ein anschauliches Bild bieten von den
277