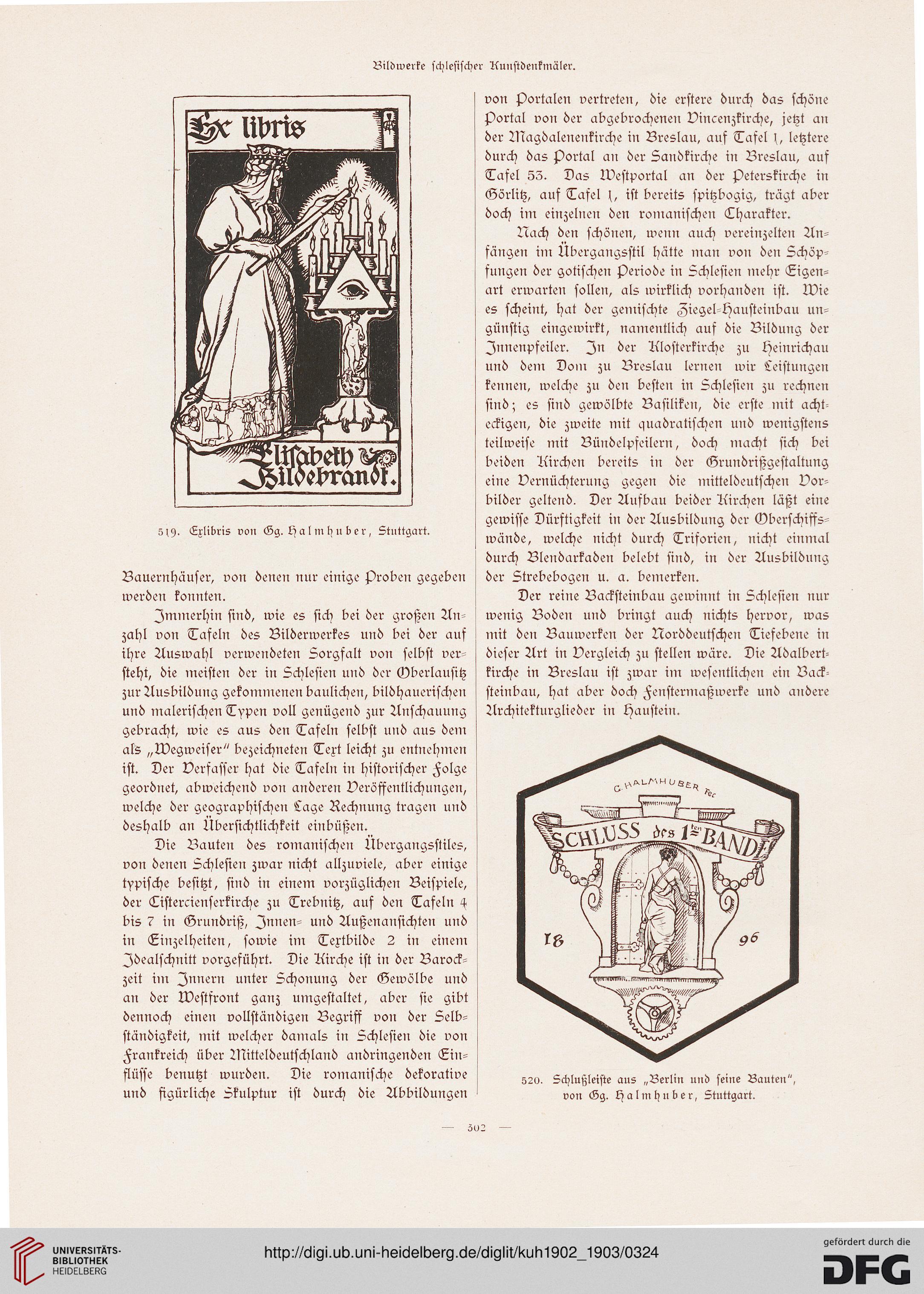Bildwerke schlesischer Kunstdenkmäler.
5(9. Exlibris von Gg. ljalmhuber, Stuttgart.
Bauernhäuser, von denen nur einige Proben gegeben
werden konnten.
Immerhin sind, wie es sich bei der großen An-
zahl von Tafeln des Bilderwerkes und bei der aus I
ihre Auswahl verwendeten Sorgfalt von selbst ver-
steht, die meisten der in Schlesien und der Oberlausitz
zur Ausbildung gekomnienen baulichen, bildhauerischen
und malerischen Typen voll genügend zur Anschauung
gebracht, wie es aus den Tafeln selbst und aus dem
aks „Wegweiser" bezeichneten Text leicht zu entnehmen
ist. Der Verfasser hat die Tafeln in historischer Folge j
geordnet, abweichend von anderen Veröffentlichungen,
welche der geographischen Lage Rechnung tragen und
deshalb an Übersichtlichkeit einbüßen.
Die Bauten des romanischen Übergangsstiles,
von denen Schlesien zwar nicht allzuviele, aber einige
typische besitzt, sind in einem vorzüglichen Beispiele,
der Tistercienserkirche zu Trebnitz, auf den Tafeln fl
bis 7 in Grundriß, Innen- und Außenansichten und J
in Einzelheiten, sowie im Textbilde 2 in einem |
Idealschnitt vorgeführt. Die Kirche ist in der Barock-
zeit im Innern unter Schonung der Gewölbe und
an der Westfront ganz umgestaltet, aber sie gibt
dennoch einen vollständigen Begriff von der Selb- |
ständigkeit, mit welcher damals in Schlesien die von
Frankreich über Mitteldeutschland andringenden Ein-
flüsse benutzt wurden. Die romanische dekorative
und figürliche Skulptur ist durch die Abbildungen ^
von Portalen vertreten, die erstere durch das schöne
Portal von der abgebrochenen Vincenzkirche, jetzt an
der Magdalenenkirche in Breslau, auf Tafel l, letztere
durch das Portal an der Sandkirche in Breslau, auf
Tafel 53. Das Westportal an der Peterskirche in
Görlitz, auf Tafel f, ist bereits fpitzbogig, trägt aber
doch inr einzelnen den romanischen Tharakter.
Nach den schönen, wenn auch vereinzelten An-
fängen im Übergangsstil hätte man von den Schöp-
fungen der gotischen Periode in Schlesien mehr Eigen-
art erwarten sollen, als wirklich vorhanden ist. Wie
es scheint, hat der gemischte Ziegel-Pausteinbau un-
günstig eingewirkt, namentlich auf die Bildung der
Innenpfeiler. In der Klosterkirche zu peinrichau
und dem Dom zu Breslau lernen wir Leistungen
kennen, welche zu den besten in Schlesien zu rechnen
sind; es sind gewölbte Basiliken, die erste mit acht-
eckigen, die zweite mit quadratischen und wenigstens
teilweise mit Bündelpfeilern, doch macht sich bei
beiden Kirchen bereits in der Grundrißgestaltung
eine Vernüchterung gegen die mitteldeutschen Vor-
bilder geltend. Der Aufbau beider Kirchen läßt eine
gewisse Dürftigkeit in der Ausbildung der Oberschiffs-
wände, welche nicht durch Triforien, nicht einmal
durch Blendarkaden belebt sind, in der Ausbildung
der Strebebogen u. a. bemerken.
Der reine Backsteinbau gewinnt in Schlesien nur
wenig Boden und bringt auch nichts hervor, was
mit den Bauwerken der Norddeutschen Tiefebene in
dieser Art in Vergleich zu stellen wäre. Die Adalbert-
kirche in Breslau ist zwar im wesentlichen ein Back-
steinbau, hat aber doch Fenstermaßwerke und andere
Architekturglieder in paustein.
520. Schlußleiste aus „Berlin und seine Bauten",
von Gg. kjalmhuber, Stuttgart.
502
5(9. Exlibris von Gg. ljalmhuber, Stuttgart.
Bauernhäuser, von denen nur einige Proben gegeben
werden konnten.
Immerhin sind, wie es sich bei der großen An-
zahl von Tafeln des Bilderwerkes und bei der aus I
ihre Auswahl verwendeten Sorgfalt von selbst ver-
steht, die meisten der in Schlesien und der Oberlausitz
zur Ausbildung gekomnienen baulichen, bildhauerischen
und malerischen Typen voll genügend zur Anschauung
gebracht, wie es aus den Tafeln selbst und aus dem
aks „Wegweiser" bezeichneten Text leicht zu entnehmen
ist. Der Verfasser hat die Tafeln in historischer Folge j
geordnet, abweichend von anderen Veröffentlichungen,
welche der geographischen Lage Rechnung tragen und
deshalb an Übersichtlichkeit einbüßen.
Die Bauten des romanischen Übergangsstiles,
von denen Schlesien zwar nicht allzuviele, aber einige
typische besitzt, sind in einem vorzüglichen Beispiele,
der Tistercienserkirche zu Trebnitz, auf den Tafeln fl
bis 7 in Grundriß, Innen- und Außenansichten und J
in Einzelheiten, sowie im Textbilde 2 in einem |
Idealschnitt vorgeführt. Die Kirche ist in der Barock-
zeit im Innern unter Schonung der Gewölbe und
an der Westfront ganz umgestaltet, aber sie gibt
dennoch einen vollständigen Begriff von der Selb- |
ständigkeit, mit welcher damals in Schlesien die von
Frankreich über Mitteldeutschland andringenden Ein-
flüsse benutzt wurden. Die romanische dekorative
und figürliche Skulptur ist durch die Abbildungen ^
von Portalen vertreten, die erstere durch das schöne
Portal von der abgebrochenen Vincenzkirche, jetzt an
der Magdalenenkirche in Breslau, auf Tafel l, letztere
durch das Portal an der Sandkirche in Breslau, auf
Tafel 53. Das Westportal an der Peterskirche in
Görlitz, auf Tafel f, ist bereits fpitzbogig, trägt aber
doch inr einzelnen den romanischen Tharakter.
Nach den schönen, wenn auch vereinzelten An-
fängen im Übergangsstil hätte man von den Schöp-
fungen der gotischen Periode in Schlesien mehr Eigen-
art erwarten sollen, als wirklich vorhanden ist. Wie
es scheint, hat der gemischte Ziegel-Pausteinbau un-
günstig eingewirkt, namentlich auf die Bildung der
Innenpfeiler. In der Klosterkirche zu peinrichau
und dem Dom zu Breslau lernen wir Leistungen
kennen, welche zu den besten in Schlesien zu rechnen
sind; es sind gewölbte Basiliken, die erste mit acht-
eckigen, die zweite mit quadratischen und wenigstens
teilweise mit Bündelpfeilern, doch macht sich bei
beiden Kirchen bereits in der Grundrißgestaltung
eine Vernüchterung gegen die mitteldeutschen Vor-
bilder geltend. Der Aufbau beider Kirchen läßt eine
gewisse Dürftigkeit in der Ausbildung der Oberschiffs-
wände, welche nicht durch Triforien, nicht einmal
durch Blendarkaden belebt sind, in der Ausbildung
der Strebebogen u. a. bemerken.
Der reine Backsteinbau gewinnt in Schlesien nur
wenig Boden und bringt auch nichts hervor, was
mit den Bauwerken der Norddeutschen Tiefebene in
dieser Art in Vergleich zu stellen wäre. Die Adalbert-
kirche in Breslau ist zwar im wesentlichen ein Back-
steinbau, hat aber doch Fenstermaßwerke und andere
Architekturglieder in paustein.
520. Schlußleiste aus „Berlin und seine Bauten",
von Gg. kjalmhuber, Stuttgart.
502