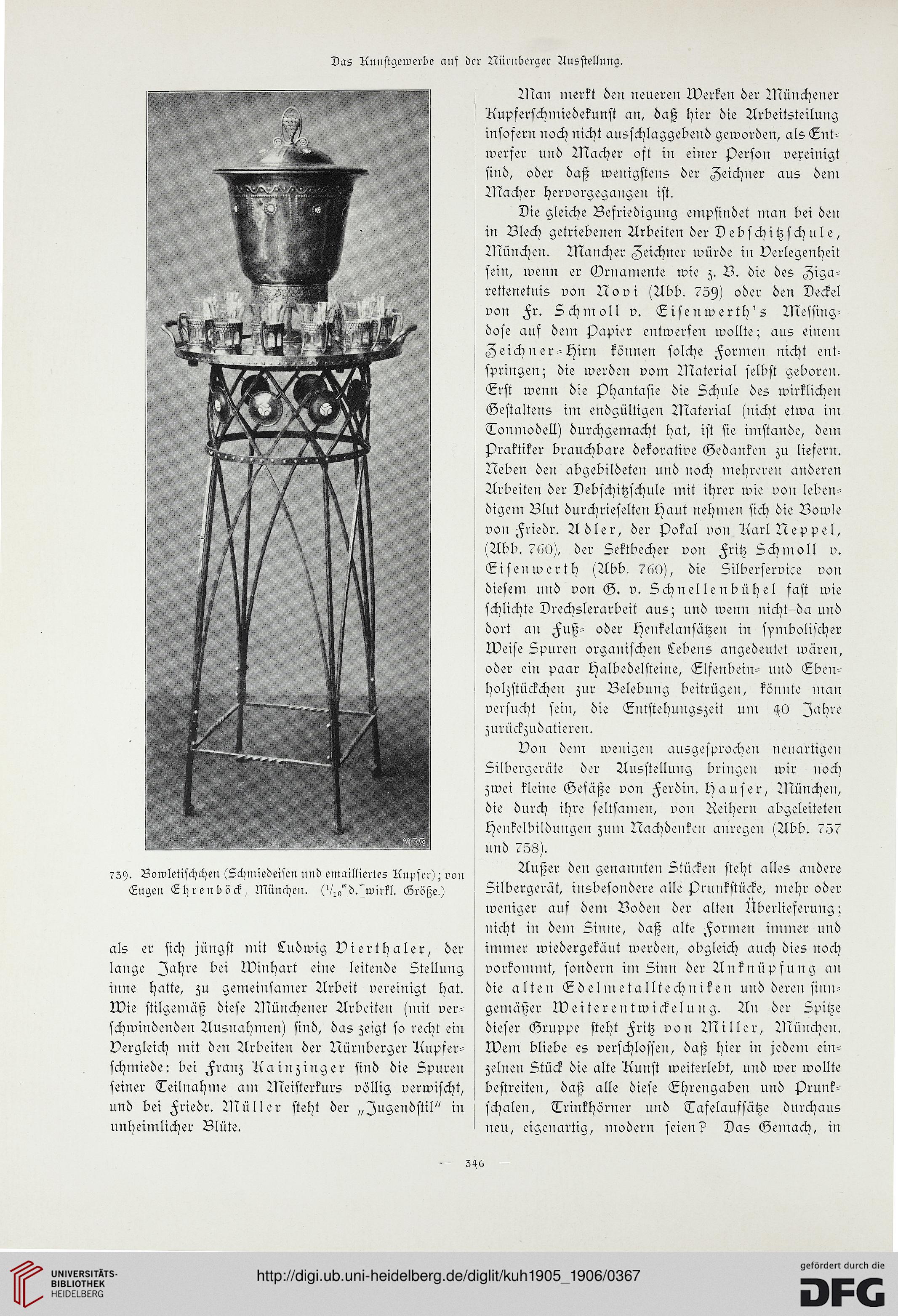Das Kunstgewerbe auf der Nürnberger Ausstellung.
73y. Bowletischchen (Schmiedeisen und emailliertes Kupfer); von
Lugen Ehrenböck, München. (Vipd.'wirkt. Größe.)
als er sich jüngst mit Ludwig Vierthaler, der
lange Zähre bei Dstinhart eine leitende Stellung
inne hatte, zu gemeinsamer Arbeit vereinigt hat.
Mie stilgemäß diese Münchener Arbeiten (mit ver-
schwindenden Ausnahmen) sind, das zeigt so recht ein
Vergleich mit den Arbeiten der Nürnberger Aupfer-
schmiede: bei Franz Aainzinger sind die Spuren
seiner Teilnahme am Meisterkurs völlig verwischt,
und bei Friedr. Müller steht der „Jugendstil" in
unheimlicher Blüte.
Man merkt den neueren Merken der Münchener
Aupferschmiedekunst an, daß hier die Arbeitsteilung
insofern noch nicht ausschlaggebend geworden, als Ent-
werfer und Macher oft in einer Person vereinigt
sind, oder daß wenigstens der Zeichner aus dem
Macher hervorgegaugen ist.
Die gleiche Befriedigung empfindet man bei den
in Blech getriebenen Arbeiten der D ebschitz sch u l e,
München. Mancher Zeichner würde in Verlegenheit
sein, wenn er Ornamente wie z. B. die des Ziga-
rettenetuis von Novi (Abb. 759) oder den Deckel
von Fr. Schmoll v. Eisenwerth's Messing-
dose auf dem Papier entwerfen wollte; aus einem
Zeichner-Pirn können solche Formen nicht ent-
springen; die werden vom Material selbst geboren.
Erst wenn die Phantasie die Schule des wirklichen
Gestaltens im endgültigen Material (nicht etwa im
Tonmodell) durchgemacht hat, ist sie imstande, dem
Praktiker brauchbare dekorative Gedanken zu liefern.
Neben den abgebildeten und noch mehreren anderen
Arbeiten der Debschitzschule mit ihrer wie von leben-
digein Blut durchrieselten chaut nehmen sich die Bowle
von Friedr. Adler, der Pokal von Aarl Neppel,
(Abb. 760), der Sektbecher von Fritz Schmoll v.
Eisenwerth (Abb. 760), die Silberserviee von
diesem und von G. v. Schnellenbühel fast wie
schlichte Drechslerarbeit aus; und wenn nicht da und
dort an Fuß- oder chenkelansätzen in symbolischer
Meise Spuren organischen Lebens angedeutet wären,
oder ein paar Halbedelsteine, Elfenbein- und Eben-
holzstückchen zur Belebung beitrügen, könnte man
versucht sein, die Entstehungszeit um (f0 Zähre
zurückzudatieren.
Von dem wenigen ausgesprochen neuartigen
Silbergeräte der Ausstellung bringen wir noch
zwei kleine Gefäße von Ferdin. p a user, München,
die durch ihre seltsamen, von Aeihern abgeleiteten
chenkelbildungen zum Nachdenken anregen (Abb. 757
und 758).
Außer den genannten Stücken steht alles andere
Silbergerät, insbesondere alle Prunkstücke, mehr oder
weniger auf dem Boden der alten Überlieferung;
nicht in dem Sinne, daß alte Formen immer und
immer wiedergekäut werden, obgleich auch dies noch
vorkommt, sondern im Sinn der Anknüpfung an
die alten Edelmetalltechniken und deren sinn-
gemäßer Meiterentwickelung. An der Spitze
dieser Gruppe steht Fritz von Miller, München.
Mem bliebe es verschlossen, daß hier in jedem ein-
zelnen Stück die alte Aunst weiterlebt, und wer wollte
bestreiten, daß alle diese Ehrengaben und Prunk-
schalen, Trinkhörner und Tafelaufsätze durchaus
neu, eigenartig, modern seien? Das Gemach, in
73y. Bowletischchen (Schmiedeisen und emailliertes Kupfer); von
Lugen Ehrenböck, München. (Vipd.'wirkt. Größe.)
als er sich jüngst mit Ludwig Vierthaler, der
lange Zähre bei Dstinhart eine leitende Stellung
inne hatte, zu gemeinsamer Arbeit vereinigt hat.
Mie stilgemäß diese Münchener Arbeiten (mit ver-
schwindenden Ausnahmen) sind, das zeigt so recht ein
Vergleich mit den Arbeiten der Nürnberger Aupfer-
schmiede: bei Franz Aainzinger sind die Spuren
seiner Teilnahme am Meisterkurs völlig verwischt,
und bei Friedr. Müller steht der „Jugendstil" in
unheimlicher Blüte.
Man merkt den neueren Merken der Münchener
Aupferschmiedekunst an, daß hier die Arbeitsteilung
insofern noch nicht ausschlaggebend geworden, als Ent-
werfer und Macher oft in einer Person vereinigt
sind, oder daß wenigstens der Zeichner aus dem
Macher hervorgegaugen ist.
Die gleiche Befriedigung empfindet man bei den
in Blech getriebenen Arbeiten der D ebschitz sch u l e,
München. Mancher Zeichner würde in Verlegenheit
sein, wenn er Ornamente wie z. B. die des Ziga-
rettenetuis von Novi (Abb. 759) oder den Deckel
von Fr. Schmoll v. Eisenwerth's Messing-
dose auf dem Papier entwerfen wollte; aus einem
Zeichner-Pirn können solche Formen nicht ent-
springen; die werden vom Material selbst geboren.
Erst wenn die Phantasie die Schule des wirklichen
Gestaltens im endgültigen Material (nicht etwa im
Tonmodell) durchgemacht hat, ist sie imstande, dem
Praktiker brauchbare dekorative Gedanken zu liefern.
Neben den abgebildeten und noch mehreren anderen
Arbeiten der Debschitzschule mit ihrer wie von leben-
digein Blut durchrieselten chaut nehmen sich die Bowle
von Friedr. Adler, der Pokal von Aarl Neppel,
(Abb. 760), der Sektbecher von Fritz Schmoll v.
Eisenwerth (Abb. 760), die Silberserviee von
diesem und von G. v. Schnellenbühel fast wie
schlichte Drechslerarbeit aus; und wenn nicht da und
dort an Fuß- oder chenkelansätzen in symbolischer
Meise Spuren organischen Lebens angedeutet wären,
oder ein paar Halbedelsteine, Elfenbein- und Eben-
holzstückchen zur Belebung beitrügen, könnte man
versucht sein, die Entstehungszeit um (f0 Zähre
zurückzudatieren.
Von dem wenigen ausgesprochen neuartigen
Silbergeräte der Ausstellung bringen wir noch
zwei kleine Gefäße von Ferdin. p a user, München,
die durch ihre seltsamen, von Aeihern abgeleiteten
chenkelbildungen zum Nachdenken anregen (Abb. 757
und 758).
Außer den genannten Stücken steht alles andere
Silbergerät, insbesondere alle Prunkstücke, mehr oder
weniger auf dem Boden der alten Überlieferung;
nicht in dem Sinne, daß alte Formen immer und
immer wiedergekäut werden, obgleich auch dies noch
vorkommt, sondern im Sinn der Anknüpfung an
die alten Edelmetalltechniken und deren sinn-
gemäßer Meiterentwickelung. An der Spitze
dieser Gruppe steht Fritz von Miller, München.
Mem bliebe es verschlossen, daß hier in jedem ein-
zelnen Stück die alte Aunst weiterlebt, und wer wollte
bestreiten, daß alle diese Ehrengaben und Prunk-
schalen, Trinkhörner und Tafelaufsätze durchaus
neu, eigenartig, modern seien? Das Gemach, in