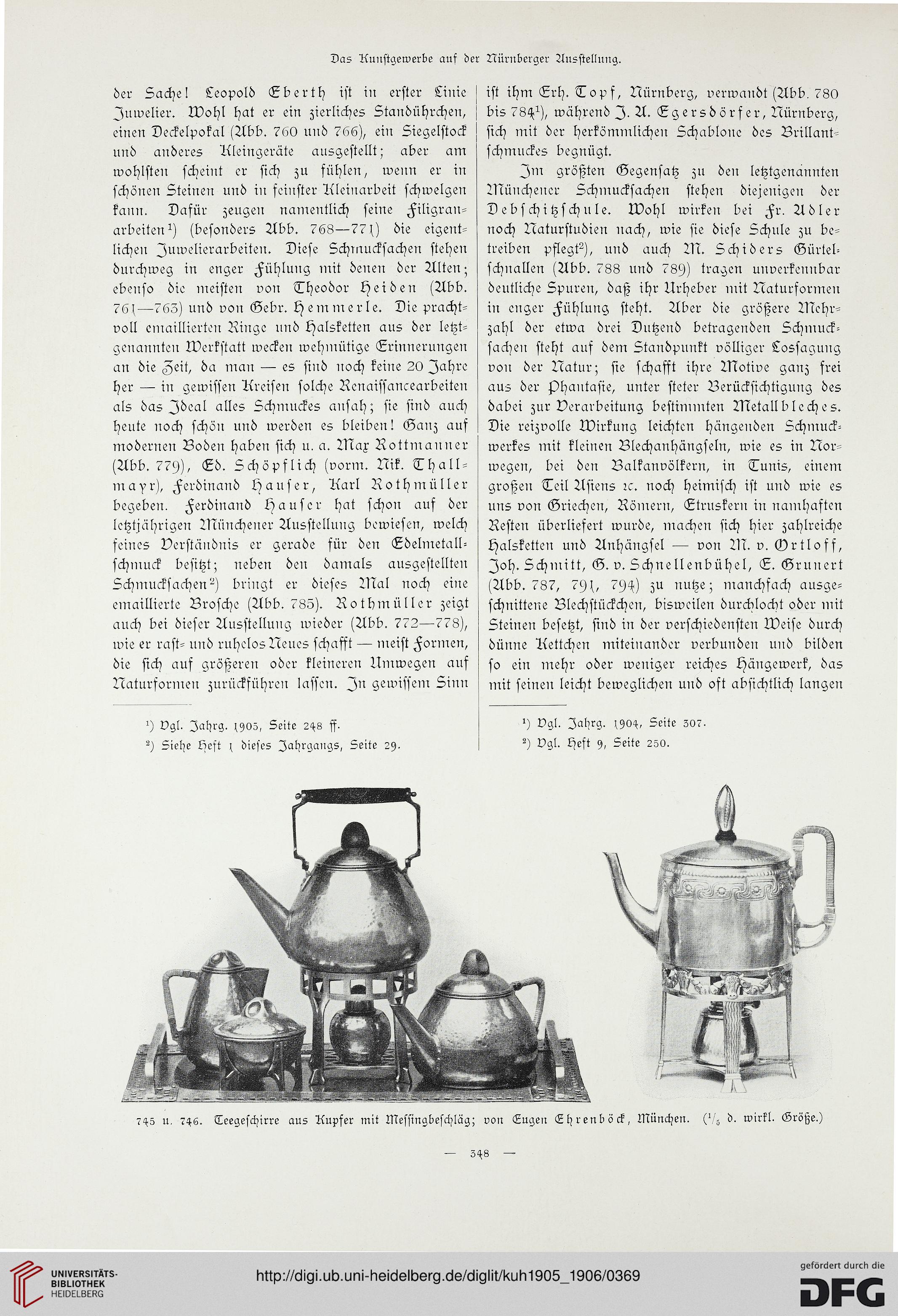Das Runstgewerbe auf der Nürnberger Ausstellung.
der Sache! Leopold Eberth ist in erster Linie
Juwelier. Wohl hat er ein zierliches Standührchen,
einen Deckelpokal (Abb. 760 und 766), ein Siegelstock
und anderes Aleingeräte ausgestellt; aber am
wohlsten scheint er sich zu fühlen, wenn er in
schönen Steinen und in feinster Kleinarbeit schwelgen
kann. Dafür zeugen namentlich seine Filigran-
arbeiten i) (besonders Abb. 768—77 () die eigent-
lichen Juwelierarbeiten. Diese Schmucksachen stehen
durchweg in enger Fühlung mit deilen der Alten;
ebenso die meisten von Theodor Heiden (Abb.
76s—763) und von Gebr. b)em merle. Die pracht-
voll emaillierten Ringe und chalsketten aus der letzt-
genannten Werkstatt wecken wehmütige Erinnerungen
an die Zeit, da man — es sind noch keine 20 Zahre
her — in gewissen Kreisen solche Renaissancearbeiten
als das Zdeal alles Schmuckes ansah; sie sind auch
heute noch schön und werden es bleiben! Ganz auf
modernen Boden haben sich u. a. Max Rottmanner
(Abb. 779), Ed. Schöpflich (vorm. Nik. Thall-
mayr), Ferdinand chauser, Karl Rothmüller
begeben. Ferdinand chauser hat schon auf der
letztjährigen Münchener Ausstellung bewiesen, welch
seines Verständnis er gerade für den Edelmetall-
fchmuck besitzt; neben den damals ausgestellten
Schmucksachen2) bringt er dieses Mal noch eine
emaillierte Brosche (Abb. 785). Rothmüller zeigt
auch bei dieser Ausstellung wieder (Abb. 772—778),
wie er rast- und ruhelos Neues schafft — meist Formen,
die sich auf größeren oder kleineren Umwegen auf
Natursormen zurücksühren lassen. Zn gewissem Sinn
9 Ogl. Iahrg. ;905, Seite 2^8 ff.
2) Siehe ßcft ; dieses Jahrgangs, Seite 29.
745 u. 746. Teegeschirre aus Rupfer mit Messingbeschläg;
ist ihm Erh. Topf, Nürnberg, verwandt (Abb. 780
bis 78^.ff, während Z. A. Egersdörfer, Nürnberg,
sich mit der herkömmlichen Schablone des Brillant
schmuckes begnügt.
Zm größten Gegensatz zu den letztgenannten
Münchener Schmucksachen stehen diejeitigen der
Debschitzschule. Wohl wirken bei Fr. Adler
noch Naturstudien nach, wie sie diese Schule zu be-
treiben pflegt2), und auch UI. Schiders Gürtel-
schitallen (Abb. 788 und 789) tragen unverkennbar-
deutliche Spuren, daß ihr Urheber mit Naturformen
in eitger Fühlung steht. Aber die größere Mehr-
zahl der etwa drei Dutzend betragenden Schmuck-
sachen steht auf denr Standpunkt völliger Lossagung
von der Natur; sie schafft ihre Motive gattz frei
aus der Phantasie, unter steter Berücksichtigung des
dabei zur Verarbeitung bestimmten Metallbleches.
Die reizvolle Wirkung leichten hängenden Schmuck-
werkes mit kleinen Blechanhängseln, wie es in Nor-
wegen, bei den Balkanvölkern, in Tunis, einem
großen Teil Asiens w. noch heimisch ist und wie es
uns von Griechen, Römern, Etruskern in namhaften
Resten überliefert wurde, machen sich hier zahlreiche
Halsketten und Anhängsel — von M. v. Ortloff,
Zoh. Schmitt, G. v. Schnellenbühel, E. Grunert
(Abb. 787, 79(, 7ffch zu nutze; manchfach ausge-
schnittene Blechstückchen, bisweilen durchlocht oder mit
Steinen besetzt, sind in der verschiedensten Weise durch
dünne Kettchen miteiitander verbunden und bilden
so ein mehr oder weniger reiches Hängewerk, das
mit seinen leicht beweglichen und oft absichtlich langen
9 Vgl. Iahrg. \90^, Seite 307.
2) Vgl. ffest 9, Seite 250.
von Tugen Threnböck, München. (1/5 d. wirkt. Größe.)
der Sache! Leopold Eberth ist in erster Linie
Juwelier. Wohl hat er ein zierliches Standührchen,
einen Deckelpokal (Abb. 760 und 766), ein Siegelstock
und anderes Aleingeräte ausgestellt; aber am
wohlsten scheint er sich zu fühlen, wenn er in
schönen Steinen und in feinster Kleinarbeit schwelgen
kann. Dafür zeugen namentlich seine Filigran-
arbeiten i) (besonders Abb. 768—77 () die eigent-
lichen Juwelierarbeiten. Diese Schmucksachen stehen
durchweg in enger Fühlung mit deilen der Alten;
ebenso die meisten von Theodor Heiden (Abb.
76s—763) und von Gebr. b)em merle. Die pracht-
voll emaillierten Ringe und chalsketten aus der letzt-
genannten Werkstatt wecken wehmütige Erinnerungen
an die Zeit, da man — es sind noch keine 20 Zahre
her — in gewissen Kreisen solche Renaissancearbeiten
als das Zdeal alles Schmuckes ansah; sie sind auch
heute noch schön und werden es bleiben! Ganz auf
modernen Boden haben sich u. a. Max Rottmanner
(Abb. 779), Ed. Schöpflich (vorm. Nik. Thall-
mayr), Ferdinand chauser, Karl Rothmüller
begeben. Ferdinand chauser hat schon auf der
letztjährigen Münchener Ausstellung bewiesen, welch
seines Verständnis er gerade für den Edelmetall-
fchmuck besitzt; neben den damals ausgestellten
Schmucksachen2) bringt er dieses Mal noch eine
emaillierte Brosche (Abb. 785). Rothmüller zeigt
auch bei dieser Ausstellung wieder (Abb. 772—778),
wie er rast- und ruhelos Neues schafft — meist Formen,
die sich auf größeren oder kleineren Umwegen auf
Natursormen zurücksühren lassen. Zn gewissem Sinn
9 Ogl. Iahrg. ;905, Seite 2^8 ff.
2) Siehe ßcft ; dieses Jahrgangs, Seite 29.
745 u. 746. Teegeschirre aus Rupfer mit Messingbeschläg;
ist ihm Erh. Topf, Nürnberg, verwandt (Abb. 780
bis 78^.ff, während Z. A. Egersdörfer, Nürnberg,
sich mit der herkömmlichen Schablone des Brillant
schmuckes begnügt.
Zm größten Gegensatz zu den letztgenannten
Münchener Schmucksachen stehen diejeitigen der
Debschitzschule. Wohl wirken bei Fr. Adler
noch Naturstudien nach, wie sie diese Schule zu be-
treiben pflegt2), und auch UI. Schiders Gürtel-
schitallen (Abb. 788 und 789) tragen unverkennbar-
deutliche Spuren, daß ihr Urheber mit Naturformen
in eitger Fühlung steht. Aber die größere Mehr-
zahl der etwa drei Dutzend betragenden Schmuck-
sachen steht auf denr Standpunkt völliger Lossagung
von der Natur; sie schafft ihre Motive gattz frei
aus der Phantasie, unter steter Berücksichtigung des
dabei zur Verarbeitung bestimmten Metallbleches.
Die reizvolle Wirkung leichten hängenden Schmuck-
werkes mit kleinen Blechanhängseln, wie es in Nor-
wegen, bei den Balkanvölkern, in Tunis, einem
großen Teil Asiens w. noch heimisch ist und wie es
uns von Griechen, Römern, Etruskern in namhaften
Resten überliefert wurde, machen sich hier zahlreiche
Halsketten und Anhängsel — von M. v. Ortloff,
Zoh. Schmitt, G. v. Schnellenbühel, E. Grunert
(Abb. 787, 79(, 7ffch zu nutze; manchfach ausge-
schnittene Blechstückchen, bisweilen durchlocht oder mit
Steinen besetzt, sind in der verschiedensten Weise durch
dünne Kettchen miteiitander verbunden und bilden
so ein mehr oder weniger reiches Hängewerk, das
mit seinen leicht beweglichen und oft absichtlich langen
9 Vgl. Iahrg. \90^, Seite 307.
2) Vgl. ffest 9, Seite 250.
von Tugen Threnböck, München. (1/5 d. wirkt. Größe.)