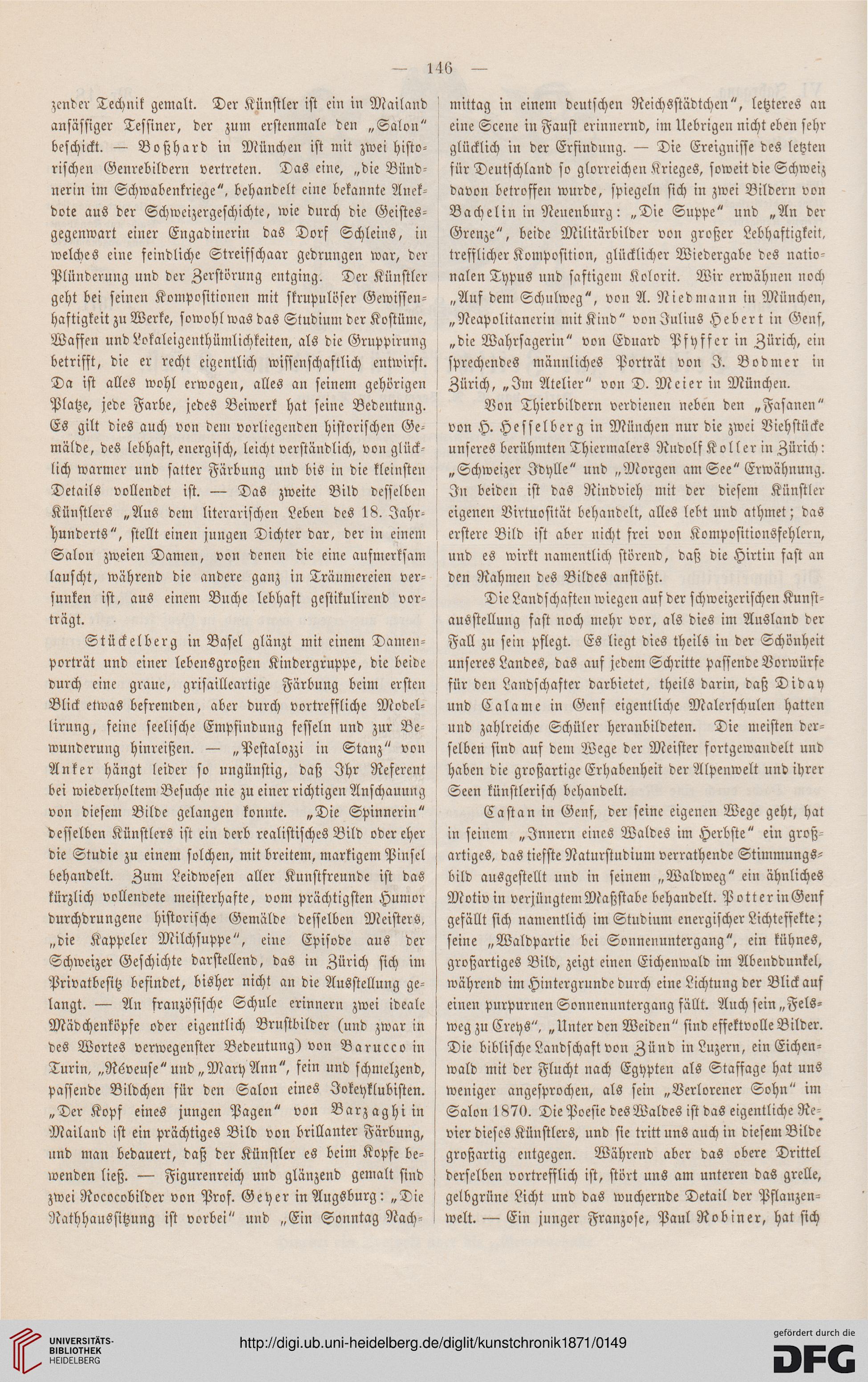146
zender Technik gemalt. Der Künstler ist ein in Mailand
ansässiger Tessiner, der zum erstenmale den „Salon"
beschickt. — Boßhard in München ist mit zwei histo-
rischen Genrebildern vertreten. Das eine, „die Bünd-
nerin im Schwabenkriege", behandelt eine bekannte Anek-
dote aus der Schweizergeschichte, wie durch die Geistes-
gegenwart einer Engadinerin das Dorf Schleins, in
welches eine feindliche Streifschaar gedrungen war, der
Plünderung und der Zerstörung entging. Der Künstler
geht bei seinen Kompositionen mit skrupulöser Gewissen-
haftigkeit zu Werke, sowohl was das Studium der Kostüme,
Wafsen und Lokaleigenthümlichkeiten, als die Gruppirung
betrifft, die er recht eigentlich wissenschaftlich entwirst.
Da ist alles wohl erwogen, alles an seinem gehörigen
Platze, jede Farbe, jedes Beiwerk hat seine Bedeutung.
Es gilt dies auch von dem vorliegenden historischen Ge-
mälde, des lebhaft, energisch, leicht verständlich, von glück-
lich warmer und salter Färbung und bis in die kleinsten
Details vollendet ist. — Das zweite Bild desselben
Künstlers „Aus dem literarischen Leben des 18. Jahr-
hunderts", stellt einen jungen Dichter dar, der in einem
Salon zweien Damen, von denen die eine aufmerksam
lauscht, während die andere ganz in Träumereien ver-
sunken ist, aus einem Buche lebhaft gestikulirend vor-
trägt.
Stückelberg in Basel glänzt mit einem Damen-
porträt und einer lebensgroßen Kindergruppe, die beide
durch eine grauc, grisailleartige Färbung beim ersten
Blick etwas befremden, aber durch vortreffliche Model-
lirung, feine seelische Empfindung fesseln und zur Be-
wunderung hinreißen. — „Pestalozzi in Stanz" von
Anker hängt leider so ungünstig, daß Jhr Referent
bei wiederholtem Besuche nie zu einer richtigenAnschauung
von diesem Bilde gelangen konnte. „Die Spinnerin"
desselben Künstlers ist ein derb realistisches Bild oder eher
die Studie zu einem solchen, mit breitem, markigem Pinsel
behandelt. Zum Leidwesen aller Kunstfreunde ist das
kürzlich vollendete meisterhafte, vom prächtigsten Humor
durchdrungene historische Gemälde desselben Meisters,
„die Kappeler Milchsuppe", eine Episode aus der
Schweizer Geschichte darstellend, das in Zürich sich im
Privatbesitz befindet, bisher nicht an die Ausstellung ge-
langt. — An französische Schule erinnern zwei ideale
Mädchenköpfe oder eigentlich Brustbilder (und zwar in
des Wortes verwegenster Bedeutung) von Barucco in
Turin, „R6veuse" und „Mary Ann", fein und schmelzend,
passende Bildchen für den Salon eines Äokeyklubisten.
„Der Kopf eines jungen Pagen" von Barzaghi in
Mailand ist ein prächtiges Bild von brillanter Färbung,
und man bedauert, daß der Künstler es beim Kopfe be-
wenden ließ. — Figurenreich und glänzend gemalt sind
zwei Rococobilder von Prof. Geyer in Augsburg: „Die
Rathhaussitzung ist vorbei" und „Ein Sonntag Nach-
mittag in einem deutschen Reichsstädtchen", letzteres an
eine Scene in Faust erinuernd, im llebrigen nicht eben sehr
glücklich in der Erfindung. — Die Ereignisse des letzten
für Deutschland so glorreichen Krieges, soweitdie Schweiz
davon betroffen wurde, spiegeln sich in zwei Bildern von
Bachelin in Neuenburg: „Die Suppe" und „An der
Grenze", beide Militärbilder von großer Lebhaftigkeit,
trefslicher Komposition, glücklicher Wiedergabe des natio-
nalen Typus und saftigeni Kolorit. Wir erwähnen noch
„Auf dem Schulweg", von A. Niedmann in München,
„Neapolitanerin mitKind" vonJulius Hebert in Genf,
„die Wahrsagerin" von Eduard Pfyffer in Zürich, ein
sprechendes männliches Porträt von I. Bodmer in
Zürich, „Jm Atelier" von D- Meier in München.
Von Thierbildern verdienen neben den „Fasanen"
von H. Hesselberg in München nur die zwei Viehstücke
unseres berühmten Thiermalers Rudolf Kollerin Zürich:
„Schweizer Jdylle" und „Morgen am See" Erwähnung.
Jn beiden ist das Rindvieh mit der diesem Künstler
eigenen Virtuosität behandelt, alles lebt und athmet; das
erstere Bild ist aber nicht frei von Kompositionsfehlern,
und es wirkt namentlich störend, daß die Hirtin fast an
den Rahmen des Bildes anstößt.
Die Landschaften wiegen auf der schweizerischen Kunst-
ausstellung fast noch mehr vor, als dies im Ausland der
Fall zu sein pflegt. Es liegt dies theils in der Schönheit
unseres Landes, das auf jedem Schritte passendeVorwürfe
für den Landschafter darbietet, theils darin, daß Diday
und Calame in Genf eigentliche Malerschulen hatten
und zahlreiche Schüler heranbildeten. Die meisten der-
selben sind auf dem Wege der Meister fortgewandelt und
haben die großartige Erhabenheit der Alpenwelt und ihrer
Seen künstlerisch behandelt.
Castan in Genf, der seine eigenen Wege geht, hat
in seinem „Jnnern eines Waldes im Herbste" ein groß
artiges, das tiefste Naturstudium verrathende Stimmungs-
bild ausgestellt und in seinem „Waldweg" ein ähnliches
Motiv in verjüngtemMaßstabe behandelt. P otterinGenf
gefällt sich namentlich im Studium energischer Lichteffekte;
seine „Waldpartie bei Sonnenuntergang", ein kühnes,
großartiges Bild, zeigt einen Eichenwald im Abenddunkel,
während im Hintergrunde durch eine Lichtung der Blick auf
einen purpurnen Sonnenuntergang fällt. Auch sein „Fels-
weg zu Creys", „Unter den Weiden" sind effektvolleBilder.
Die biblische Landschaft von Zünd in Luzern, ein Eichen-
wald mit der Flucht nach Egypten als Staffage hat uns
weniger angesprochen, als sein „Berlorener Sohn" im
Salon 1870. Die Poesie des Waldes ist das eigentliche Re-^
vier dieses Künstlers, und sie tritt uns auch in diesem Bilde
großartig entgegen. Während aber das obere Drittel
derselben vortrefslich ist, stört uns am unteren das grelle,
gelbgrüne Licht und das wuchernde Detail der Pflanzen-
welt. — Ein junger Franzose, Paul Robiner, hat sich
zender Technik gemalt. Der Künstler ist ein in Mailand
ansässiger Tessiner, der zum erstenmale den „Salon"
beschickt. — Boßhard in München ist mit zwei histo-
rischen Genrebildern vertreten. Das eine, „die Bünd-
nerin im Schwabenkriege", behandelt eine bekannte Anek-
dote aus der Schweizergeschichte, wie durch die Geistes-
gegenwart einer Engadinerin das Dorf Schleins, in
welches eine feindliche Streifschaar gedrungen war, der
Plünderung und der Zerstörung entging. Der Künstler
geht bei seinen Kompositionen mit skrupulöser Gewissen-
haftigkeit zu Werke, sowohl was das Studium der Kostüme,
Wafsen und Lokaleigenthümlichkeiten, als die Gruppirung
betrifft, die er recht eigentlich wissenschaftlich entwirst.
Da ist alles wohl erwogen, alles an seinem gehörigen
Platze, jede Farbe, jedes Beiwerk hat seine Bedeutung.
Es gilt dies auch von dem vorliegenden historischen Ge-
mälde, des lebhaft, energisch, leicht verständlich, von glück-
lich warmer und salter Färbung und bis in die kleinsten
Details vollendet ist. — Das zweite Bild desselben
Künstlers „Aus dem literarischen Leben des 18. Jahr-
hunderts", stellt einen jungen Dichter dar, der in einem
Salon zweien Damen, von denen die eine aufmerksam
lauscht, während die andere ganz in Träumereien ver-
sunken ist, aus einem Buche lebhaft gestikulirend vor-
trägt.
Stückelberg in Basel glänzt mit einem Damen-
porträt und einer lebensgroßen Kindergruppe, die beide
durch eine grauc, grisailleartige Färbung beim ersten
Blick etwas befremden, aber durch vortreffliche Model-
lirung, feine seelische Empfindung fesseln und zur Be-
wunderung hinreißen. — „Pestalozzi in Stanz" von
Anker hängt leider so ungünstig, daß Jhr Referent
bei wiederholtem Besuche nie zu einer richtigenAnschauung
von diesem Bilde gelangen konnte. „Die Spinnerin"
desselben Künstlers ist ein derb realistisches Bild oder eher
die Studie zu einem solchen, mit breitem, markigem Pinsel
behandelt. Zum Leidwesen aller Kunstfreunde ist das
kürzlich vollendete meisterhafte, vom prächtigsten Humor
durchdrungene historische Gemälde desselben Meisters,
„die Kappeler Milchsuppe", eine Episode aus der
Schweizer Geschichte darstellend, das in Zürich sich im
Privatbesitz befindet, bisher nicht an die Ausstellung ge-
langt. — An französische Schule erinnern zwei ideale
Mädchenköpfe oder eigentlich Brustbilder (und zwar in
des Wortes verwegenster Bedeutung) von Barucco in
Turin, „R6veuse" und „Mary Ann", fein und schmelzend,
passende Bildchen für den Salon eines Äokeyklubisten.
„Der Kopf eines jungen Pagen" von Barzaghi in
Mailand ist ein prächtiges Bild von brillanter Färbung,
und man bedauert, daß der Künstler es beim Kopfe be-
wenden ließ. — Figurenreich und glänzend gemalt sind
zwei Rococobilder von Prof. Geyer in Augsburg: „Die
Rathhaussitzung ist vorbei" und „Ein Sonntag Nach-
mittag in einem deutschen Reichsstädtchen", letzteres an
eine Scene in Faust erinuernd, im llebrigen nicht eben sehr
glücklich in der Erfindung. — Die Ereignisse des letzten
für Deutschland so glorreichen Krieges, soweitdie Schweiz
davon betroffen wurde, spiegeln sich in zwei Bildern von
Bachelin in Neuenburg: „Die Suppe" und „An der
Grenze", beide Militärbilder von großer Lebhaftigkeit,
trefslicher Komposition, glücklicher Wiedergabe des natio-
nalen Typus und saftigeni Kolorit. Wir erwähnen noch
„Auf dem Schulweg", von A. Niedmann in München,
„Neapolitanerin mitKind" vonJulius Hebert in Genf,
„die Wahrsagerin" von Eduard Pfyffer in Zürich, ein
sprechendes männliches Porträt von I. Bodmer in
Zürich, „Jm Atelier" von D- Meier in München.
Von Thierbildern verdienen neben den „Fasanen"
von H. Hesselberg in München nur die zwei Viehstücke
unseres berühmten Thiermalers Rudolf Kollerin Zürich:
„Schweizer Jdylle" und „Morgen am See" Erwähnung.
Jn beiden ist das Rindvieh mit der diesem Künstler
eigenen Virtuosität behandelt, alles lebt und athmet; das
erstere Bild ist aber nicht frei von Kompositionsfehlern,
und es wirkt namentlich störend, daß die Hirtin fast an
den Rahmen des Bildes anstößt.
Die Landschaften wiegen auf der schweizerischen Kunst-
ausstellung fast noch mehr vor, als dies im Ausland der
Fall zu sein pflegt. Es liegt dies theils in der Schönheit
unseres Landes, das auf jedem Schritte passendeVorwürfe
für den Landschafter darbietet, theils darin, daß Diday
und Calame in Genf eigentliche Malerschulen hatten
und zahlreiche Schüler heranbildeten. Die meisten der-
selben sind auf dem Wege der Meister fortgewandelt und
haben die großartige Erhabenheit der Alpenwelt und ihrer
Seen künstlerisch behandelt.
Castan in Genf, der seine eigenen Wege geht, hat
in seinem „Jnnern eines Waldes im Herbste" ein groß
artiges, das tiefste Naturstudium verrathende Stimmungs-
bild ausgestellt und in seinem „Waldweg" ein ähnliches
Motiv in verjüngtemMaßstabe behandelt. P otterinGenf
gefällt sich namentlich im Studium energischer Lichteffekte;
seine „Waldpartie bei Sonnenuntergang", ein kühnes,
großartiges Bild, zeigt einen Eichenwald im Abenddunkel,
während im Hintergrunde durch eine Lichtung der Blick auf
einen purpurnen Sonnenuntergang fällt. Auch sein „Fels-
weg zu Creys", „Unter den Weiden" sind effektvolleBilder.
Die biblische Landschaft von Zünd in Luzern, ein Eichen-
wald mit der Flucht nach Egypten als Staffage hat uns
weniger angesprochen, als sein „Berlorener Sohn" im
Salon 1870. Die Poesie des Waldes ist das eigentliche Re-^
vier dieses Künstlers, und sie tritt uns auch in diesem Bilde
großartig entgegen. Während aber das obere Drittel
derselben vortrefslich ist, stört uns am unteren das grelle,
gelbgrüne Licht und das wuchernde Detail der Pflanzen-
welt. — Ein junger Franzose, Paul Robiner, hat sich