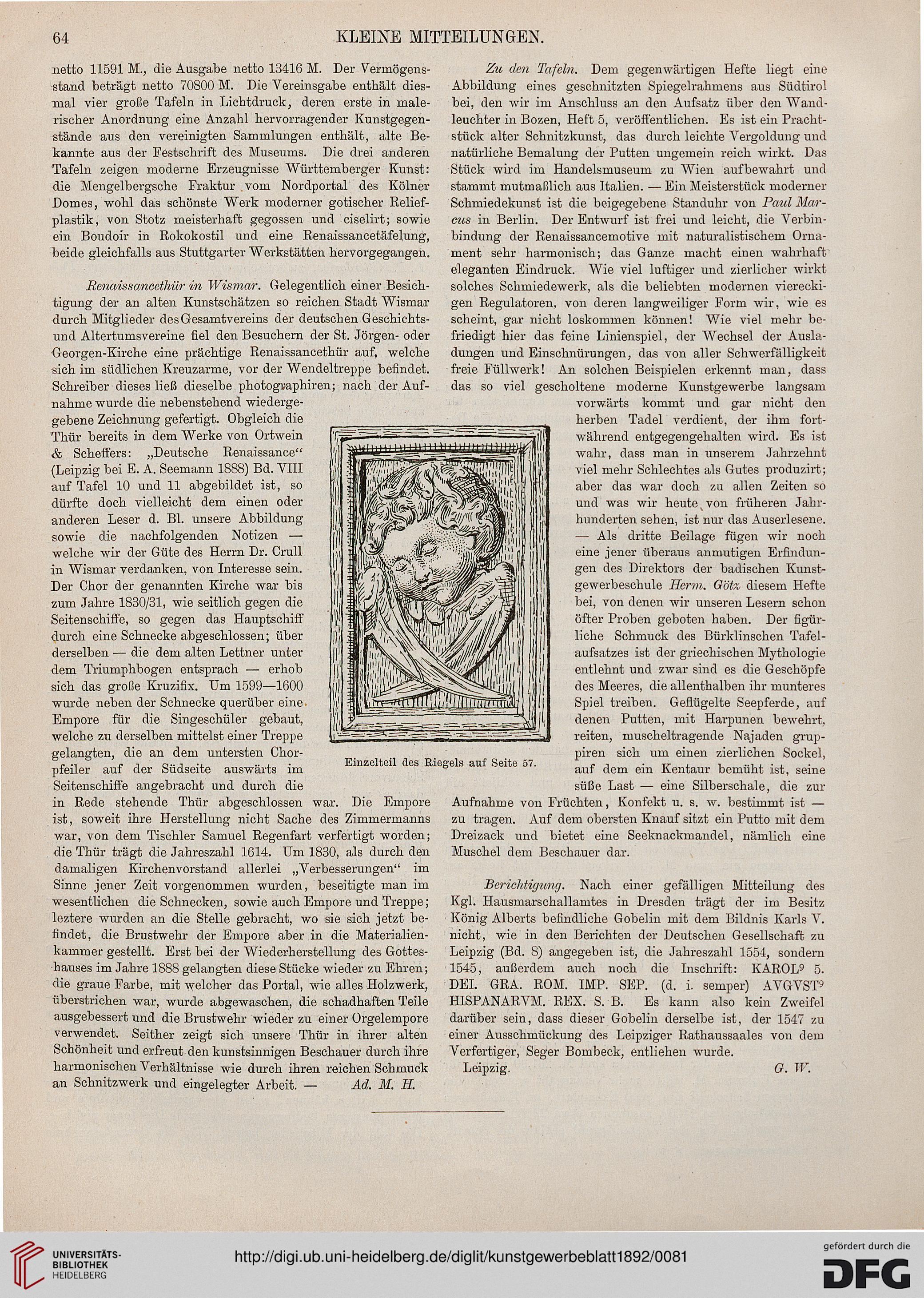64
KLEINE MITTEILUNGEN.
netto 11591 M., die Ausgabe netto 13416 M. Der Vermögens-
stand beträgt netto 70S00 M. Die Vereinsgabe enthält dies-
mal vier große Tafeln in Lichtdruck, deren erste in male-
rischer Anordnung eine Anzahl hervorragender Kunstgegen-
stände aus den vereinigten Sammlungen enthält, alte Be-
kannte aus der Festschrift des Museums. Die drei anderen
Tafeln zeigen moderne Erzeugnisse Württemberger Kunst:
die Mengelbergsche Fraktur vom Nordportal des Kölner
Domes, wohl das schönste Werk moderner gotischer Itelief-
plastik, von Stotz meisterhaft gegossen und ciselirt; sowie
ein Boudoir in Rokokostil und eine Renaissancetäfelung,
beide gleichfalls aus Stuttgarter Werkstätten hervorgegangen.
Benaissaneethür in Wismar. Gelegentlich einer Besich-
tigung der an alten Kunstschätzen so reichen Stadt Wismar
durch Mitglieder desGesamtvereins der deutschen Geschichts-
und Altertumsvereine fiel den Besuchern der St. Jörgen- oder
Georgen-Kirche eine prächtige Renaissancethür auf, welche
sich im südlichen Kreuzarme, vor der Wendeltreppe befindet.
Schreiber dieses ließ dieselbe photographiren; nach der Auf-
nahme wurde die nebenstehend wiederge-
gebene Zeichnung gefertigt. Obgleich die
Thür bereits in dem Werke von Ortwein
& Scheffers: „Deutsche Renaissance"
{Leipzig bei E. A. Seemann 1888) Bd. VIII
auf Tafel 10 und 11 abgebildet ist, so
dürfte doch vielleicht dem einen oder
anderen Leser d. Bl. unsere Abbildung
sowie die nachfolgenden Notizen —
welche wir der Güte des Herrn Dr. Crull
in Wismar verdanken, von Interesse sein.
Der Chor der genannten Kirche war bis
zum Jahre 1830/31, wie seitlich gegen die
Seitenschiffe, so gegen das Hauptschiff
durch eine Schnecke abgeschlossen; über
derselben — die dem alten Lettner unter
dem Triumphbogen entsprach — erhob
sich das große Kruzifix. Um 1599—1600
wurde neben der Schnecke querüber eine-
Empore für die Singeschüler gebaut,
welche zu derselben mittelst einer Treppe
gelangten, die an dem untersten Chor-
pfeiler auf der Südseite auswärts im
Seitenschiffe angebracht und durch die
in Rede stehende Thür abgeschlossen war. Die Empore
ist, soweit ihre Herstellung nicht Sache des Zimmermanns
war, von dem Tischler Samuel Regenfart verfertigt worden;
die Thür trägt die Jahreszahl 1614. Um 1830, als durch den
damaligen Kirchenvorstand allerlei „Verbesserungen" im
Sinne jener Zeit vorgenommen wurden, beseitigte man im
wesentlichen die Schnecken, sowie auch Empore und Treppe;
leztere wurden an die Stelle gebracht, wo sie sich jetzt be-
findet, die Brustwehr der Empore aber in die Materialien-
kammer gestellt. Erst bei der Wiederherstellung des Gottes-
hauses im Jahre 1888 gelangten diese Stücke wieder zu Ehren;
die graue Farbe, mit welcher das Portal, wie alles Holzwerk,
überstrichen war, wurde abgewaschen, die schadhaften Teile
ausgebessert und die Brustwehr wieder zu einer Orgelempore
verwendet. Seither zeigt sich unsere Thür in ihrer alten
Schönheit und erfreut den kunstsinnigen Beschauer durch ihre
harmonischen Verhältnisse wie durch ihren reichen Schmuck
an Schnitzwerk und eingelegter Arbeit. — Ad. M. IL
Einzelteil des Riegels auf Seite 57
Zu den Tafeln. Dem gegenwärtigen Hefte liegt eine
Abbildung eines geschnitzten Spiegelrahmens aus Südtirol
bei, den wir im Anschluss an den Aufsatz über den Wand-
leuchter in Bozen, Heft 5, veröffentlichen. Es ist ein Pracht-
stück alter Schnitzkunst, das durch leichte Vergoldung und
natürliche Bemalung der Putten ungemein reich wirkt. Das
Stück wird im Handelsmuseum zu Wien aufbewahrt und
stammt mutmaßlich aus Italien. — Ein Meisterstück moderner
Schmiedekunst ist die beigegebene Standuhr von Paul Mar-
cus in Berlin. Der Entwurf ist frei und leicht, die Verbin-
bindung der Renaissancemotive mit naturalistischem Orna-
ment sehr harmonisch; das Ganze macht einen wahrhaft
eleganten Eindruck. Wie viel luftiger und zierlicher wirkt
solches Schmiedewerk, als die beliebten modernen vierecki-
gen Regulatoren, von deren langweiliger Form wir, wie es
scheint, gar nicht loskommen können! Wie viel mehr be-
friedigt hier das feine Linienspiel, der Wechsel der Ausla-
dungen und Einschnürungen, das von aller Schwerfälligkeit
freie Füllwerk! An solchen Beispielen erkennt man, dass
das so viel gescholtene moderne Kunstgewerbe langsam
vorwärts kommt und gar nicht den
herben Tadel verdient, der ihm fort-
während entgegengehalten wird. Es ist
wahr, dass man in unserem Jahrzehnt
viel mehr Schlechtes als Gutes produzirt;
aber das war doch zu allen Zeiten so
und was wir heute (von früheren Jahr-
hunderten sehen, ist nur das Auserlesene.
— Als dritte Beilage fügen wir noch
eine jener überaus anmutigen Erfindun-
gen des Direktors der badischen Kunst-
gewerbeschule Herrn. Götz diesem Hefte
bei, von denen wir unseren Lesern schon
öfter Proben geboten haben. Der figür-
liche Schmuck des Bürklinschen Tafel-
aufsatzes ist der griechischen Mythologie
entlehnt und zwar sind es die Geschöpfe
des Meeres, die allenthalben ihr munteres
Spiel treiben. Geflügelte Seepferde, auf
denen Putten, mit Harpunen bewehrt,
reiten, muscheltragende Najaden grup-
piren sich um einen zierlichen Sockel,
auf dem ein Kentaur bemüht ist, seine
süße Last — eine Silberschale, die zur
Aufnahme von Früchten, Konfekt n. s. w. bestimmt ist —
zu tragen. Auf dem obersten Knauf sitzt ein Putto mit dem
Dreizack und bietet eine Seeknackmandel, nämlich eine
Muschel dem Beschauer dar.
Berichtigung. Nach einer gefälligen Mitteilung des
Kgl. Hausmarschallamtes in Dresden trägt der im Besitz
König Alberts befindliche Gobelin mit dem Bildnis Karls V.
nicht, wie in den Berichten der Deutschen Gesellschaft zu
Leipzig (Bd. 8) angegeben ist, die Jahreszahl 1554, sondern
1545, außerdem auch noch die Inschrift: KAROL9 5.
DEL GRA. ROM. IMP. SEP. (d. i. semper) AVGVST9
HISPANARVM. REX. S. B. Es kann also kein Zweifel
darüber sein, dass dieser Gobelin derselbe ist, der 1547 zu
einer Ausschmückung des Leipziger Rathaussaales von dem
Verfertiger, Seger Bombeck, entliehen wurde.
Leipzig. O. W.
KLEINE MITTEILUNGEN.
netto 11591 M., die Ausgabe netto 13416 M. Der Vermögens-
stand beträgt netto 70S00 M. Die Vereinsgabe enthält dies-
mal vier große Tafeln in Lichtdruck, deren erste in male-
rischer Anordnung eine Anzahl hervorragender Kunstgegen-
stände aus den vereinigten Sammlungen enthält, alte Be-
kannte aus der Festschrift des Museums. Die drei anderen
Tafeln zeigen moderne Erzeugnisse Württemberger Kunst:
die Mengelbergsche Fraktur vom Nordportal des Kölner
Domes, wohl das schönste Werk moderner gotischer Itelief-
plastik, von Stotz meisterhaft gegossen und ciselirt; sowie
ein Boudoir in Rokokostil und eine Renaissancetäfelung,
beide gleichfalls aus Stuttgarter Werkstätten hervorgegangen.
Benaissaneethür in Wismar. Gelegentlich einer Besich-
tigung der an alten Kunstschätzen so reichen Stadt Wismar
durch Mitglieder desGesamtvereins der deutschen Geschichts-
und Altertumsvereine fiel den Besuchern der St. Jörgen- oder
Georgen-Kirche eine prächtige Renaissancethür auf, welche
sich im südlichen Kreuzarme, vor der Wendeltreppe befindet.
Schreiber dieses ließ dieselbe photographiren; nach der Auf-
nahme wurde die nebenstehend wiederge-
gebene Zeichnung gefertigt. Obgleich die
Thür bereits in dem Werke von Ortwein
& Scheffers: „Deutsche Renaissance"
{Leipzig bei E. A. Seemann 1888) Bd. VIII
auf Tafel 10 und 11 abgebildet ist, so
dürfte doch vielleicht dem einen oder
anderen Leser d. Bl. unsere Abbildung
sowie die nachfolgenden Notizen —
welche wir der Güte des Herrn Dr. Crull
in Wismar verdanken, von Interesse sein.
Der Chor der genannten Kirche war bis
zum Jahre 1830/31, wie seitlich gegen die
Seitenschiffe, so gegen das Hauptschiff
durch eine Schnecke abgeschlossen; über
derselben — die dem alten Lettner unter
dem Triumphbogen entsprach — erhob
sich das große Kruzifix. Um 1599—1600
wurde neben der Schnecke querüber eine-
Empore für die Singeschüler gebaut,
welche zu derselben mittelst einer Treppe
gelangten, die an dem untersten Chor-
pfeiler auf der Südseite auswärts im
Seitenschiffe angebracht und durch die
in Rede stehende Thür abgeschlossen war. Die Empore
ist, soweit ihre Herstellung nicht Sache des Zimmermanns
war, von dem Tischler Samuel Regenfart verfertigt worden;
die Thür trägt die Jahreszahl 1614. Um 1830, als durch den
damaligen Kirchenvorstand allerlei „Verbesserungen" im
Sinne jener Zeit vorgenommen wurden, beseitigte man im
wesentlichen die Schnecken, sowie auch Empore und Treppe;
leztere wurden an die Stelle gebracht, wo sie sich jetzt be-
findet, die Brustwehr der Empore aber in die Materialien-
kammer gestellt. Erst bei der Wiederherstellung des Gottes-
hauses im Jahre 1888 gelangten diese Stücke wieder zu Ehren;
die graue Farbe, mit welcher das Portal, wie alles Holzwerk,
überstrichen war, wurde abgewaschen, die schadhaften Teile
ausgebessert und die Brustwehr wieder zu einer Orgelempore
verwendet. Seither zeigt sich unsere Thür in ihrer alten
Schönheit und erfreut den kunstsinnigen Beschauer durch ihre
harmonischen Verhältnisse wie durch ihren reichen Schmuck
an Schnitzwerk und eingelegter Arbeit. — Ad. M. IL
Einzelteil des Riegels auf Seite 57
Zu den Tafeln. Dem gegenwärtigen Hefte liegt eine
Abbildung eines geschnitzten Spiegelrahmens aus Südtirol
bei, den wir im Anschluss an den Aufsatz über den Wand-
leuchter in Bozen, Heft 5, veröffentlichen. Es ist ein Pracht-
stück alter Schnitzkunst, das durch leichte Vergoldung und
natürliche Bemalung der Putten ungemein reich wirkt. Das
Stück wird im Handelsmuseum zu Wien aufbewahrt und
stammt mutmaßlich aus Italien. — Ein Meisterstück moderner
Schmiedekunst ist die beigegebene Standuhr von Paul Mar-
cus in Berlin. Der Entwurf ist frei und leicht, die Verbin-
bindung der Renaissancemotive mit naturalistischem Orna-
ment sehr harmonisch; das Ganze macht einen wahrhaft
eleganten Eindruck. Wie viel luftiger und zierlicher wirkt
solches Schmiedewerk, als die beliebten modernen vierecki-
gen Regulatoren, von deren langweiliger Form wir, wie es
scheint, gar nicht loskommen können! Wie viel mehr be-
friedigt hier das feine Linienspiel, der Wechsel der Ausla-
dungen und Einschnürungen, das von aller Schwerfälligkeit
freie Füllwerk! An solchen Beispielen erkennt man, dass
das so viel gescholtene moderne Kunstgewerbe langsam
vorwärts kommt und gar nicht den
herben Tadel verdient, der ihm fort-
während entgegengehalten wird. Es ist
wahr, dass man in unserem Jahrzehnt
viel mehr Schlechtes als Gutes produzirt;
aber das war doch zu allen Zeiten so
und was wir heute (von früheren Jahr-
hunderten sehen, ist nur das Auserlesene.
— Als dritte Beilage fügen wir noch
eine jener überaus anmutigen Erfindun-
gen des Direktors der badischen Kunst-
gewerbeschule Herrn. Götz diesem Hefte
bei, von denen wir unseren Lesern schon
öfter Proben geboten haben. Der figür-
liche Schmuck des Bürklinschen Tafel-
aufsatzes ist der griechischen Mythologie
entlehnt und zwar sind es die Geschöpfe
des Meeres, die allenthalben ihr munteres
Spiel treiben. Geflügelte Seepferde, auf
denen Putten, mit Harpunen bewehrt,
reiten, muscheltragende Najaden grup-
piren sich um einen zierlichen Sockel,
auf dem ein Kentaur bemüht ist, seine
süße Last — eine Silberschale, die zur
Aufnahme von Früchten, Konfekt n. s. w. bestimmt ist —
zu tragen. Auf dem obersten Knauf sitzt ein Putto mit dem
Dreizack und bietet eine Seeknackmandel, nämlich eine
Muschel dem Beschauer dar.
Berichtigung. Nach einer gefälligen Mitteilung des
Kgl. Hausmarschallamtes in Dresden trägt der im Besitz
König Alberts befindliche Gobelin mit dem Bildnis Karls V.
nicht, wie in den Berichten der Deutschen Gesellschaft zu
Leipzig (Bd. 8) angegeben ist, die Jahreszahl 1554, sondern
1545, außerdem auch noch die Inschrift: KAROL9 5.
DEL GRA. ROM. IMP. SEP. (d. i. semper) AVGVST9
HISPANARVM. REX. S. B. Es kann also kein Zweifel
darüber sein, dass dieser Gobelin derselbe ist, der 1547 zu
einer Ausschmückung des Leipziger Rathaussaales von dem
Verfertiger, Seger Bombeck, entliehen wurde.
Leipzig. O. W.