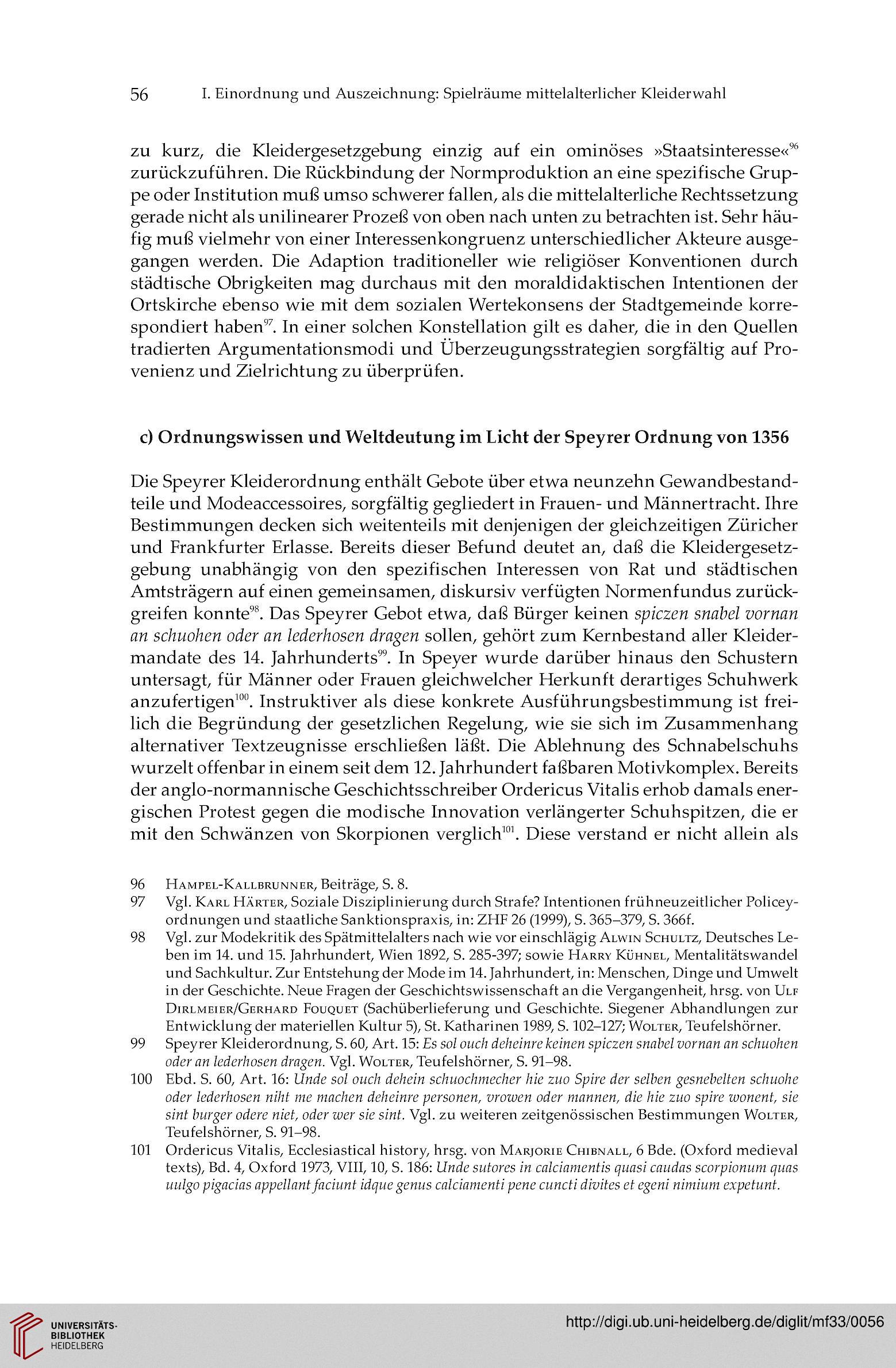56
I. Einordnung und Auszeichnung: Spielräume mittelalterlicher Kleiderwahl
zu kurz, die Kleidergesetzgebung einzig auf ein ominöses »Staatsinteresse«96
zurückzuführen. Die Rückbindung der Normproduktion an eine spezifische Grup-
pe oder Institution muß umso schwerer fallen, als die mittelalterliche Rechtssetzung
gerade nicht als unilinearer Prozeß von oben nach unten zu betrachten ist. Sehr häu-
fig muß vielmehr von einer Interessenkongruenz unterschiedlicher Akteure ausge-
gangen werden. Die Adaption traditioneller wie religiöser Konventionen durch
städtische Obrigkeiten mag durchaus mit den moraldidaktischen Intentionen der
Ortskirche ebenso wie mit dem sozialen Wertekonsens der Stadtgemeinde korre-
spondiert haben97. In einer solchen Konstellation gilt es daher, die in den Quellen
tradierten Argumentationsmodi und Überzeugungsstrategien sorgfältig auf Pro-
venienz und Zielrichtung zu überprüfen.
c) Ordnungswissen und Weltdeutung im Licht der Speyrer Ordnung von 1356
Die Speyrer Kleiderordnung enthält Gebote über etwa neunzehn Gewandbestand-
teile und Modeaccessoires, sorgfältig gegliedert in Frauen- und Männertracht. Ihre
Bestimmungen decken sich weitenteils mit denjenigen der gleichzeitigen Züricher
und Frankfurter Erlasse. Bereits dieser Befund deutet an, daß die Kleidergesetz-
gebung unabhängig von den spezifischen Interessen von Rat und städtischen
Amtsträgern auf einen gemeinsamen, diskursiv verfügten Normenfundus zurück-
greifen konnte98. Das Speyrer Gebot etwa, daß Bürger keinen spiczen snabel vornan
an schuohen oder an lederhosen dragen sollen, gehört zum Kernbestand aller Kleider-
mandate des 14. Jahrhunderts99. In Speyer wurde darüber hinaus den Schustern
untersagt, für Männer oder Frauen gleichwelcher Herkunft derartiges Schuhwerk
anzufertigen100. Instruktiver als diese konkrete Ausführungsbestimmung ist frei-
lich die Begründung der gesetzlichen Regelung, wie sie sich im Zusammenhang
alternativer Textzeugnisse erschließen läßt. Die Ablehnung des Schnabelschuhs
wurzelt offenbar in einem seit dem 12. Jahrhundert faßbaren Motivkomplex. Bereits
der anglo-normannische Geschichtsschreiber Ordericus Vitalis erhob damals ener-
gischen Protest gegen die modische Innovation verlängerter Schuhspitzen, die er
mit den Schwänzen von Skorpionen verglich101. Diese verstand er nicht allein als
96 Hampel-Kallbrunner, Beiträge, S. 8.
97 Vgl. Karl Härter, Soziale Disziplinierung durch Strafe? Intentionen frühneuzeitlicher Policey-
ordnungen und staatliche Sanktionspraxis, in: ZHF 26 (1999), S. 365-379, S. 366f.
98 Vgl. zur Modekritik des Spätmittelalters nach wie vor einschlägig Alwin Schultz, Deutsches Le-
ben im 14. und 15. Jahrhundert, Wien 1892, S. 285-397; sowie Harry Kühnel, Mentalitätswandel
und Sachkultur. Zur Entstehung der Mode im 14. Jahrhundert, in: Menschen, Dinge und Umwelt
in der Geschichte. Neue Fragen der Geschichtswissenschaft an die Vergangenheit, hrsg. von Ulf
Dirlmeier/Gerhard Fouquet (Sachüberlieferung und Geschichte. Siegener Abhandlungen zur
Entwicklung der materiellen Kultur 5), St. Katharinen 1989, S. 102-127; Wolter, Teufelshörner.
99 Speyrer Kleiderordnung, S. 60, Art. 15: Es sol ouch deheinre keinen spiczen snabel vornan an schuohen
oder an lederhosen dragen. Vgl. Wolter, Teufelshörner, S. 91-98.
100 Ebd. S. 60, Art. 16: Unde sol ouch dehein schuochmecher hie zuo Spire der selben gesnebelten schuohe
oder lederhosen niht me machen deheinre personen, vrowen oder mannen, die hie zuo spire wonent, sie
sint burger odere niet, oder wer sie sint. Vgl. zu weiteren zeitgenössischen Bestimmungen Wolter,
Teufelshörner, S. 91-98.
101 Ordericus Vitalis, Ecclesiastical history, hrsg. von Marjorie Chibnall, 6 Bde. (Oxford medieval
texts). Bd. 4, Oxford 1973, Vili, 10, S. 186: Unde sutores in calciamentis quasi caudas scorpionum quas
uulgo pigacias appellant faciunt idque genus calciamenti pene cuncti divites et egeni nimium expetunt.
I. Einordnung und Auszeichnung: Spielräume mittelalterlicher Kleiderwahl
zu kurz, die Kleidergesetzgebung einzig auf ein ominöses »Staatsinteresse«96
zurückzuführen. Die Rückbindung der Normproduktion an eine spezifische Grup-
pe oder Institution muß umso schwerer fallen, als die mittelalterliche Rechtssetzung
gerade nicht als unilinearer Prozeß von oben nach unten zu betrachten ist. Sehr häu-
fig muß vielmehr von einer Interessenkongruenz unterschiedlicher Akteure ausge-
gangen werden. Die Adaption traditioneller wie religiöser Konventionen durch
städtische Obrigkeiten mag durchaus mit den moraldidaktischen Intentionen der
Ortskirche ebenso wie mit dem sozialen Wertekonsens der Stadtgemeinde korre-
spondiert haben97. In einer solchen Konstellation gilt es daher, die in den Quellen
tradierten Argumentationsmodi und Überzeugungsstrategien sorgfältig auf Pro-
venienz und Zielrichtung zu überprüfen.
c) Ordnungswissen und Weltdeutung im Licht der Speyrer Ordnung von 1356
Die Speyrer Kleiderordnung enthält Gebote über etwa neunzehn Gewandbestand-
teile und Modeaccessoires, sorgfältig gegliedert in Frauen- und Männertracht. Ihre
Bestimmungen decken sich weitenteils mit denjenigen der gleichzeitigen Züricher
und Frankfurter Erlasse. Bereits dieser Befund deutet an, daß die Kleidergesetz-
gebung unabhängig von den spezifischen Interessen von Rat und städtischen
Amtsträgern auf einen gemeinsamen, diskursiv verfügten Normenfundus zurück-
greifen konnte98. Das Speyrer Gebot etwa, daß Bürger keinen spiczen snabel vornan
an schuohen oder an lederhosen dragen sollen, gehört zum Kernbestand aller Kleider-
mandate des 14. Jahrhunderts99. In Speyer wurde darüber hinaus den Schustern
untersagt, für Männer oder Frauen gleichwelcher Herkunft derartiges Schuhwerk
anzufertigen100. Instruktiver als diese konkrete Ausführungsbestimmung ist frei-
lich die Begründung der gesetzlichen Regelung, wie sie sich im Zusammenhang
alternativer Textzeugnisse erschließen läßt. Die Ablehnung des Schnabelschuhs
wurzelt offenbar in einem seit dem 12. Jahrhundert faßbaren Motivkomplex. Bereits
der anglo-normannische Geschichtsschreiber Ordericus Vitalis erhob damals ener-
gischen Protest gegen die modische Innovation verlängerter Schuhspitzen, die er
mit den Schwänzen von Skorpionen verglich101. Diese verstand er nicht allein als
96 Hampel-Kallbrunner, Beiträge, S. 8.
97 Vgl. Karl Härter, Soziale Disziplinierung durch Strafe? Intentionen frühneuzeitlicher Policey-
ordnungen und staatliche Sanktionspraxis, in: ZHF 26 (1999), S. 365-379, S. 366f.
98 Vgl. zur Modekritik des Spätmittelalters nach wie vor einschlägig Alwin Schultz, Deutsches Le-
ben im 14. und 15. Jahrhundert, Wien 1892, S. 285-397; sowie Harry Kühnel, Mentalitätswandel
und Sachkultur. Zur Entstehung der Mode im 14. Jahrhundert, in: Menschen, Dinge und Umwelt
in der Geschichte. Neue Fragen der Geschichtswissenschaft an die Vergangenheit, hrsg. von Ulf
Dirlmeier/Gerhard Fouquet (Sachüberlieferung und Geschichte. Siegener Abhandlungen zur
Entwicklung der materiellen Kultur 5), St. Katharinen 1989, S. 102-127; Wolter, Teufelshörner.
99 Speyrer Kleiderordnung, S. 60, Art. 15: Es sol ouch deheinre keinen spiczen snabel vornan an schuohen
oder an lederhosen dragen. Vgl. Wolter, Teufelshörner, S. 91-98.
100 Ebd. S. 60, Art. 16: Unde sol ouch dehein schuochmecher hie zuo Spire der selben gesnebelten schuohe
oder lederhosen niht me machen deheinre personen, vrowen oder mannen, die hie zuo spire wonent, sie
sint burger odere niet, oder wer sie sint. Vgl. zu weiteren zeitgenössischen Bestimmungen Wolter,
Teufelshörner, S. 91-98.
101 Ordericus Vitalis, Ecclesiastical history, hrsg. von Marjorie Chibnall, 6 Bde. (Oxford medieval
texts). Bd. 4, Oxford 1973, Vili, 10, S. 186: Unde sutores in calciamentis quasi caudas scorpionum quas
uulgo pigacias appellant faciunt idque genus calciamenti pene cuncti divites et egeni nimium expetunt.