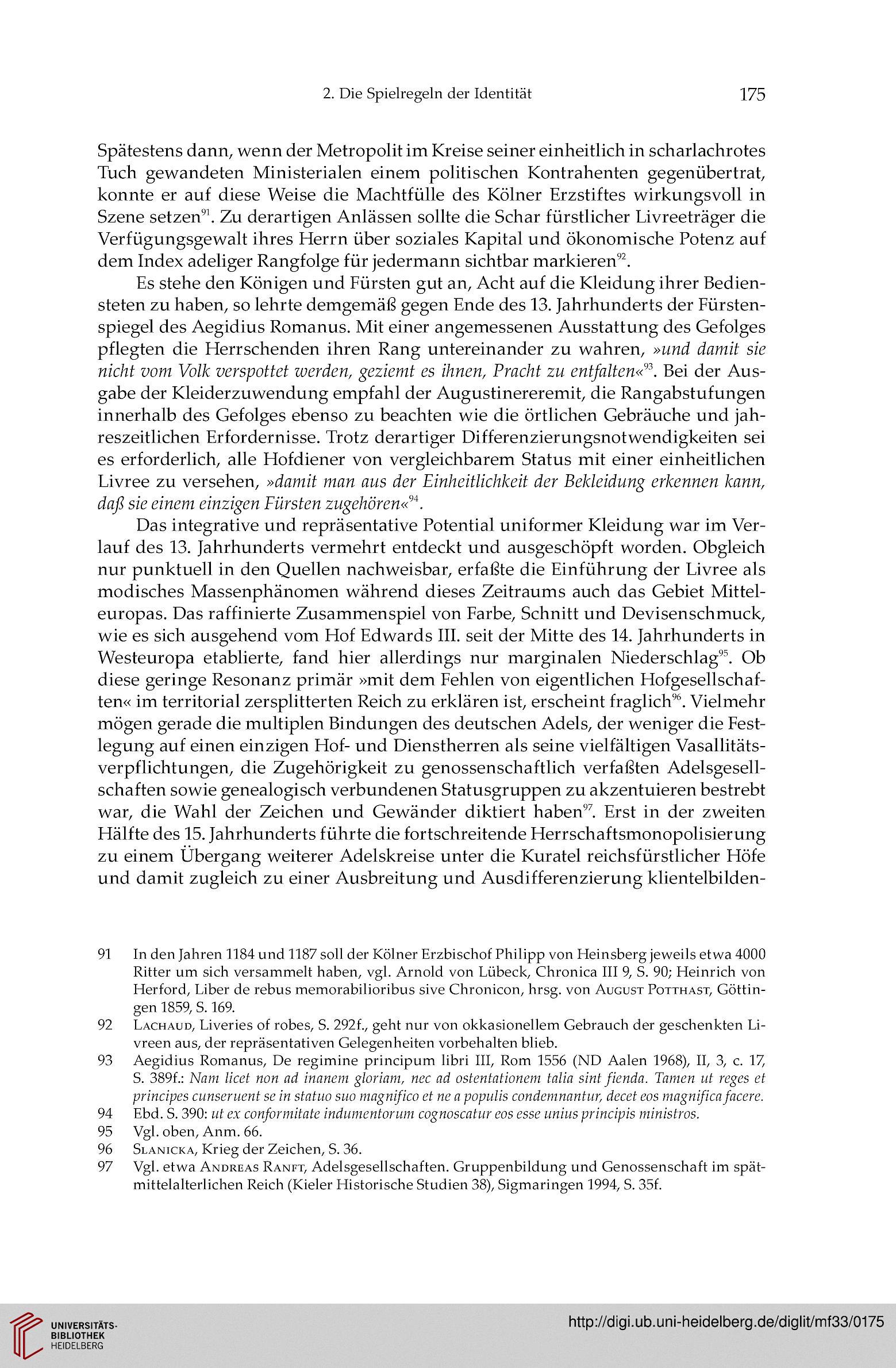2. Die Spielregeln der Identität
175
Spätestens dann, wenn der Metropolit im Kreise seiner einheitlich in scharlachrotes
Tuch gewandeten Ministerialen einem politischen Kontrahenten gegenübertrat,
konnte er auf diese Weise die Machtfülle des Kölner Erzstiftes wirkungsvoll in
Szene setzen91. Zu derartigen Anlässen sollte die Schar fürstlicher Livreeträger die
Verfügungsgewalt ihres Herrn über soziales Kapital und ökonomische Potenz auf
dem Index adeliger Rangfolge für jedermann sichtbar markieren92.
Es stehe den Königen und Fürsten gut an. Acht auf die Kleidung ihrer Bedien-
steten zu haben, so lehrte demgemäß gegen Ende des 13. Jahrhunderts der Fürsten-
spiegel des Aegidius Romanus. Mit einer angemessenen Ausstattung des Gefolges
pflegten die Herrschenden ihren Rang untereinander zu wahren, »und damit sie
nicht vom Volk verspottet werden, geziemt es ihnen, Pracht zu entfalten«93. Bei der Aus-
gabe der Kleiderzuwendung empfahl der Augustinereremit, die Rangabstufungen
innerhalb des Gefolges ebenso zu beachten wie die örtlichen Gebräuche und jah-
reszeitlichen Erfordernisse. Trotz derartiger Differenzierungsnotwendigkeiten sei
es erforderlich, alle Hofdiener von vergleichbarem Status mit einer einheitlichen
Livree zu versehen, »damit man aus der Einheitlichkeit der Bekleidung erkennen kann,
daß sie einem einzigen Fürsten zugehören«94.
Das integrative und repräsentative Potential uniformer Kleidung war im Ver-
lauf des 13. Jahrhunderts vermehrt entdeckt und ausgeschöpft worden. Obgleich
nur punktuell in den Quellen nachweisbar, erfaßte die Einführung der Livree als
modisches Massenphänomen während dieses Zeitraums auch das Gebiet Mittel-
europas. Das raffinierte Zusammenspiel von Farbe, Schnitt und Devisenschmuck,
wie es sich ausgehend vom Hof Edwards III. seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in
Westeuropa etablierte, fand hier allerdings nur marginalen Niederschlag95. Ob
diese geringe Resonanz primär »mit dem Fehlen von eigentlichen Hofgesellschaf-
ten« im territorial zersplitterten Reich zu erklären ist, erscheint fraglich96. Vielmehr
mögen gerade die multiplen Bindungen des deutschen Adels, der weniger die Fest-
legung auf einen einzigen Hof- und Dienstherren als seine vielfältigen Vasallitäts-
verpflichtungen, die Zugehörigkeit zu genossenschaftlich verfaßten Adelsgesell-
schaften sowie genealogisch verbundenen Statusgruppen zu akzentuieren bestrebt
war, die Wahl der Zeichen und Gewänder diktiert haben97. Erst in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts führte die fortschreitende Herrschaftsmonopolisierung
zu einem Übergang weiterer Adelskreise unter die Kuratel reichsfürstlicher Höfe
und damit zugleich zu einer Ausbreitung und Ausdifferenzierung klientelbilden-
91 In den Jahren 1184 und 1187 soll der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg jeweils etwa 4000
Ritter um sich versammelt haben, vgl. Arnold von Lübeck, Chronica III 9, S. 90; Heinrich von
Herford, Liber de rebus memorabilioribus sive Chronicon, hrsg. von August Potthast, Göttin-
gen 1859, S. 169.
92 Lachaud, Liveries of robes, S. 292f., geht nur von okkasionellem Gebrauch der geschenkten Li-
vreen aus, der repräsentativen Gelegenheiten Vorbehalten blieb.
93 Aegidius Romanus, De regimine principum libri III, Rom 1556 (ND Aalen 1968), II, 3, c. 17,
S. 389f.: Nani licet non ad inanem gloriam, nec ad ostentationem talia sint fienda. Tamen ut reges et
principes cunseruent se in statuo suo magnifico et ne a populis condemnantur, decet eos magnifica facere.
94 Ebd. S. 390: ut ex conformitate indumentorum cognoscatur eos esse unius principis ministros.
95 Vgl. oben, Anm. 66.
96 Slanicka, Krieg der Zeichen, S. 36.
97 Vgl. etwa Andreas Ranft, Adelsgesellschaften. Gruppenbildung und Genossenschaft im spät-
mittelalterlichen Reich (Kieler Historische Studien 38), Sigmaringen 1994, S. 35f.
175
Spätestens dann, wenn der Metropolit im Kreise seiner einheitlich in scharlachrotes
Tuch gewandeten Ministerialen einem politischen Kontrahenten gegenübertrat,
konnte er auf diese Weise die Machtfülle des Kölner Erzstiftes wirkungsvoll in
Szene setzen91. Zu derartigen Anlässen sollte die Schar fürstlicher Livreeträger die
Verfügungsgewalt ihres Herrn über soziales Kapital und ökonomische Potenz auf
dem Index adeliger Rangfolge für jedermann sichtbar markieren92.
Es stehe den Königen und Fürsten gut an. Acht auf die Kleidung ihrer Bedien-
steten zu haben, so lehrte demgemäß gegen Ende des 13. Jahrhunderts der Fürsten-
spiegel des Aegidius Romanus. Mit einer angemessenen Ausstattung des Gefolges
pflegten die Herrschenden ihren Rang untereinander zu wahren, »und damit sie
nicht vom Volk verspottet werden, geziemt es ihnen, Pracht zu entfalten«93. Bei der Aus-
gabe der Kleiderzuwendung empfahl der Augustinereremit, die Rangabstufungen
innerhalb des Gefolges ebenso zu beachten wie die örtlichen Gebräuche und jah-
reszeitlichen Erfordernisse. Trotz derartiger Differenzierungsnotwendigkeiten sei
es erforderlich, alle Hofdiener von vergleichbarem Status mit einer einheitlichen
Livree zu versehen, »damit man aus der Einheitlichkeit der Bekleidung erkennen kann,
daß sie einem einzigen Fürsten zugehören«94.
Das integrative und repräsentative Potential uniformer Kleidung war im Ver-
lauf des 13. Jahrhunderts vermehrt entdeckt und ausgeschöpft worden. Obgleich
nur punktuell in den Quellen nachweisbar, erfaßte die Einführung der Livree als
modisches Massenphänomen während dieses Zeitraums auch das Gebiet Mittel-
europas. Das raffinierte Zusammenspiel von Farbe, Schnitt und Devisenschmuck,
wie es sich ausgehend vom Hof Edwards III. seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in
Westeuropa etablierte, fand hier allerdings nur marginalen Niederschlag95. Ob
diese geringe Resonanz primär »mit dem Fehlen von eigentlichen Hofgesellschaf-
ten« im territorial zersplitterten Reich zu erklären ist, erscheint fraglich96. Vielmehr
mögen gerade die multiplen Bindungen des deutschen Adels, der weniger die Fest-
legung auf einen einzigen Hof- und Dienstherren als seine vielfältigen Vasallitäts-
verpflichtungen, die Zugehörigkeit zu genossenschaftlich verfaßten Adelsgesell-
schaften sowie genealogisch verbundenen Statusgruppen zu akzentuieren bestrebt
war, die Wahl der Zeichen und Gewänder diktiert haben97. Erst in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts führte die fortschreitende Herrschaftsmonopolisierung
zu einem Übergang weiterer Adelskreise unter die Kuratel reichsfürstlicher Höfe
und damit zugleich zu einer Ausbreitung und Ausdifferenzierung klientelbilden-
91 In den Jahren 1184 und 1187 soll der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg jeweils etwa 4000
Ritter um sich versammelt haben, vgl. Arnold von Lübeck, Chronica III 9, S. 90; Heinrich von
Herford, Liber de rebus memorabilioribus sive Chronicon, hrsg. von August Potthast, Göttin-
gen 1859, S. 169.
92 Lachaud, Liveries of robes, S. 292f., geht nur von okkasionellem Gebrauch der geschenkten Li-
vreen aus, der repräsentativen Gelegenheiten Vorbehalten blieb.
93 Aegidius Romanus, De regimine principum libri III, Rom 1556 (ND Aalen 1968), II, 3, c. 17,
S. 389f.: Nani licet non ad inanem gloriam, nec ad ostentationem talia sint fienda. Tamen ut reges et
principes cunseruent se in statuo suo magnifico et ne a populis condemnantur, decet eos magnifica facere.
94 Ebd. S. 390: ut ex conformitate indumentorum cognoscatur eos esse unius principis ministros.
95 Vgl. oben, Anm. 66.
96 Slanicka, Krieg der Zeichen, S. 36.
97 Vgl. etwa Andreas Ranft, Adelsgesellschaften. Gruppenbildung und Genossenschaft im spät-
mittelalterlichen Reich (Kieler Historische Studien 38), Sigmaringen 1994, S. 35f.