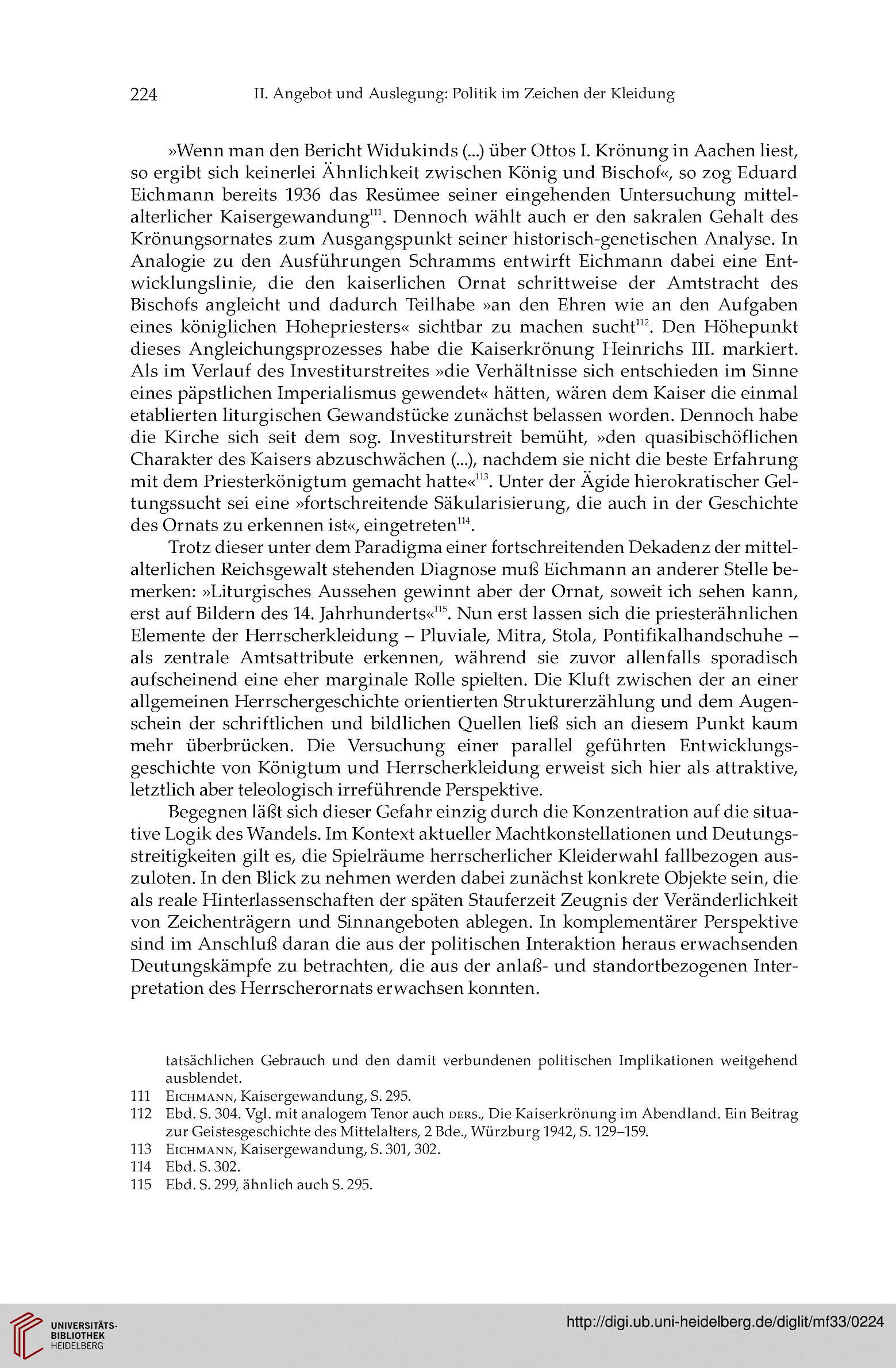224
II. Angebot und Auslegung: Politik im Zeichen der Kleidung
»Wenn man den Bericht Widukinds (...) über Ottos I. Krönung in Aachen liest,
so ergibt sich keinerlei Ähnlichkeit zwischen König und Bischof«, so zog Eduard
Eichmann bereits 1936 das Resümee seiner eingehenden Untersuchung mittel-
alterlicher Kaiser ge wandung111. Dennoch wählt auch er den sakralen Gehalt des
Krönungsornates zum Ausgangspunkt seiner historisch-genetischen Analyse. In
Analogie zu den Ausführungen Schramms entwirft Eichmann dabei eine Ent-
wicklungslinie, die den kaiserlichen Ornat schrittweise der Amtstracht des
Bischofs angleicht und dadurch Teilhabe »an den Ehren wie an den Aufgaben
eines königlichen Hohepriesters« sichtbar zu machen sucht112. Den Höhepunkt
dieses Angleichungsprozesses habe die Kaiserkrönung Heinrichs III. markiert.
Als im Verlauf des Investiturstreites »die Verhältnisse sich entschieden im Sinne
eines päpstlichen Imperialismus gewendet« hätten, wären dem Kaiser die einmal
etablierten liturgischen Gewandstücke zunächst belassen worden. Dennoch habe
die Kirche sich seit dem sog. Investiturstreit bemüht, »den quasibischöflichen
Charakter des Kaisers abzuschwächen (...), nachdem sie nicht die beste Erfahrung
mit dem Priesterkönigtum gemacht hatte«113. Unter der Ägide hierokratischer Gel-
tungssucht sei eine »fortschreitende Säkularisierung, die auch in der Geschichte
des Ornats zu erkennen ist«, eingetreten114.
Trotz dieser unter dem Paradigma einer fortschreitenden Dekadenz der mittel-
alterlichen Reichsgewalt stehenden Diagnose muß Eichmann an anderer Stelle be-
merken: »Liturgisches Aussehen gewinnt aber der Ornat, soweit ich sehen kann,
erst auf Bildern des 14. Jahrhunderts«115. Nun erst lassen sich die priesterähnlichen
Elemente der Herrscherkleidung - Pluviale, Mitra, Stola, Pontifikalhandschuhe -
als zentrale Amtsattribute erkennen, während sie zuvor allenfalls sporadisch
aufscheinend eine eher marginale Rolle spielten. Die Kluft zwischen der an einer
allgemeinen Herrschergeschichte orientierten Strukturerzählung und dem Augen-
schein der schriftlichen und bildlichen Quellen ließ sich an diesem Punkt kaum
mehr überbrücken. Die Versuchung einer parallel geführten Entwicklungs-
geschichte von Königtum und Herrscherkleidung erweist sich hier als attraktive,
letztlich aber teleologisch irreführende Perspektive.
Begegnen läßt sich dieser Gefahr einzig durch die Konzentration auf die situa-
tive Logik des Wandels. Im Kontext aktueller Machtkonstellationen und Deutungs-
streitigkeiten gilt es, die Spielräume herrscherlicher Kleiderwahl fallbezogen aus-
zuloten. In den Blick zu nehmen werden dabei zunächst konkrete Objekte sein, die
als reale Hinterlassenschaften der späten Stauferzeit Zeugnis der Veränderlichkeit
von Zeichenträgern und Sinnangeboten ablegen. In komplementärer Perspektive
sind im Anschluß daran die aus der politischen Interaktion heraus erwachsenden
Deutungskämpfe zu betrachten, die aus der anlaß- und standortbezogenen Inter-
pretation des Herrscherornats erwachsen konnten.
tatsächlichen Gebrauch und den damit verbundenen politischen Implikationen weitgehend
ausblendet.
111 Eichmann, Kaisergewandung, S. 295.
112 Ebd. S. 304. Vgl. mit analogem Tenor auch ders.. Die Kaiserkrönung im Abendland. Ein Beitrag
zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 2 Bde., Würzburg 1942, S. 129-159.
113 Eichmann, Kaisergewandung, S. 301, 302.
114 Ebd. S. 302.
115 Ebd. S. 299, ähnlich auch S. 295.
II. Angebot und Auslegung: Politik im Zeichen der Kleidung
»Wenn man den Bericht Widukinds (...) über Ottos I. Krönung in Aachen liest,
so ergibt sich keinerlei Ähnlichkeit zwischen König und Bischof«, so zog Eduard
Eichmann bereits 1936 das Resümee seiner eingehenden Untersuchung mittel-
alterlicher Kaiser ge wandung111. Dennoch wählt auch er den sakralen Gehalt des
Krönungsornates zum Ausgangspunkt seiner historisch-genetischen Analyse. In
Analogie zu den Ausführungen Schramms entwirft Eichmann dabei eine Ent-
wicklungslinie, die den kaiserlichen Ornat schrittweise der Amtstracht des
Bischofs angleicht und dadurch Teilhabe »an den Ehren wie an den Aufgaben
eines königlichen Hohepriesters« sichtbar zu machen sucht112. Den Höhepunkt
dieses Angleichungsprozesses habe die Kaiserkrönung Heinrichs III. markiert.
Als im Verlauf des Investiturstreites »die Verhältnisse sich entschieden im Sinne
eines päpstlichen Imperialismus gewendet« hätten, wären dem Kaiser die einmal
etablierten liturgischen Gewandstücke zunächst belassen worden. Dennoch habe
die Kirche sich seit dem sog. Investiturstreit bemüht, »den quasibischöflichen
Charakter des Kaisers abzuschwächen (...), nachdem sie nicht die beste Erfahrung
mit dem Priesterkönigtum gemacht hatte«113. Unter der Ägide hierokratischer Gel-
tungssucht sei eine »fortschreitende Säkularisierung, die auch in der Geschichte
des Ornats zu erkennen ist«, eingetreten114.
Trotz dieser unter dem Paradigma einer fortschreitenden Dekadenz der mittel-
alterlichen Reichsgewalt stehenden Diagnose muß Eichmann an anderer Stelle be-
merken: »Liturgisches Aussehen gewinnt aber der Ornat, soweit ich sehen kann,
erst auf Bildern des 14. Jahrhunderts«115. Nun erst lassen sich die priesterähnlichen
Elemente der Herrscherkleidung - Pluviale, Mitra, Stola, Pontifikalhandschuhe -
als zentrale Amtsattribute erkennen, während sie zuvor allenfalls sporadisch
aufscheinend eine eher marginale Rolle spielten. Die Kluft zwischen der an einer
allgemeinen Herrschergeschichte orientierten Strukturerzählung und dem Augen-
schein der schriftlichen und bildlichen Quellen ließ sich an diesem Punkt kaum
mehr überbrücken. Die Versuchung einer parallel geführten Entwicklungs-
geschichte von Königtum und Herrscherkleidung erweist sich hier als attraktive,
letztlich aber teleologisch irreführende Perspektive.
Begegnen läßt sich dieser Gefahr einzig durch die Konzentration auf die situa-
tive Logik des Wandels. Im Kontext aktueller Machtkonstellationen und Deutungs-
streitigkeiten gilt es, die Spielräume herrscherlicher Kleiderwahl fallbezogen aus-
zuloten. In den Blick zu nehmen werden dabei zunächst konkrete Objekte sein, die
als reale Hinterlassenschaften der späten Stauferzeit Zeugnis der Veränderlichkeit
von Zeichenträgern und Sinnangeboten ablegen. In komplementärer Perspektive
sind im Anschluß daran die aus der politischen Interaktion heraus erwachsenden
Deutungskämpfe zu betrachten, die aus der anlaß- und standortbezogenen Inter-
pretation des Herrscherornats erwachsen konnten.
tatsächlichen Gebrauch und den damit verbundenen politischen Implikationen weitgehend
ausblendet.
111 Eichmann, Kaisergewandung, S. 295.
112 Ebd. S. 304. Vgl. mit analogem Tenor auch ders.. Die Kaiserkrönung im Abendland. Ein Beitrag
zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 2 Bde., Würzburg 1942, S. 129-159.
113 Eichmann, Kaisergewandung, S. 301, 302.
114 Ebd. S. 302.
115 Ebd. S. 299, ähnlich auch S. 295.