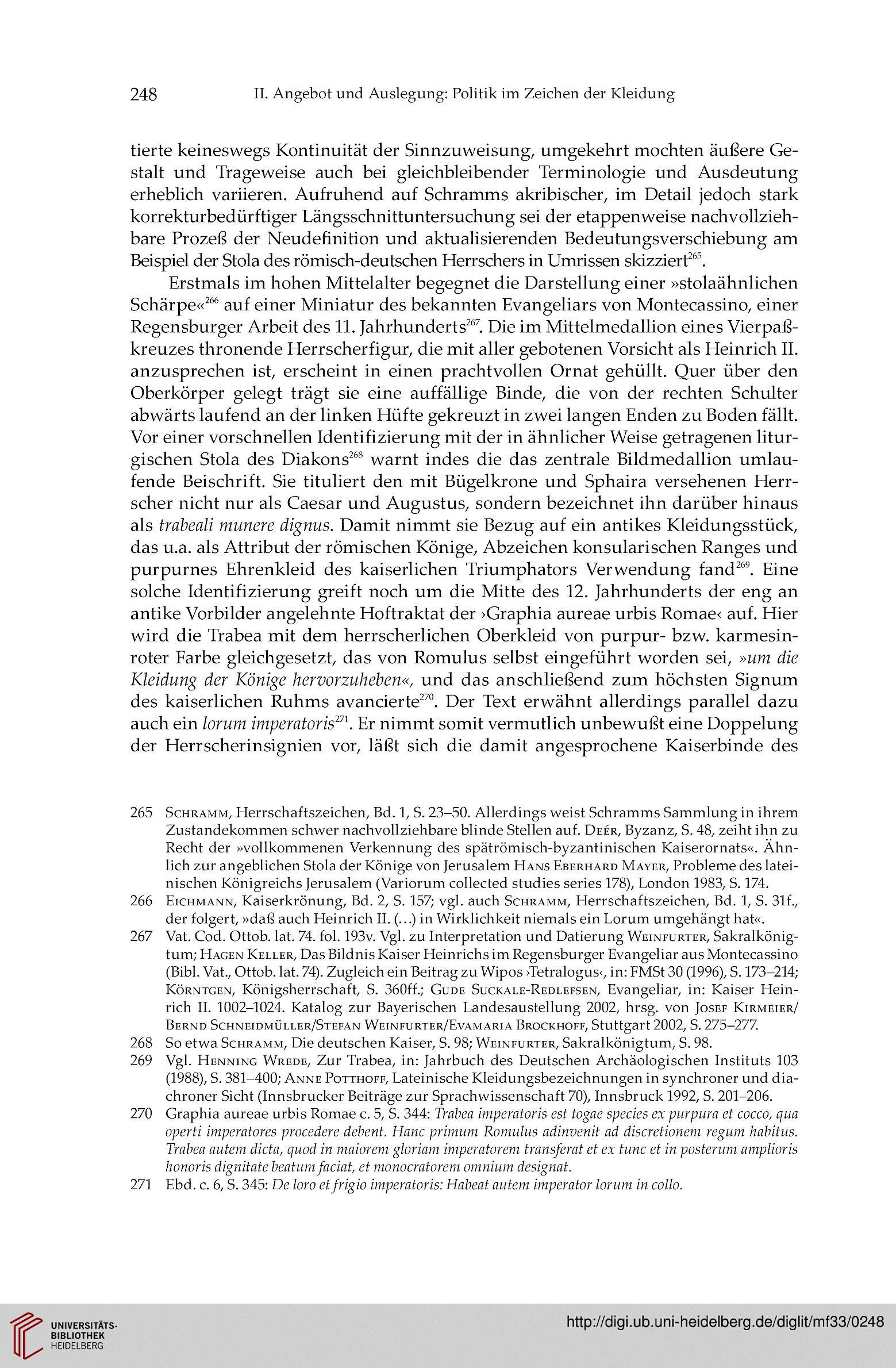248
II. Angebot und Auslegung: Politik im Zeichen der Kleidung
tierte keineswegs Kontinuität der Sinnzuweisung, umgekehrt mochten äußere Ge-
stalt und Trageweise auch bei gleichbleibender Terminologie und Ausdeutung
erheblich variieren. Aufruhend auf Schramms akribischer, im Detail jedoch stark
korrekturbedürftiger Längsschnittuntersuchung sei der etappenweise nachvollzieh-
bare Prozeß der Neudefinition und aktualisierenden Bedeutungsverschiebung am
Beispiel der Stola des römisch-deutschen Herrschers in Umrissen skizziert265.
Erstmals im hohen Mittelalter begegnet die Darstellung einer »stolaähnlichen
Schärpe«266 auf einer Miniatur des bekannten Evangeliars von Montecassino, einer
Regensburger Arbeit des 11. Jahrhunderts267. Die im Mittelmedallion eines Vierpaß-
kreuzes thronende Herr scher figur, die mit aller gebotenen Vorsicht als Heinrich II.
anzusprechen ist, erscheint in einen prachtvollen Ornat gehüllt. Quer über den
Oberkörper gelegt trägt sie eine auffällige Binde, die von der rechten Schulter
abwärts laufend an der linken Hüfte gekreuzt in zwei langen Enden zu Boden fällt.
Vor einer vorschnellen Identifizierung mit der in ähnlicher Weise getragenen litur-
gischen Stola des Diakons268 warnt indes die das zentrale Bildmedallion umlau-
fende Beischrift. Sie tituliert den mit Bügelkrone und Sphaira versehenen Herr-
scher nicht nur als Caesar und Augustus, sondern bezeichnet ihn darüber hinaus
als trabeali munere dignus. Damit nimmt sie Bezug auf ein antikes Kleidungsstück,
das u.a. als Attribut der römischen Könige, Abzeichen konsularischen Ranges und
purpurnes Ehrenkleid des kaiserlichen Triumphators Verwendung fand269. Eine
solche Identifizierung greift noch um die Mitte des 12. Jahrhunderts der eng an
antike Vorbilder angelehnte Hoftraktat der >Graphia aureae urbis Romae< auf. Hier
wird die Trabea mit dem herrscherlichen Oberkleid von purpur- bzw. karmesin-
roter Farbe gleichgesetzt, das von Romulus selbst eingeführt worden sei, »um die
Kleidung der Könige hervorzuheben«, und das anschließend zum höchsten Signum
des kaiserlichen Ruhms avancierte270. Der Text erwähnt allerdings parallel dazu
auch ein lorum imperatoris271. Er nimmt somit vermutlich unbewußt eine Doppelung
der Herr scher in signien vor, läßt sich die damit angesprochene Kaiserbinde des
265 Schramm, Herrschaftszeichen, Bd. 1, S. 23-50. Allerdings weist Schramms Sammlung in ihrem
Zustandekommen schwer nachvollziehbare blinde Stellen auf. Deér, Byzanz, S. 48, zeiht ihn zu
Recht der »vollkommenen Verkennung des spätrömisch-byzantinischen Kaiserornats«. Ähn-
lich zur angeblichen Stola der Könige von Jerusalem Hans Eberhard Mayer, Probleme des latei-
nischen Königreichs Jerusalem (Variorum collected studies series 178), London 1983, S. 174.
266 Eichmann, Kaiserkrönung, Bd. 2, S. 157; vgl. auch Schramm, Herrschaftszeichen, Bd. 1, S. 31f.,
der folgert, »daß auch Heinrich II. (...) in Wirklichkeit niemals ein Lorum umgehängt hat«.
267 Vat. Cod. Ottob. lat. 74. fol. 193v. Vgl. zu Interpretation und Datierung Weinfurter, Sakralkönig-
tum; Hagen Keller, Das Bildnis Kaiser Heinrichs im Regensburger Evangeliar aus Montecassino
(Bibi. Vat., Ottob. lat. 74). Zugleich ein Beitrag zu Wipos >Tetralogus<, in: FMSt 30 (1996), S. 173-214;
Körntgen, Königsherrschaft, S. 360ff.; Gude Suckale-Redlefsen, Evangeliar, in: Kaiser Hein-
rich II. 1002-1024. Katalog zur Bayerischen Landesaustellung 2002, hrsg. von Josef Kirmeier/
Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter/Evamaria Brockhoff, Stuttgart 2002, S. 275-277.
268 So etwa Schramm, Die deutschen Kaiser, S. 98; Weinfurter, Sakralkönigtum, S. 98.
269 Vgl. Henning Wrede, Zur Trabea, in: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 103
(1988), S. 381-400; Anne Potthoff, Lateinische Kleidungsbezeichnungen in synchroner und dia-
chroner Sicht (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 70), Innsbruck 1992, S. 201-206.
270 Graphia aureae urbis Romae c. 5, S. 344: Trabea imperatoris est togae species ex purpura et cocco, qua
operti imperatores procedere debent. Hanc primum Romulus adinvenit ad discretionem regum habitus.
Trabea autem dicta, quod in maiorem gloriam imperatorem transferat et ex tunc et in posterum amplioris
honoris dignitate beatum faciat, et monocratorem omnium designat.
271 Ebd. c. 6, S. 345: De loro et frigio imperatoris: Habeat autem imperator lorum in collo.
II. Angebot und Auslegung: Politik im Zeichen der Kleidung
tierte keineswegs Kontinuität der Sinnzuweisung, umgekehrt mochten äußere Ge-
stalt und Trageweise auch bei gleichbleibender Terminologie und Ausdeutung
erheblich variieren. Aufruhend auf Schramms akribischer, im Detail jedoch stark
korrekturbedürftiger Längsschnittuntersuchung sei der etappenweise nachvollzieh-
bare Prozeß der Neudefinition und aktualisierenden Bedeutungsverschiebung am
Beispiel der Stola des römisch-deutschen Herrschers in Umrissen skizziert265.
Erstmals im hohen Mittelalter begegnet die Darstellung einer »stolaähnlichen
Schärpe«266 auf einer Miniatur des bekannten Evangeliars von Montecassino, einer
Regensburger Arbeit des 11. Jahrhunderts267. Die im Mittelmedallion eines Vierpaß-
kreuzes thronende Herr scher figur, die mit aller gebotenen Vorsicht als Heinrich II.
anzusprechen ist, erscheint in einen prachtvollen Ornat gehüllt. Quer über den
Oberkörper gelegt trägt sie eine auffällige Binde, die von der rechten Schulter
abwärts laufend an der linken Hüfte gekreuzt in zwei langen Enden zu Boden fällt.
Vor einer vorschnellen Identifizierung mit der in ähnlicher Weise getragenen litur-
gischen Stola des Diakons268 warnt indes die das zentrale Bildmedallion umlau-
fende Beischrift. Sie tituliert den mit Bügelkrone und Sphaira versehenen Herr-
scher nicht nur als Caesar und Augustus, sondern bezeichnet ihn darüber hinaus
als trabeali munere dignus. Damit nimmt sie Bezug auf ein antikes Kleidungsstück,
das u.a. als Attribut der römischen Könige, Abzeichen konsularischen Ranges und
purpurnes Ehrenkleid des kaiserlichen Triumphators Verwendung fand269. Eine
solche Identifizierung greift noch um die Mitte des 12. Jahrhunderts der eng an
antike Vorbilder angelehnte Hoftraktat der >Graphia aureae urbis Romae< auf. Hier
wird die Trabea mit dem herrscherlichen Oberkleid von purpur- bzw. karmesin-
roter Farbe gleichgesetzt, das von Romulus selbst eingeführt worden sei, »um die
Kleidung der Könige hervorzuheben«, und das anschließend zum höchsten Signum
des kaiserlichen Ruhms avancierte270. Der Text erwähnt allerdings parallel dazu
auch ein lorum imperatoris271. Er nimmt somit vermutlich unbewußt eine Doppelung
der Herr scher in signien vor, läßt sich die damit angesprochene Kaiserbinde des
265 Schramm, Herrschaftszeichen, Bd. 1, S. 23-50. Allerdings weist Schramms Sammlung in ihrem
Zustandekommen schwer nachvollziehbare blinde Stellen auf. Deér, Byzanz, S. 48, zeiht ihn zu
Recht der »vollkommenen Verkennung des spätrömisch-byzantinischen Kaiserornats«. Ähn-
lich zur angeblichen Stola der Könige von Jerusalem Hans Eberhard Mayer, Probleme des latei-
nischen Königreichs Jerusalem (Variorum collected studies series 178), London 1983, S. 174.
266 Eichmann, Kaiserkrönung, Bd. 2, S. 157; vgl. auch Schramm, Herrschaftszeichen, Bd. 1, S. 31f.,
der folgert, »daß auch Heinrich II. (...) in Wirklichkeit niemals ein Lorum umgehängt hat«.
267 Vat. Cod. Ottob. lat. 74. fol. 193v. Vgl. zu Interpretation und Datierung Weinfurter, Sakralkönig-
tum; Hagen Keller, Das Bildnis Kaiser Heinrichs im Regensburger Evangeliar aus Montecassino
(Bibi. Vat., Ottob. lat. 74). Zugleich ein Beitrag zu Wipos >Tetralogus<, in: FMSt 30 (1996), S. 173-214;
Körntgen, Königsherrschaft, S. 360ff.; Gude Suckale-Redlefsen, Evangeliar, in: Kaiser Hein-
rich II. 1002-1024. Katalog zur Bayerischen Landesaustellung 2002, hrsg. von Josef Kirmeier/
Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter/Evamaria Brockhoff, Stuttgart 2002, S. 275-277.
268 So etwa Schramm, Die deutschen Kaiser, S. 98; Weinfurter, Sakralkönigtum, S. 98.
269 Vgl. Henning Wrede, Zur Trabea, in: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 103
(1988), S. 381-400; Anne Potthoff, Lateinische Kleidungsbezeichnungen in synchroner und dia-
chroner Sicht (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 70), Innsbruck 1992, S. 201-206.
270 Graphia aureae urbis Romae c. 5, S. 344: Trabea imperatoris est togae species ex purpura et cocco, qua
operti imperatores procedere debent. Hanc primum Romulus adinvenit ad discretionem regum habitus.
Trabea autem dicta, quod in maiorem gloriam imperatorem transferat et ex tunc et in posterum amplioris
honoris dignitate beatum faciat, et monocratorem omnium designat.
271 Ebd. c. 6, S. 345: De loro et frigio imperatoris: Habeat autem imperator lorum in collo.