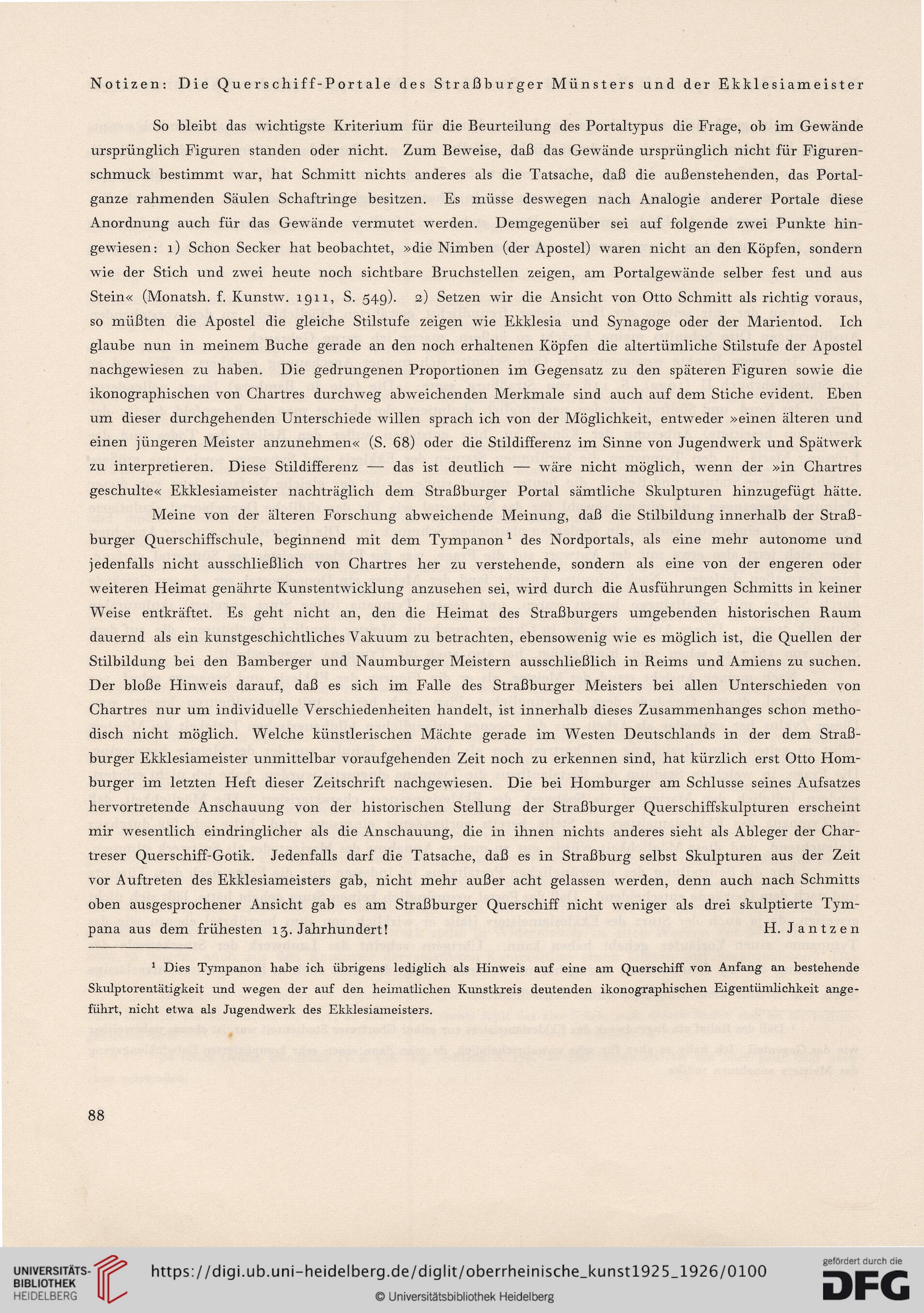Notizen: Die Querschiff-Portale des Straßburger Münsters und der Ekklesiameister
So bleibt das wichtigste Kriterium für die Beurteilung des Portaltypus die Frage, ob im Gewände
ursprünglich Figuren standen oder nicht. Zum Beweise, daß das Gewände ursprünglich nicht für Figuren-
schmuck bestimmt war, hat Schmitt nichts anderes als die Tatsache, daß die außenstehenden, das Portal-
ganze rahmenden Säulen Schaftringe besitzen. Es müsse deswegen nach Analogie anderer Portale diese
Anordnung auch für das Gewände vermutet werden. Demgegenüber sei auf folgende zwei Punkte hin-
gewiesen: i) Schon Secker hat beobachtet, »die Nimben (der Apostel) waren nicht an den Köpfen, sondern
wie der Stich und zwei heute noch sichtbare Bruchstellen zeigen, am Portalgewände selber fest und aus
Stein« (Monatsh. f. Kunstw. 1911, S. 549). 2) Setzen wir die Ansicht von Otto Schmitt als richtig voraus,
so müßten die Apostel die gleiche Stilstufe zeigen wie Ekklesia und Synagoge oder der Marientod. Ich
glaube nun in meinem Buche gerade an den noch erhaltenen Köpfen die altertümliche Stilstufe der Apostel
nachgewiesen zu haben. Die gedrungenen Proportionen im Gegensatz zu den späteren Figuren sowie die
ikonographischen von Chartres durchweg abweichenden Merkmale sind auch auf dem Stiche evident. Eben
um dieser durchgehenden Unterschiede willen sprach ich von der Möglichkeit, entweder »einen älteren und
einen jüngeren Meister anzunehmen« (S. 68) oder die Stildifferenz im Sinne von Jugendwerk und Spätwerk
zu interpretieren. Diese Stildifferenz — das ist deutlich — wäre nicht möglich, wenn der »in Chartres
geschulte« Ekklesiameister nachträglich dem Straßburger Portal sämtliche Skulpturen hinzugefügt hätte.
Meine von der älteren Forschung abweichende Meinung, daß die Stilbildung innerhalb der Straß-
burger Querschiffschule, beginnend mit dem Tympanon1 des Nordportals, als eine mehr autonome und
jedenfalls nicht ausschließlich von Chartres her zu verstehende, sondern als eine von der engeren oder
weiteren Heimat genährte Kunstentwicklung anzusehen sei, wird durch die Ausführungen Schmitts in keiner
Weise entkräftet. Es geht nicht an, den die Heimat des Straßburgers umgebenden historischen Raum
dauernd als ein kunstgeschichtliches Vakuum zu betrachten, ebensowenig wie es möglich ist, die Quellen der
Stilbildung bei den Bamberger und Naumburger Meistern ausschließlich in Reims und Amiens zu suchen.
Der bloße Hinweis darauf, daß es sich im Falle des Straßburger Meisters bei allen Unterschieden von
Chartres nur um individuelle Verschiedenheiten handelt, ist innerhalb dieses Zusammenhanges schon metho-
disch nicht möglich. Welche künstlerischen Mächte gerade im Westen Deutschlands in der dem Straß-
burger Ekklesiameister unmittelbar voraufgehenden Zeit noch zu erkennen sind, hat kürzlich erst Otto Hom-
burger im letzten Heft dieser Zeitschrift nachgewiesen. Die bei Homburger am Schlüsse seines Aufsatzes
hervortretende Anschauung von der historischen Stellung der Straßburger Querschiffskulpturen erscheint
mir wesentlich eindringlicher als die Anschauung, die in ihnen nichts anderes sieht als Ableger der Char-
treser Querschiff-Gotik. Jedenfalls darf die Tatsache, daß es in Straßburg selbst Skulpturen aus der Zeit
vor Auftreten des Ekklesiameisters gab, nicht mehr außer acht gelassen werden, denn auch nach Schmitts
oben ausgesprochener Ansicht gab es am Straßburger Querschiff nicht weniger als drei skulptierte Tym-
pana aus dem frühesten 13. Jahrhundert! H. Jantzen
1 Dies Tympanon habe ich übrigens lediglich als Hinweis auf eine am Querschiff von Anfang an bestehende
Skulptorentätigkeit und wegen der auf den heimatlichen Kunstkreis deutenden ikonographischen Eigentümlichkeit ange-
führt, nicht etwa als Jugendwerk des Ekklesiameisters.
88
So bleibt das wichtigste Kriterium für die Beurteilung des Portaltypus die Frage, ob im Gewände
ursprünglich Figuren standen oder nicht. Zum Beweise, daß das Gewände ursprünglich nicht für Figuren-
schmuck bestimmt war, hat Schmitt nichts anderes als die Tatsache, daß die außenstehenden, das Portal-
ganze rahmenden Säulen Schaftringe besitzen. Es müsse deswegen nach Analogie anderer Portale diese
Anordnung auch für das Gewände vermutet werden. Demgegenüber sei auf folgende zwei Punkte hin-
gewiesen: i) Schon Secker hat beobachtet, »die Nimben (der Apostel) waren nicht an den Köpfen, sondern
wie der Stich und zwei heute noch sichtbare Bruchstellen zeigen, am Portalgewände selber fest und aus
Stein« (Monatsh. f. Kunstw. 1911, S. 549). 2) Setzen wir die Ansicht von Otto Schmitt als richtig voraus,
so müßten die Apostel die gleiche Stilstufe zeigen wie Ekklesia und Synagoge oder der Marientod. Ich
glaube nun in meinem Buche gerade an den noch erhaltenen Köpfen die altertümliche Stilstufe der Apostel
nachgewiesen zu haben. Die gedrungenen Proportionen im Gegensatz zu den späteren Figuren sowie die
ikonographischen von Chartres durchweg abweichenden Merkmale sind auch auf dem Stiche evident. Eben
um dieser durchgehenden Unterschiede willen sprach ich von der Möglichkeit, entweder »einen älteren und
einen jüngeren Meister anzunehmen« (S. 68) oder die Stildifferenz im Sinne von Jugendwerk und Spätwerk
zu interpretieren. Diese Stildifferenz — das ist deutlich — wäre nicht möglich, wenn der »in Chartres
geschulte« Ekklesiameister nachträglich dem Straßburger Portal sämtliche Skulpturen hinzugefügt hätte.
Meine von der älteren Forschung abweichende Meinung, daß die Stilbildung innerhalb der Straß-
burger Querschiffschule, beginnend mit dem Tympanon1 des Nordportals, als eine mehr autonome und
jedenfalls nicht ausschließlich von Chartres her zu verstehende, sondern als eine von der engeren oder
weiteren Heimat genährte Kunstentwicklung anzusehen sei, wird durch die Ausführungen Schmitts in keiner
Weise entkräftet. Es geht nicht an, den die Heimat des Straßburgers umgebenden historischen Raum
dauernd als ein kunstgeschichtliches Vakuum zu betrachten, ebensowenig wie es möglich ist, die Quellen der
Stilbildung bei den Bamberger und Naumburger Meistern ausschließlich in Reims und Amiens zu suchen.
Der bloße Hinweis darauf, daß es sich im Falle des Straßburger Meisters bei allen Unterschieden von
Chartres nur um individuelle Verschiedenheiten handelt, ist innerhalb dieses Zusammenhanges schon metho-
disch nicht möglich. Welche künstlerischen Mächte gerade im Westen Deutschlands in der dem Straß-
burger Ekklesiameister unmittelbar voraufgehenden Zeit noch zu erkennen sind, hat kürzlich erst Otto Hom-
burger im letzten Heft dieser Zeitschrift nachgewiesen. Die bei Homburger am Schlüsse seines Aufsatzes
hervortretende Anschauung von der historischen Stellung der Straßburger Querschiffskulpturen erscheint
mir wesentlich eindringlicher als die Anschauung, die in ihnen nichts anderes sieht als Ableger der Char-
treser Querschiff-Gotik. Jedenfalls darf die Tatsache, daß es in Straßburg selbst Skulpturen aus der Zeit
vor Auftreten des Ekklesiameisters gab, nicht mehr außer acht gelassen werden, denn auch nach Schmitts
oben ausgesprochener Ansicht gab es am Straßburger Querschiff nicht weniger als drei skulptierte Tym-
pana aus dem frühesten 13. Jahrhundert! H. Jantzen
1 Dies Tympanon habe ich übrigens lediglich als Hinweis auf eine am Querschiff von Anfang an bestehende
Skulptorentätigkeit und wegen der auf den heimatlichen Kunstkreis deutenden ikonographischen Eigentümlichkeit ange-
führt, nicht etwa als Jugendwerk des Ekklesiameisters.
88